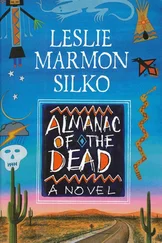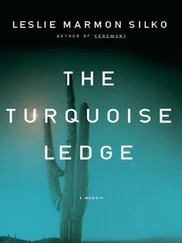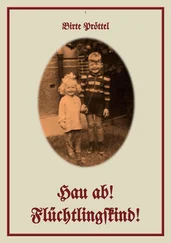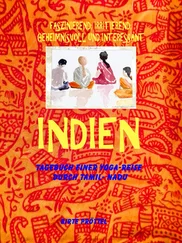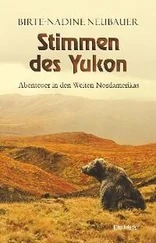»Das ist nicht korrekt« erwiderte ich. »Die Nummer stimmt schon. Aber nicht jeder in Deutschland lebt in Berlin.«
Die Frau blieb skeptisch und es dauerte eine ganze Weile, bis sie bereit war, die falsche Nummer wenigstens zu probieren. Leider nahm meine Oma nicht ab. Und so fühlte sich die Frau in der Annahme bestätigt, dass die Nummer falsch sei.
Es war also manchmal mühsam zu telefonieren. Daher entstand in mir der Wunsch nach einem eigenen Telefonanschluss. Als ich in meinem zweiten Jahr von einem Plattenbau in einen anderen zog, war einer der Aspekte, die ich bei der Wohnungsbesichtigung beachtete, das Telefon. Die neue Wohnung hatte zwar ein Telefonkabel, aber keine Nummer. Um eine Nummer zu bekommen, musste man warten, bis jemand mit Nummer aus dem Plattenbau auszog. Also wartete ich und war bis dahin – so würde man denken – telefonisch nicht erreichbar.
Aber bekanntlich macht Not erfinderisch und in der Mongolei lernt man schnell, dass man alleine nicht weit kommt. Direkt neben mir, auf derselben Etage, wohnte eine Familie aus meinem Team. Diese Leute hatten ein Telefon, das heißt ein Kabel und eine Nummer. Wer mich sprechen wollte, rief nun einfach diese Familie an, ich wurde gerufen oder sie klopften an die Wand, bis ich antwortete. Dann rannte ich fünf Etagen hinunter, in den nächsten Hauseingang und wieder fünf Etagen hoch, um anschließend atemlos zu telefonieren. Es war machbar, aber nicht ideal. Auf einmal kam mir eine vielversprechende Idee. Ich hatte eine wetterfeste Schnur in einem Outdoorladen gekauft. Ließe sich daraus eine Art Kabelbahn fürs Telefon herstellen, von Balkon zu Balkon?
Ich teilte meine Idee meinen Teamkollegen mit. Die Töchter, die in dem Balkonzimmer wohnten, waren sofort begeistert. Also verbrachten wir die nächste Stunde damit, die Schnurrolle hin und her zu werfen, bis die Balkone erfolgreich verbunden waren. Ein kleines Täschchen wurde an die Schnur geknotet und schon war das Transportmittel für das Telefon gebastelt. Wenn nun jemand für mich anrief, liefen die Töchter mit dem Telefon auf ihren Balkon, riefen laut meinen Namen und sobald ich auf meinem Balkon stand, wurde das Telefon zu mir befördert. Es klappte gut und ich musste nicht mehr rennen. Nur wurde der Aufenthalt auf dem Balkon während der Wochen, in denen ich auf meine Nummer wartete, immer kälter. Denn in meiner Wohnung selbst gab es immer noch keinen Empfang. So wurden die Telefonate immer kürzer, je näher der Winter kam. Zu meiner großen Freude zog dann doch kurz vor dem endgültigen Wintereinbruch noch jemand aus und ich bekam meine eigene Telefonnummer.
Ich kann nur sagen: Je weniger selbstverständlich etwas ist, desto mehr lernt man es schätzen.
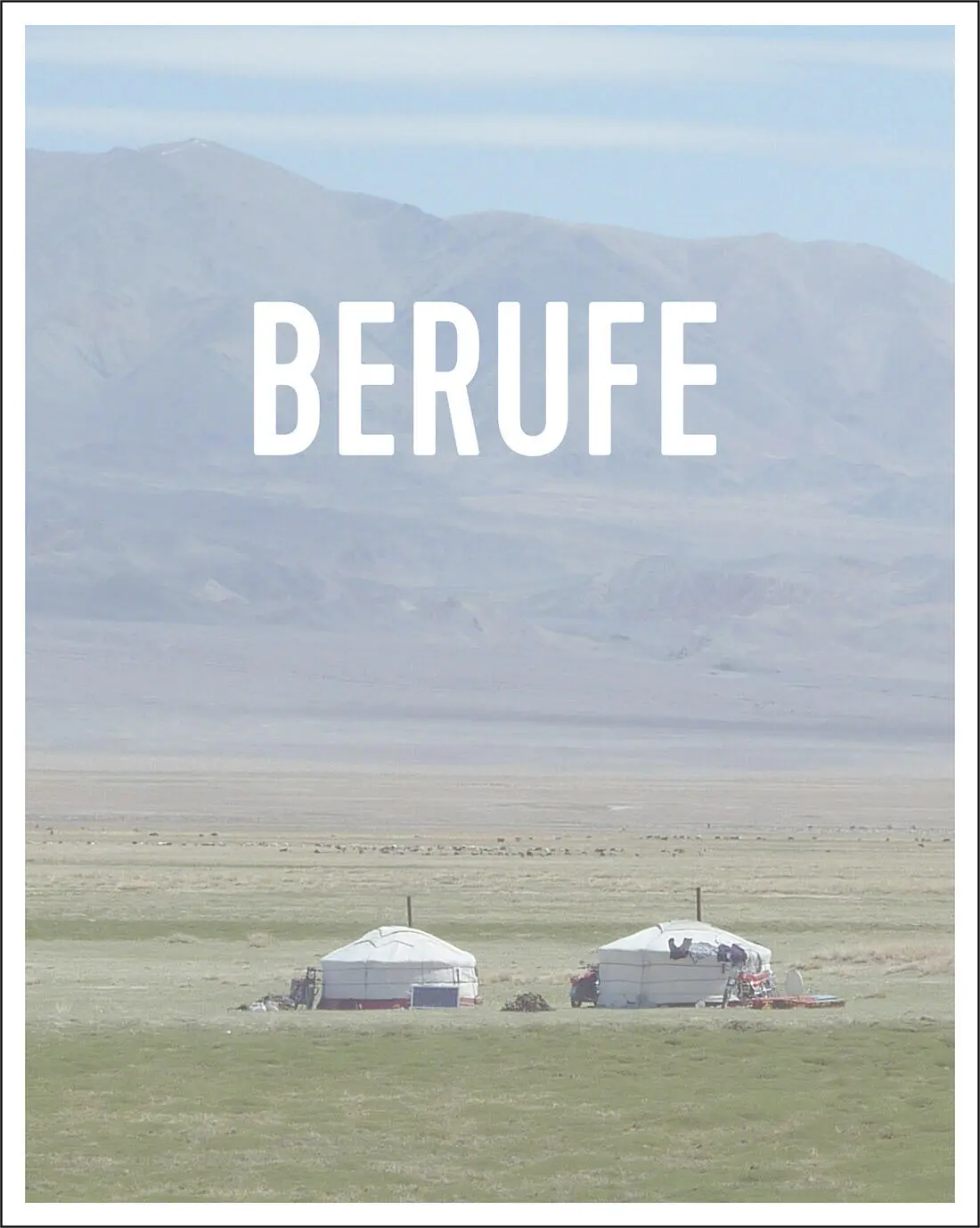 BERUFE
BERUFE
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

In der Mongolei gibt es keinen Briefträger und auch kein gelbes DHL-Auto. Dort gibt es Postfächer, die sich im Postgebäude befinden und die man mietet. In diese Postfächer werden dann alle Briefe gesteckt, für Pakete sind sie zu klein. Man bekommt also keine Post, sondern man holt sie sich ab. Lebt man in Hovd, braucht man nur zweimal in der Woche den Weg zur Post einzuplanen, denn die Post kommt per Flugzeug und das kommt nur zweimal in der Woche.
Auf der Post arbeiteten drei Frauen, alle mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Vor allem eine von ihnen lernte ich besser kennen. Sie verkaufte mir die Briefmarken und die Briefumschläge. Denn – wie sie immer wieder betonte – mongolische Post wird in mongolischen Briefumschlägen verschickt. Sie nahm meine Briefe zum Versand in Empfang und gab die für mich eingetroffene Post heraus.
Die Postfächer waren nämlich hinter der Glaswand, die den Kundenbereich vom Beamtenbereich abgrenzte. Und da durfte ich – zumindest am Anfang – nicht einfach eintreten. Ich musste jedes Mal höflich fragen, ob Post für das Fach 315 gekommen sei. Wenn meine dafür verantwortliche Postfrau nicht im Raum war, musste ich warten, bis sie erschien. Die anderen beiden Frauen waren nicht dafür zuständig und standen dementsprechend nur äußerst selten von ihrem Stuhl auf, um ins Postfach 315 zu schauen.
Nun gut, man ist zu Gast in der Mongolei und das heißt, sich an die mongolischen Verhältnisse anzupassen: den Staatsbeamten zu akzeptieren, freundlich zu behandeln, jedes Mal zu danken und sich an die Regeln zu halten. So vergingen einige Monate. Dann kam der Dezember, ein Monat wie jeder andere in einem kommunistischen Land. Daher waren die Postfrauen nicht auf den Weihnachtspostansturm vorbereitet. Lag sonst ab und zu mal ein Päckchen in der Ecke des Beamtinnenraumes, stapelten sich im Dezember die Päckchen und Pakete. Sie bildeten einen Haufen und drangen in die persönliche Arbeitssphäre der Beamtinnen vor.
Ich kam, fragte höflich, ob Post für Fach 315 gekommen sei, und bekam ein »Oh ja!« zur Antwort. »Hier sind die Briefe. Ob für Sie ein Paket angekommen ist, da schauen Sie mal lieber selber.«
Und so durfte ich hinter die Glaswand treten, an dem Bürotisch vorbeilaufen und mich dem Paketehaufen widmen. Pakete für Englischlehrer der Universität, für die Mitarbeiter des deutschen Entwicklungsdienstes und für Leute vom amerikanischen Peace Corps lagen da – und auch ein Paket für mich. Meine Postfrau überprüfte die Adresse und den Namen und ich durfte gehen. Dieser Vorgang wiederholte sich nun bei fast jedem Postgang bis Mitte Januar. Der Paketefluss nahm zwar ab, aber die Barriere zwischen Kundin und Postbeamtin war durchlässiger geworden.
Von nun an kam ich in die Post, schaute fragend zu den Beamtinnen, erhielt ein Kopfnicken und ging selbst zum Postfach 315, um nachzusehen, ob Briefe da seien. Lag etwas in der Päckchenecke, durfte ich sogar dort hintreten und auf den Namen schauen.
In den darauffolgenden Jahren wuchs die Bekanntschaft und das Vertrauen. Manchmal geschah es sogar, dass ich gebeten wurde, Post und Päckchen, die sich bereits stapelten, zu Ausländern mitzunehmen, die schon lange nicht mehr auf der Post erschienen waren. Denn die Postfrau wollte natürlich auch Klarschiff machen.
Hin und wieder kam es vor, dass Briefe und vor allem Päckchen nach der langen Reise die Posträume beschädigt erreichten. Einmal war das Paket in seiner vollen Breite aufgerissen und die gute deutsche Salami und andere Leckereien waren offen sichtbar. Ich nahm das Paket an mich, wog es in meiner Hand und befand es für ein 2-Kilo-Paket als zu leicht. Den ganzen Nachhauseweg über wütete in mir das Gefühl, betrogen worden zu sein. Ich war fest überzeugt, dass sich da jemand an meinen Geschenken gütlich getan hatte. Sobald ich bei meiner Jurte ankam, zog ich die Handwaage hervor und überprüfte das Gewicht meines kostbaren Päckchens. Es wog 1,947 kg! Nicht das kleinste Schokolädchen war entfernt worden! Wenn mein offenes Paket für die Postfrauen eine Versuchung dargestellt hatte, hatten sie ihr erfolgreich widerstanden.
Ich war beeindruckt, beschämt, dankbar. Und bis zu meinem Wegzug hatten wir eine hervorragende Beziehung.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Als ich in der Mongolei ankam, gab es nur eine Bahnschiene, die Russland im Norden und China im Süden verband. Für den Rest des Landes bestand der öffentliche Transport aus privaten Autofahrern, die von A nach B fuhren und so lange am Markt auf Mitreisende warteten, bis ihr Auto voll war. Man konnte auch einen dieser Fahrer mieten und das Auto selbst füllen.
Читать дальше
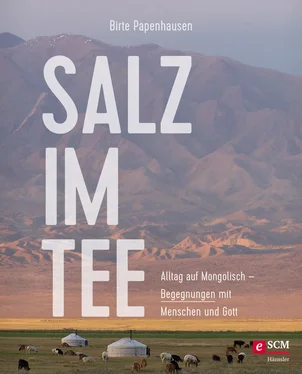
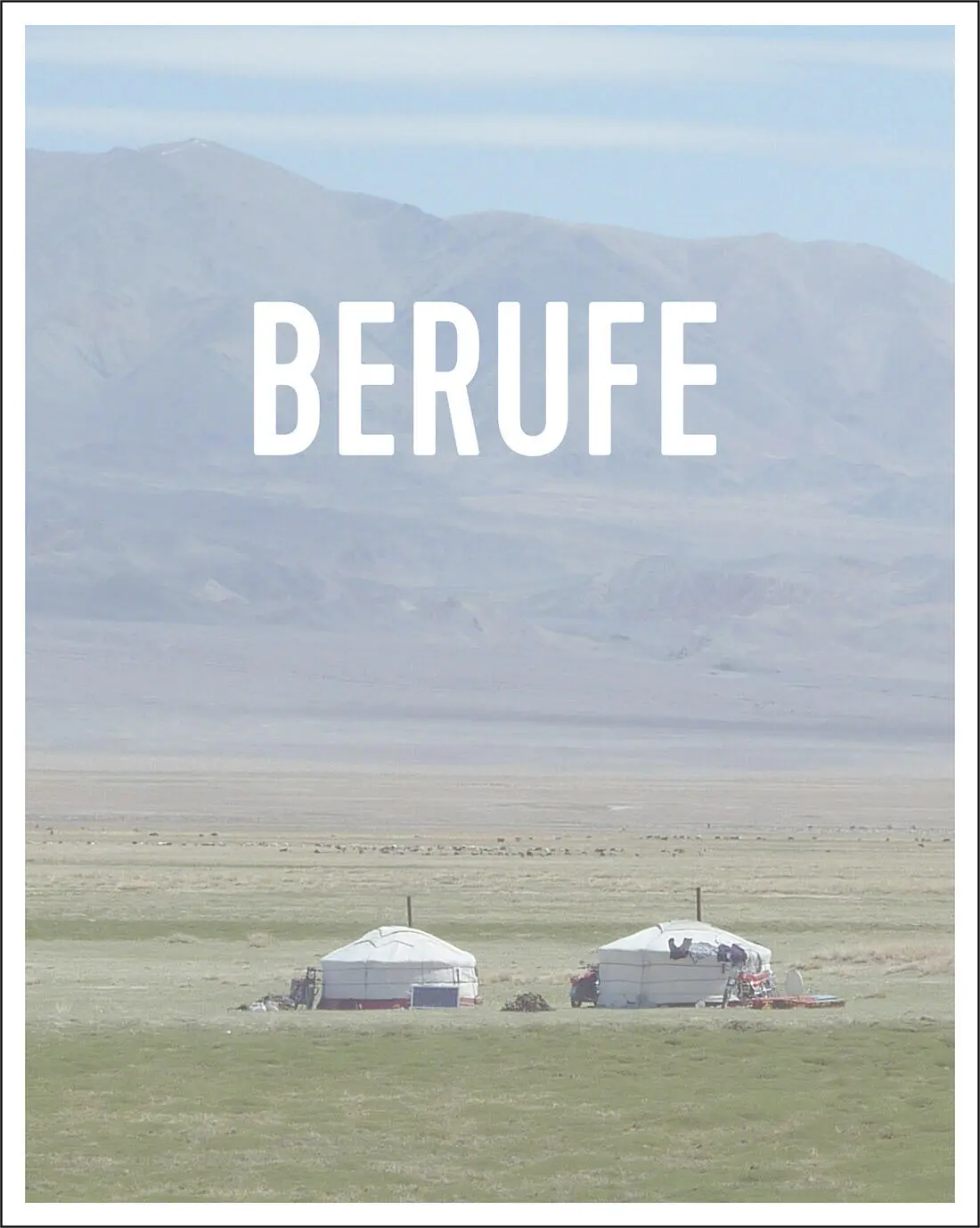 BERUFE
BERUFE