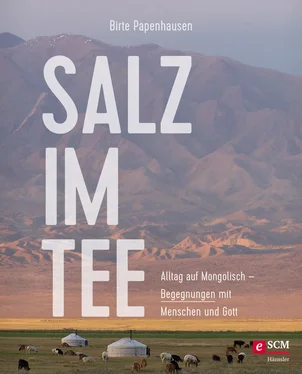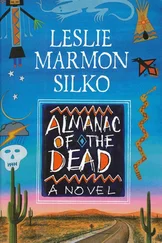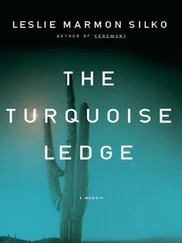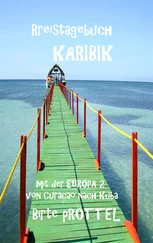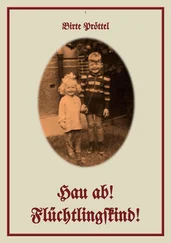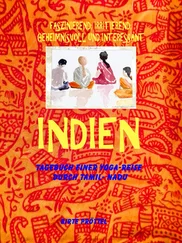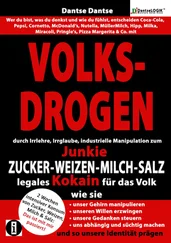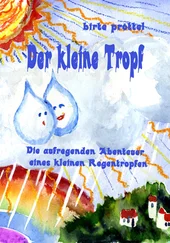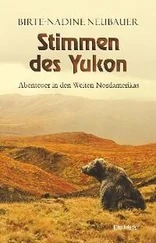Ich sagte nichts, denn meine Begeisterung hielt sich ehrlich gesagt sehr in Grenzen. Die Kleidung und die Instrumente waren zwar interessant anzusehen, aber die Musik empfand ich nicht nur als fremdartig, sondern fast als schwer zu ertragen. Zutiefst hoffte ich, dass es chinesische Musik sei und ich in den kommenden Jahren nicht solche Klänge hören müsse. Auf meine diesbezügliche Frage bekam ich eine eindeutige Antwort: »Mongolischer geht’s nicht.«
Es war für mich also kein besonders guter Start, aber ich lernte schnell, dass die Musik einen großen Teil der mongolischen Seele ausmacht. In der Mongolei gewinnt man Herzen am schnellsten für sich, indem man singt, vor allem wenn es sich um mongolische Lieder handelt.
An meiner Sprachschule war das auch bekannt und so war es Teil meines Unterrichtprogramms, einige mongolische Lieder zu lernen. Kaum zu glauben, das erste Lied, das ich lernen sollte, war doch tatsächlich genau das, das ich bereits bei der Konferenz gehört hatte – das Lied von den Zugvögeln! Die nächsten zwei Lieder waren »Der Tee, den meine Mutter kochte« und das »Loblied auf die Mutter«, welches vorzugsweise bei Hochzeiten als Dank gesungen wird. Im Laufe der Jahre kamen noch viele andere Lieder dazu. Denn wohin man auch kam, es wurde viel und gern gesungen. Gemeinsam, wohlgemerkt. Das kollektive Liedrepertoire der Mongolen ist beeindruckend. Bei meiner Überlegung, welche Lieder wohl alle Deutschen auswendig singen könnten, kam ich auf keine Handvoll und war beschämt.
Mongolische Musik hörte man vor allem bei Autofahrten. Am Anfang, wenn alle noch wach waren, musste jeder reihum ein Lied anstimmen und der Rest der Mitfahrer fiel bei der zweiten Zeile ein. Stunden später verstummte die Livemusik und der Fahrer steckte seine Lieblingskassette in den Rekorder. Die hörte man dann für den Rest der langen Fahrt. Immer wieder, stunden-, ja manchmal sogar tagelang. Manchmal wurde die Musik zum Zeitmesser. Wenn wieder das erste Lied erscholl, wusste man, es war eine weitere Stunde um. Es dauerte Tage, bis man diese Lieder danach nicht mehr im Kopf hatte.
Aber die mongolische Musik besteht nicht nur aus Schlagern und Volksliedern. So ist die Mongolei auch für den Kehlkopfgesang zu Recht berühmt. Es berührte mein Herz, als ich einmal mitbekam, wie Schüler beim Putzen ihres Klassenzimmers mit dem Kehlkopf sangen.
Dann gibt es noch die Longsongs, die bei mir immer Gänsehaut hervorriefen, weil der Klang so einmalig und voll ist, vor allem wenn sie in Gruppen gesungen werden. Es sind alte Lieder, deren Vokale so lang gezogen werden, dass man den Text nur sehr schwer verstehen kann. Aber es geht bei diesen Liedern auch nicht um den Text, es geht um die Atmosphäre, die hervorgerufen wird. Wenn man diese Lieder hört, spürt man geradezu die Weite der Mongolei. Mir wurde einmal erzählt, dass früher Distanzen an Hand dieser Longsongs berechnet wurden. »Sechs Longsongs in diese Richtung und dann siehst du die Jurte.« Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich so war.
Und dann gab es als ganz neue Rubrik die Lobpreislieder in den christlichen Gemeinden. Die ersten Lieder waren aus dem Englischen und Koreanischen übersetzt worden. Aber da in der Mongolei die Fünftonmusik und ein ganz anderer Takt verwendet werden, veränderten sich die westlichen Lieder oft ins Unerkennbare. Auch dauerte es nicht lange, bis die ersten mongolischen Christen anfingen, selbst Lieder zu komponieren.
Natürlich waren sie in meinen Ohren fremdländisch, doch erstaunlich war: Am Ende meiner Zeit in der Mongolei sang ich gerade die mongolischen Lobpreislieder am liebsten. Und auch das Lied von den Zugvögeln schmettere ich inzwischen mit wahrer Wonne.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Schon in der Schule waren Englisch und Französisch meine schlechtesten Fächer. Als ich endlich mein Abitur geschafft hatte, freute ich mich vor allem darüber, ab jetzt nur noch Deutsch zu sprechen. Ich hatte mich geirrt, denn ich lebte nach meinem Abi nur ein Jahr in Deutschland und hielt mich anschließend 16 Jahre im Ausland auf. Man hatte mich vorgewarnt, dass Mongolisch nicht einfach sei. Für Menschen mit anglosächsischem Sprachhintergrund gehöre Mongolisch zu den fünf am schwersten zu erlernenden Sprachen.
Ich ließ mich nicht entmutigen, im festen Glauben, dass ich mit Gott »über Mauern springen« kann. Aber anstatt über Mauern zu springen, rannte ich dagegen. Nie hatte ich nur im Entferntesten gedacht, dass Menschen so anders denken und eine Sprache so völlig anders sein könnte. Die mongolische Sprache wurde die größte intellektuelle Herausforderung meines Lebens, eine Quelle ständiger Frustration, der Grund vieler Tränen und eine lang anhaltende Lektion der Demut.
Auf einmal bekam die Geschichte vom Turmbau zu Babel eine persönliche Bedeutung. Warum nur, warum waren die Leute damals so stolz gewesen?! Hätten sie sich nur brav kleine Häuschen gebaut, müsste ich mich jetzt nicht mit dem Mongolischen abkämpfen!
Aber die Geschichte bewirkte auch eine neue Achtung vor Gott in mir. Ich kann mir kaum ein effektiveres Mittel vorstellen, als das Erlernen einer schweren Sprache, um stolze Menschen demütig zu machen. Man kann jemand sein, man kann viel wissen, man kann vor Erfahrungen nur so strotzen, doch sobald man in einem anderen Land ist und die Sprache nicht spricht, verstummt man. Nichts von dem, was man ist und weiß, kann man vermitteln. Die ersten Sprechversuche rufen Unverständnis oder vielleicht sogar Belustigung hervor. Man wird zu einem schweigenden Beobachter, nach dem niemand fragt.
Kleinste Aufgaben werden zur unüberwindlichen Herausforderung, sobald Sprache nötig ist. Man freut sich über gelungene Tätigkeiten, die Sprachkundige nebenbei erledigen. Man ist ständig unsicher, ständig überfordert, ständig müde und man erkennt im tiefsten Innern, wie wertlos alle vorherigen Errungenschaften sind und wie wichtig es ist, von Gott gesehen und geliebt zu werden. Denn er kennt unser Innerstes, er kennt unsere Gedanken, bei ihm müssen wir sie noch nicht einmal aussprechen, egal, in welcher Sprache, bei ihm dürfen wir sein.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]

Als ich in die Mongolei kam, gab es noch keine Handys. Und nur die wenigsten Menschen hatten einen Festnetzanschluss. Der wäre ja auch völlig nutzlos in einer nomadischen Kultur und einem Land, dessen Bevölkerung überwiegend in Jurten lebt.
Daher gab es öffentliche Telefone. Das waren keine Telefonzellen, sondern Menschen, die mit ihren tragbaren Telefonen auf den Straßen herumgingen und sie ihren Mitmenschen gegen Bezahlung zur Verfügung stellten.
Für Auslandsgespräche musste man allerdings zu bestimmten Stellen gehen, die ein internationales Festnetz hatten. Dort angekommen gab man die gewünschte Telefonnummer der Person mit dem Telefon, diese wählte und – wenn jemand abnahm – wurde einem der Hörer überreicht. Ab dann lief die Uhr, damit man später die Minuten bezahlen konnte. So wenigstens sah die Theorie aus. In der Praxis war es allerdings nicht immer so einfach. Oft war die Telefonperson nicht da und – wenn sie da war – passte ein Auslandsanruf oft wegen des Zeitunterschiedes nicht. Manchmal waren lange Schlangen vorhanden, manchmal hatte man die Telefonnummer nicht zur Hand und manchmal wurde die Telefonnummer einfach nicht akzeptiert.
So erging es mir, als ich meine Oma in Norddeutschland zum Geburtstag anrufen wollte. Die Telefonfrau sah die Nummer und fragte, welches Land das sei, und meinte dann: »Diese Nummer stimmt nicht. Wenn es Deutschland ist, dann muss die Nummer mit 030 anfangen.«
Читать дальше