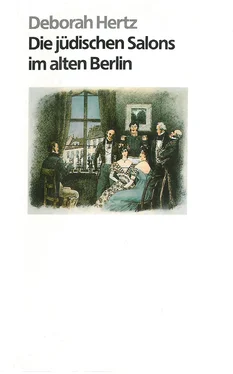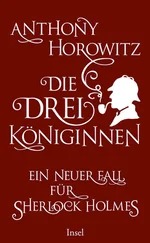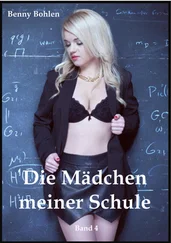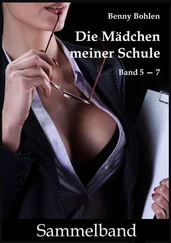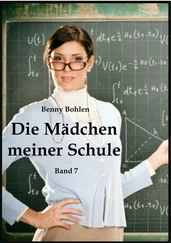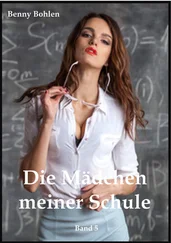Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin
Здесь есть возможность читать онлайн «Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die jüdischen Salons im alten Berlin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die jüdischen Salons im alten Berlin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die jüdischen Salons im alten Berlin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die jüdischen Salons im alten Berlin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die jüdischen Salons im alten Berlin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Nicht minder entscheidend für die Entstehung der Salongesellschaft waren die Freundschaften der jüdischen Frauen, zu deren engsten Freundinnen Adlige und Schauspielerinnen sowie Jüdinnen zählten, die auch den Sprung aus den Fesseln ihrer Gemeinde und Traditionen wagen wollten. Im Gegensatz zur vorherrschenden Auffassung wár die Assimilation der jüdischen Salonfrauen nämlich kein bloßer individualistischer Akt. Vielmehr unternahmen die Frauen diese Reise gemeinsam, als eine kleine Gruppe, die durch ihre familiären Bedingungen, durch ein selbstgewähltes und dennoch schmerzlich empfundenes Außenseitertum sowie durch die Leidenschaft für das literarische Leben miteinander verbunden waren.
Die meisten Salonteilnehmer waren zwischen zwanzig und vierzig Jahre alt und verfügten über ein im Verhältnis zu ihrem Status entweder größeres oder geringeres Einkommen; Adlige waren eher ärmer, Juden dagegen eher reicher. Zudem spielte in der Salonkultur die Nachahmung der lokkeren Sitten des französischen Adels eine besondere Rolle. So wurden Salons zur Bühne für exotische und romantische Liaisons, die nicht selten in Ehen mündeten, an denen auf weiblicher Seite beinahe stets geschiedene und konvertierte Jüdinnen beteiligt waren. Um zu erfahren, wie es dazu kam, daß jüdische Ehemänner ihre Frauen verloren, und was andererseits die neuen Verbindungen begünstigte, müssen wir die Rolle der ökonomischen Nöte auf der nichtjüdischen Seite sowie jene des Reichtums auf der jüdischen Seite näher beleuchten.
In den Hauptabschnitten dieses Buches möchte ich die Vielfalt der Verbindungen aufzeigen, welche die Salongesellschaft zusammenhielt, und mich im Schlußkapitel dem Auseinanderbrechen der jüdisch-deutschen Salongesellschaft zuwenden, welches in der Tat schon während ihres kulturellen Höhepunkts einsetzte. Merkwürdigerweise teilten viele der angesehenen christlichen Salongäste ein höchst zwiespältiges Verhalten gegenüber ihren jüdischen Gastgeberinnen, auch wenn sie ihnen mit ihren Besuchen schmeicheln wollten. Zudem lassen gerade die seit 1803 in Berlin vermehrt auftauchenden judenfeindlichen Schriften erkennen, daß nicht zuletzt der Erfolg der jüdischen Salonières mit zu dem neuen Antisemitismus beitrug, der sich gerade auch unter der lokalen Intelligenz auszubreiten begann. Dieser richtete sich gegen die mit dem Salonleben verbundene Assimilationspraxis und schwächte allmählich die Position der jüdischen Salonières.
Die gesellschaftlichen und institutionellen Bedürfnisse, denen die Berliner Salons nachgekommen sind, sollten in der dort gegebenen Konstellation in keiner anderen deutschen Stadt mehr auftauchen und künftig auch nicht mehr in Berlin. In diesem Sinn trifft die bisherige historiographische Überzeugung von der geographischen wie geschichtlichen Einzigartigkeit der Berliner Salons des ausgehenden 18. Jahrhunderts in der Tat zu. Indem ich zu rekonstruieren versuche, warum Salons dann und dort entstanden, will ich das Einzigartige vom Zufälligen trennen und davon erzählen, wie ein Augenblick in der deutschen Geschichte vollkommen logisch sein konnte – auch wenn er allzu flüchtig war.
2 Gesellschaftsstruktur

Rahel Levin
Preußische Widersprüche
Berlinbesucher, die vor zwei Jahrhunderten ihre Reiseeindrücke publik machten, schildern die städtische Szenerie meist in enthusiastischen Farben. Die Fremden waren besonders beeindruckt von den stattlichen Palais, dem neuen Opernhaus und den geschmackvoll gekleideten Spaziergängern auf der großzügig angelegten Allee Unter den Linden oder im Tiergarten. Ihre Beobachtungen galten ihnen als hinreichende Beweise für das Wohlergehen der ganzen Stadt. Viele ihrer in Berlin lebenden Zeitgenossen stimmten mit ein in die Lobeshymnen, und Lokalberichterstatter, die sich mehr mit den sozialen Beziehungen als mit der äußeren Gestalt der Stadt beschäftigten, entwarfen ein Bild gesellschaftlicher Harmonie, demzufolge dem Adel gemeinhin mit unterwürfiger „Hochachtung und Liebe“ begegnet wurde und Adlige und Bürgerliche denselben Vergnügungen nachgingen. Von den Wohlhabenden heißt es, daß sie ihre Garderobe weniger als anderswo zur Schau stellten, und selbst wenn die Existenz einer „Classe reicher Müßiggänger“ eingeräumt wurde, so betonte man doch sogleich, daß deren Zahl eher „unbedeutend“ gewesen sei. Besonders überschwänglich wurde die angebliche soziale Gleichheit gelobt; das Gesellschaftsleben habe buchstäblich jedem, gleich welchen Standes, offengestanden. Und in Abgrenzung von den deutschen Handelsstädten heißt es: „Berlin unterscheidet sich auch von den Städten, wo nur der Gelehrte, der Künstler, der betitelte ... Mann gesucht, alle andern hingegegen vergessen, vernachlässigt oder herabgesetzt werden. Man weiß von keinem Vorzuge als von dem, welchen Tugend, Rechtschaffenheit und große und erhabene Einsichten gewähren. Des tugendhaften und rechtschaffenden Mannes Gesellschaft wird gesucht, er mag Jude oder Christ, Rat, Doktor, reich oder arm sein.“
Aber nicht alle Beobachter gaben sich damit zufrieden, daß die Stadt einen äußerlich guten Eindruck machte und das gesellschaftliche Leben oberflächlich intakt schien. Lakonisch urteilte ein Besucher: „Wo man hinblickt, ist Armuth und Noth, aber mit einem glänzenden Firniß überzogen.“ Und Georg Forster fand nach seinem Besuch 1779 bittere Worte: „Ich hatte mich in meinen mitgebrachten Begriffen von dieser großen Stadt sehr geirrt. Ich fand das Äußerliche viel schöner, das Innerliche viel schwärzer, als ich mir gedacht hatte. Berlin ist gewiß eine der schönsten Städte in Europa. Aber die Einwohner!“ Gutaussehende Häuser waren bei näherer Betrachtung oft heillos überfüllt, die breiten Straßen vor den imposanten Palais waren nachts schlecht beleuchtet und vor allem im Frühjahr mit Schlamm bedeckt, und kein schöner Anblick bot sich dem, der sich in die neuen Vorstädte begab, die zusammen mit Kasernen und Militärbaracken außerhalb der Stadtmauern aus dem Boden gestampft worden waren.
Daß sich die Verhaltensweisen der Menschen über Standesgrenzen hinweg einander annäherten, wurde, je nach Standpunkt des Beobachters, begrüßt oder bedauert. Schon 1760 klagte der Kammerherr der Königin, Graf von Lehndorff, darüber, daß der Konsum von Genußmitteln längst nicht mehr das alleinige Privileg der Aristokratie sei. Einen Stein des Anstoßes boten auch die Tiergartenpromenaden, die gerade jüdischen Frauen die Gelegenheit zur Begegnung mit nichtjüdischen Männern boten: Dieser „Lustgarten“, vormals der „Sammelplatz der sogenannten schönen und vornehmen Gesellschaft“, diene nunmehr den „galanten Jüdinnen ... denen zu gefallen mancher junge Stutzer hingeht“. Jüdische Frauen waren jedoch keineswegs die einzigen Berliner, die durch ihr Verhalten die traditionelle gesellschaftliche Rangordnung verletzten und deshalb angegriffen wurden. Bürgerliche Frauen, die durch luxuriöse Anschaffungen den Lebensstil der Oberschicht nachzuahmen suchten, wurden beschuldigt, ihre Familien zu ruinieren. Nicht mehr als achthundert Taler im Jahr verdienende Ehemänner beklagten sich über die von ihren Frauen gewünschten Reif röcke, Seidenkleider und Empfangszimmer. Von einfachen Perückenmachern und Schneidern hieß es, daß sie sich „in gestickten und betreßten Kleidern“, die einst nur ihren vornehmen Kunden vorbehalten waren, „unter Leute von Stand mischten“.
In solchen Kommentaren aus den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, die das Undeutlichwerden der sozialen Schranken entweder feierten oder denunzierten, spiegelten sich die Resultate einer zutiefst widersprüchlichen Politik des Staates. Im 17. und 18. Jahrhundert bestand das Hauptziel der preußischen Regenten darin, das Land in eine europäische Großmacht zu verwandeln – eine gewaltige Aufgabe, wenn man die begrenzten geographischen und gesellschaftlichen Ressourcen bedenkt, die dem Staat zunächst zur Verfügung standen. Um dieses Ziel zu erreichen, führte Friedrich der Große (1740–1786) zahlreiche Eroberungskriege und baute eine riesige Armee und einen funktionierenden Verwaltungsapparat auf. Die religiöse Toleranz der Könige ermöglichte eine flexible Einwanderungspolitik, die mit zum Aufstieg Preußens beitrug. Um die industrielle Entwicklung zu fördern, hatte das Land im Jahre 1685 aus Frankreich vertriebene hugenottische Handwerker aufgenommen. Gleichfalls wurden reiche Juden, die 1671 aus Wien vertrieben worden waren, nach dem kapitalbedüftigen Preußen gerufen, um sich dort als Händler niederzulassen. Doch waren dieselben tatkräftigen Monarchen, die Preußen zur Großmacht ausbauten, zugleich leidenschaftliche Anhänger und Bewahrer einer überkommenen Gesellschaftsordnung, deren Leitprinzip das uneingeschränkte Privileg des Adels auf Grundbesitz bildete.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die jüdischen Salons im alten Berlin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.