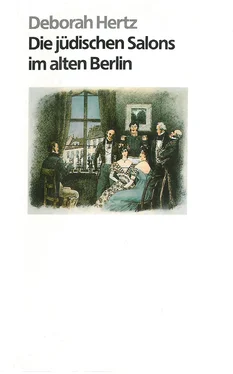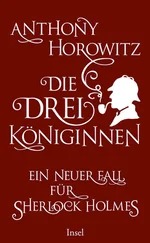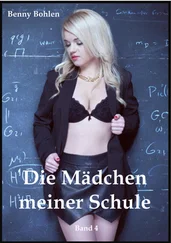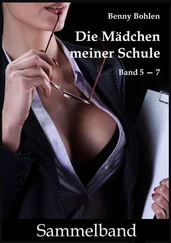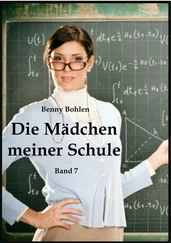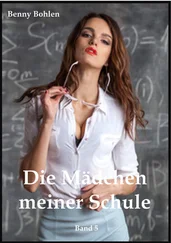Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin
Здесь есть возможность читать онлайн «Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die jüdischen Salons im alten Berlin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die jüdischen Salons im alten Berlin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die jüdischen Salons im alten Berlin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die jüdischen Salons im alten Berlin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die jüdischen Salons im alten Berlin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ein Nazi-Historiker fand dabei eine besonders simple Deutung: Der Reichtum der „Kulturjuden“, wie er sie nennt, verursachte erst ihren kulturellen Erfolg, der geradezu „verschwörerisch“ dahingehend eingesetzt wurde, Besucher in die Salons zu ziehen, um von dieser „neuen kulturellen Bastion dann endlich auch mit voller Wirksamkeit in das politische und staatliche Leben zumindest auf dem Weg der geistigen Beeinflussung vordringen“ zu können. Seriöser ist eine andere Interpretation, die sich auf die „jüdische Marginalität“ als Ursache für die Aufnahme progressiver Ideen konzentriert. Aus dieser Sicht hatte die Randexistenz der Juden ihren Ursprung im Ausschluß von allen anderen gesellschaftlichen Einbindungen. Die Kluft zwischen der verbalen Beteuerung, daß Juden „gleich“ sein sollten, und ihrer tatsächlichen Unterdrückung ließ diese erst recht zu Außenseitern werden, während der jüdische Kampf um politische Emanzipation andererseits zur Freisetzung besonderer Fähigkeiten führte. Da die Salons von Jüdinnen getragen wurden, konzentrierten sich Historiker naturgemäß auch auf die besonderen Eigenschaften der in Berlin lebenden jüdischen Frauen. Doch damit machten sie es sich zumeist allzu leicht. Die Berliner Jüdinnen sollen „kultivierter“ und „gebildeter“ als ihre christlichen Zeitgenossinnen hier und anderswo gewesen sein, doch fehlt jeglicher Hinweis auf die möglichen Ursachen.
Ein dritter Erklärungsversuch hebt die besonderen Bedürfnisse der Intelligenz hervor. Die aufgeklärten Intellektuellen sollen von einer Leidenschaft für Ideen als solche erfüllt gewesen sein, und mit ihren Besuchen in jüdischen Häusern konnten sie ihr emanzipiertes Denken öffentlich kundtun. Andere Historiker weisen auf die materiellen Nöte der Intellektuellen hin. Nachdem die Höfe sich von ihrer Mäzenatenrolle zurückgezogen und bevor das Verlagswesen seine Blüte entfaltet hatte, habe in den europäischen Städten ein „Vakuum“ an intellektuellen Institutionen bestanden. Indem Verleger, Mäzene und Leser sich am Salonleben beteiligten, förderten sie die Autoren und trugen zur Entstehung und Verbreitung ihrer Werke bei. Im ausgehenden 18. Jahrhundert war der Zustand der Berliner intellektuellen Institutionen beklagenswert, fehlten der Stadt doch ebenso eine Universität wie ein Parlament, eine großzügige höfische Patronage wie ein bedeutendes Verlagswesen. Demnach tauchten die Salons deshalb auf, weil sie als Institution für die Berliner Intelligenz erforderlich waren.
Auf den ersten Blick scheinen diese drei Erklärungen sich zu ergänzen. Intellektuelle waren darauf angewiesen, Leser, Mäzene und Verleger zu finden, während die städtischen Adligen die kultivierte Unterhaltung mit den Deklassierten suchten. Intellektuelle und Adlige gingen deshalb in die Häuser reicher Juden, deren Frauen gesellschaftlich neutral und intellektuell avanciert zugleich waren. Doch Zweifel an der Stimmigkeit dieses Erklärungsmodells sind angebracht. Denn wie so oft in der deutschen Geschichte wurden auch hier die Gründe, warum Adlige und Intellektuelle jüdische Salons aufsuchten, idealisiert.
Sollten beide Gruppierungen sich wirklich nur deshalb zum Besuch jüdischer Salons herabgelassen haben, um sich dort angeregt zu unterhalten oder um ihre Fortschrittlichkeit unter Beweis zu stellen, wo doch solch ein Verhalten unter ihren Vorgängern in Deutschland und nach wie vor auch anderswo in Europa höchst selten anzutreffen war? Zugegeben, Berlin war ein wichtiges Zentrum für die Entstehung und Verbreitung der Aufklärungsideen, doch ihre Blütezeit erlebten die Salons am Ende der Aufklärungsepoche. Und diese fiel in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts mit dem Beginn der Frühromantik zusammen. Viele romantische Intellektuelle, selbst die unter ihnen, die Salonbesucher waren, nahmen gegenüber dem Judentum späterhin eine problematische, wenn nicht offen antisemitische Haltung ein. Die Avanciertheit des Denkens war mithin nicht der ausschlaggebende Grund für den Salonbesuch – gab es vielleicht handfestere Motive? Da Besuche in jüdischen Häusern dem Ansehen der Nichtjuden in den Augen mancher geschadet haben sollen, stellt sich die Frage, ob diese Gäste sich womöglich finanzielle Vorteile davon versprachen. Je länger ich darüber nachdachte, warum in Berlin Salons aufgetaucht waren, desto schwerer fiel es mir, mit den geläufigen Erklärungsmodellen für diese faszinierende Epoche zurechtzukommen. Die jüdischen Salonières standen dort einer in sozialer wie religiöser Hinsicht buntgemischten Gesellschaft beiderlei Geschlechts vor, die in Deutschland einzigartig war und blieb. Alle Untersuchungen zur Geschichte der Salons gehen davon aus, daß jene Frauen ein dreifaches Kunststück zustande brachten. Indem sie sich von ihren traditionellen, patriarchalischen Familienverhältnissen emanzipierten, trugen sie in einer ebenso entscheidenden wie kreativen Zeit zur Entstehung einer gehobenen Geisteskultur bei und knüpften im gleichen Zuge neue Verbindungen zwischen den Klassen, Religionen und Geschlechtern. Dieses mehrfache Kunststück ist deshalb so bemerkenswert, weil die Existenz der Salons auf drei Gebieten der allgemeinen historischen Entwicklung widerspricht: Zum einen sind die Salons eine Ausnahmeerscheinung der deutschen Sozialgeschichte. Die Gesellschaftsstruktur war hier bis ins 20. Jahrhundert hinein weitaus rigider und geschlossener als im übrigen Europa. Wenn es in Deutschland jemals zu klassenüberschreitenden Verbindungen gekommen sein soll, warum ausgerechnet zu einem solch frühen Zeitpunkt, wo die sozialen Gruppierungen noch starr innerhalb der ihnen zugewiesenen Standesgrenzen verharrten? Zum zweiten blieben die Berliner Salons auch im Hinblick auf die deutsch-jüdische Geschichte eine Ausnahmeerscheinung. Die Juden erhielten in Deutschland erst 1871 die vollen Staatsbürgerrechte, und bis ins 20. Jahrhundert hinein gelang es nicht einmal den reichsten Juden, mit Nichtjuden gleichen Besitzstandes einen selbstverständlichen Umgang zu pflegen. So boten die Berliner Salons die Erfüllung des Traums von der Assimilation im kleinen. Wie soll man aber den Zeitpunkt ihres Erscheinens auf der historischen Bühne erklären? Warum entstehen sie gleich zu Beginn der sich so langsam entwickelnden jüdischen Emanzipationsbewegung? Und drittens stellten die Salons zudem eine Ausnahmeerscheinung in der Geschichte der jüdischen Frau dar. Über die gesamte neuzeitliche Epoche hinweg blieben die jüdischen Frauen in Ost- wie in Westeuropa gewöhnlich ihrem Glauben und ihrer Familie treu und wurden keineswegs, wie man von den Berliner Salonières behauptete, zu „Glaubensdeserteuren“.
Die Stellung der Berliner Salons in diesem vielschichtigen historischen Kontext blieb nicht das einzige Problem. Noch immer lag die Geschichte der Salons als Institution teilweise im dunkeln. Der Begriff „Salon“ ging in den Sprachgebrauch ein als Bezeichnung eines besonderen öffentlichen Raumes, der zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert in reichen europäischen Häusern entstanden war. Die „große Halle“, die das Zentrum des mittelalterlichen Familienlebens der Wohlhabenden bildete, hatte ihren privaten Charakter verloren, und die Schlafstätten waren aus ihr entfernt worden. Was fortan Salon genannt wurde, war ein reich ausstaffierter halböffentlicher Raum, wo man Klavier spielte, das Essen servierte und Gäste empfing.
Die zweite Bedeutung des Wortes „Salon“ galt dem besonderen gesellschaftlichen Ereignis, das regelmäßig in einigen dieser Empfangszimmer stattfand und von der Dame des Hauses organisiert wurde, die auch den für das Salonleben so charakteristischen intellektuellen Diskurs leitete.
Salontreffen lassen sich am sinnvollsten als eine besondere Art des „gesellschaftlichen“ Ereignisses verstehen. In vergangenen Jahrhunderten bezog sich der Terminus „Gesellschaft“ nicht, wie im heutigen Sprachgebrauch üblich, auf die Gesamtheit der Individuen, die als Mitglieder einer Gemeinschaft leben, sondern nur auf eine ganz bestimmte Gruppe innerhalb einer solchen Gemeinschaft, nämlich auf die Vornehmen und Reichen. Wenn Mitglieder dieser „Gesellschaft“ untereinander verkehrten, war das von so universaler Bedeutung, daß beispielsweise jene, die in Frankreich „dazugehörten“, sich selbst als „le monde“ bezeichneten. Weil bei solcherart gesellschaftlichen Begegnungen gewöhnlicherweise Familienmitglieder aus verschiedenen Ständen und Berufen aufeinandertrafen – beispielweise Großgrundbesitzer, hohe Beamte und Finanziers, jeweils mit ihren Frauen und Töchtern –, waren diese Ereignisse sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die glücklichen Teilnehmer von entscheidender Bedeutung. Status, Reichtum, Ämter und sogar Töchter wurden bei diesen Anlässen gehandelt, und dies zu einer Zeit, in der jeglicher sozialer Aufstieg für Männer durch eine starre Ständeordnung blockiert war. Sofern Gesellschaftstreffen auch Intellektuellen offenstanden und zudem von einer Frau mit intellektuellen Talenten und Ambitionen geleitet wurden, nannte man sie Salons.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die jüdischen Salons im alten Berlin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.