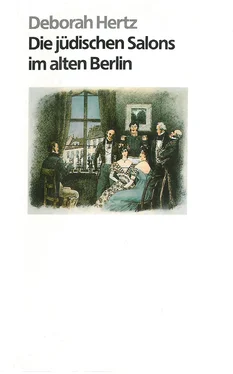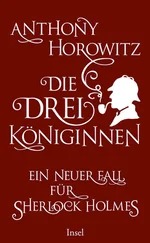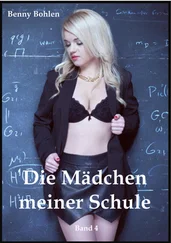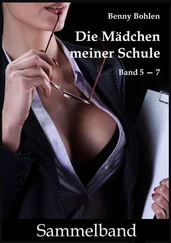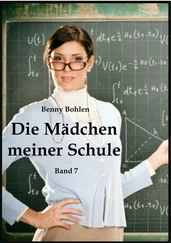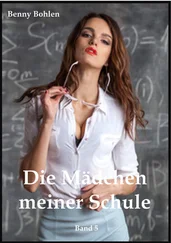Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin
Здесь есть возможность читать онлайн «Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die jüdischen Salons im alten Berlin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die jüdischen Salons im alten Berlin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die jüdischen Salons im alten Berlin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die jüdischen Salons im alten Berlin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die jüdischen Salons im alten Berlin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Dem wirtschaftlichen Reglement, dem die jüdische Gemeinde unterworfen war, entsprach eine gleichermaßen komplexe rechtliche Hierarchie. An der Spitze standen Juden, die auf drei Arten geschützt waren. Ganz oben die „außerordentlich“ geschützten Familien, deren Oberhäupter ein Generalprivileg besaßen, das ihnen und ihren Kindern die gleichen Wohn- und Arbeitsrechte einräumte wie den nichtjüdischen Kaufleuten. Unter Friedrich dem Großen gab es etwa hundert Familien mit Generalprivileg. Auf der nächsten Stufe standen die 63 „gewöhnlich“ geschützten Juden und ihre Familien. Die dritte Gruppe von privilegierten jüdischen Familien stellten 203 geschützte Juden dar, die weniger Privilegien besaßen als die „gewöhnlich“ geschützten Juden. Insgesamt umfaßten die drei Gruppen von geschützten Familien ungefähr vierhundert Juden. Unterhalb der geschützten Juden standen drei Gruppen von ungeschützten Juden: die Gemeindebediensteten, die „geduldeten“ Juden und die Hausangestellten. Zu den Bediensteten gehörten Rabbiner, koschere Metzger, Friedhofswärter und Religionslehrer, die keine Schutzbriefe besaßen, sondern nur Aufenthaltsgenehmigungen, die nicht auf ihre Kinder übertragbar waren. Die „geduldeten“ Juden waren oft die zweit- und drittgeborenen Kinder der geschützten Juden oder Kinder von Gemeindebediensteten. Die dritte Gruppe ungeschützter Juden bildeten die Hausangestellten. Sie durften nicht heiraten, und ihre Aufenthaltsgenehmigung endete mit ihrer Anstellung. Da die entsprechenden Quellen darüber wenig Auskunft geben, kann man die rechtliche Hierarchisierung der Gemeinde nur schwer mit ihrer ökonomischen Gliederung in Beziehung setzen.
Auch die Struktur der Gemeinde läßt sich wegen der nahezu unüberschaubaren Beschränkungen, die vor allem Eheschließungen und Nachkommenschaft regelten, nur schwer rekonstruieren. Von diesen Beschränkungen waren Altersstruktur, Familiengröße und wahrscheinlich auch das Geschlechterverhältnis stark betroffen. Um die Sozialstruktur der Gemeinde skizzieren zu können, muß man zuallererst die Zahl der männlichen Erwachsenen schätzen, deren wirtschaftliche Aktivität die gesellschaftliche Position der Familien festlegte. Wenn wir davon ausgehen, daß alle männlichen Erwachsenen eine Familie versorgten und die jüdische Familie der Durchschnittsfamilie des 18. Jahrhunderts mit fünf Personen entsprach, dann kann man – bei einer durchschnittlichen Bevölkerungsgröße von 3535 zwischen 1770 und 1779 – mit 700 erwachsenen Männern rechnen. Die beiden veröffentlichten Schätzungen über die Anzahl jüdischer Familien in Berlin liegen etwas niedriger, da sie mehr als fünf Personen pro Familie annehmen. Ein Historiker ging von 600 jüdischen Familien in der Stadt aus, andere von ungefähr 450. Nimmt man die 600 Familien als Basis, dann würden die 300 bis 400 reichen Schutzjuden mit ihren Familien die Hälfte der Gemeinde ausmachen. Geht man von 450 Familien aus, läge ihr Anteil sogar bei zwei Drittel.
Die Entstehung einer solch großen Elite war unvermeidlich, bedenkt man, daß die Zusammensetzung der Juden, die sich in Berlin niederlassen durften, der streng eingehaltenen Vorschrift des Königs entsprach, nämlich möglichst viele wichtige wirtschaftliche Dienstleistungen von möglichst wenigen ortsansässigen Juden ausführen zu lassen. Zur jüdischen Gemeinde in Berlin zählten vergleichsweise viele Finanziers, die die hohen Steuern bezahlen und noch reicher werden konnten. Dementsprechend eng waren die Verflechtungen zwischen den Schutzjuden und den reichen Juden, was nicht erstaunlich ist, da manche „Freiheiten“ nur denen gewährt wurden, die dafür bezahlen konnten.
Im Vergleich mit der Sozialstruktur der nichtjüdischen Bevölkerung gab es in Berlin viele reiche Juden. Die nichtjüdische Oberschicht in Berlin stellte nicht mehr als ein Zehntel der Bevölkerung. Auch im Vergleich mit der Sozialstruktur der preußischen Juden insgesamt war die Elite der jüdischen Gemeinde in Berlin außergewöhnlich groß. Im Jahre 1800 war nur ein winziger Prozentsatz der preußischen Juden Bankiers, Finanziers und Unternehmer. Außerdem war die Oberschicht in anderen deutschen Städten mit reichen jüdischen Gemeinden nirgendwo so groß wie in Berlin. In Hamburg, der größten jüdischen Gemeinde, waren nur sechs Prozent der Gemeinde wohlhabend, in Frankfurt am Main höchstens zehn Prozent. In London, Paris und Amsterdam lebten reiche jüdische Finanziers, aber in keiner dieser drei Städte hatten die reichen Juden eine so starke zahlenmäßige Übermacht innerhalb der Gemeinde wie in Berlin, weil in allen drei Städten der Anteil der armen Juden besonders groß war. Im Osten, im nordwestlichen Teil Polens, das zwischen 1792 und 1807 zu Preußen gehörte, gab es keine großen Städte, und die Mehrzahl der jüdischen Männer dort waren arme Hausierer.
Doch die reichen Juden in Berlin hätten ihre Geschäfte mit Anleihen, Lieferungen, Verkäufen und Investitionen ohne die Hilfe der armen Juden in den kleinen Orten im Osten nicht erfolgreich durchführen können. Wirtschaftshistoriker und auch Antisemiten haben hervorgehoben, daß die Kooperation zwischen den jüdischen Finanziers aus verschiedenen europäischen Hauptstädten eine wichtige Voraussetzung für den damaligen finanziellen Erfolg der Juden war. Selten wurde erwähnt, daß diese internationalen Beziehungen ein integraler Bestandteil der jüdischen Sozialstruktur waren. Pfandleiher, Hausierer, Höker, kleine Geldmakler und Geldverleiher im Osten brachten die abgewerteten Münzen in Umlauf, kauften Rohstoffe und verkauften Waren auf Kommission für die reichen Juden in Berlin. Sie waren dadurch für den wirtschaftlichen Erfolg der Berliner Juden von entscheidender Bedeutung. In Berlin gab es deshalb so viele reiche Juden, weil die preußischen Herrscher vom Handel der reichen jüdischen Finanziers zu profitieren hofften und die armen Juden aus der Stadt fernhielten.
Obwohl es der jüdischen Elite erlaubt war, dem Staat zu dienen, agierte sie doch in einem Klima, das einer finanziellen und industriellen Entwicklung abträglich war. Historiker haben bezweifelt, daß Kaufleute, gleich welchen Glaubens, einen bedeutenden Beitrag zur industriellen Entwicklung Preußens geleistet haben. Dabei muß man in Betracht ziehen, daß die Nöte der Kaufleute vor allem durch Zwänge, die außerhalb ihrer Kontrolle lagen, ausgelöst wurden. Preußen konnte keine Industrie aufbauen, solange das Landwirtschaftssystem feudal und die Standesgrenzen gesetzlich geschützt waren. Ein rigider, den preußischen Verhältnissen schlecht angepaßter Merkantilismus kam erschwerend hinzu. Daß ein schwacher kommerzieller Sektor den kapitalhungrigen Adel häufig mit Handelsgewinnen fütterte, löste einen gefährlichen Kreislauf aus. Der Import von ausländischen Fertigprodukten war verboten, und Investitionen in der heimischen Luxusgüterindustrie galten als schlechte Anlagen. Öffentliche Banken, in denen öffentliche Gelder zirkulieren konnten, gab es nicht. Es war auch nicht ratsam, Bargeld anzuhäufen, weil periodische Geldabwertungen zu einer Dauerinflation führten.
Berliner Kaufleute machten Geld, indem sie Rohstoffe an Handwerker verkauften, die Armee versorgten und Fernhandel betrieben. Aber ihre Gewinne landeten oft in adligen Händen, weil sie illegal adlige Ländereien aufkauften, Pfandbriefe auf adligen Besitz erwarben, verschwenderischen Adligen in der Stadt hohe private Kredite gaben oder eine großzügige Mitgift für ihre Töchter zahlten, wenn diese von Adligen geheiratet wurden.
Trotz dieser eher düsteren Fakten gibt es optimistische Interpretationen hinsichtlich der Rolle der Berliner Kaufleute, ob diese nun Juden waren oder nicht. Eine Einschätzung verlegt sogar die Anfänge der industriellen Revolution in Preußen in diese Ära. Der Handel mit und die Produktion von Gütern für die Armee brachten den französischen und jüdischen Unternehmern während des Siebenjährigen Krieges so große Gewinne, daß Privatbanken aus Handelsunternehmen hervorgingen, die die Kredite und Investitionen organisierten. Die neue, 1803 eröffnete Börse bestätigt, wie notwendig die organisierte und öffentliche Koordination von Investitionen war. Neue Manufakturen wurden gegründet, die Gebrauchsgüter wie Wolle, Kriegsausrüstung, Münzen und Zucker oder Luxusartikel wie Bänder, Samt, Seide und Porzellan herstellten. Auch wenn einige Banken und Luxusgütermanufakturen die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts nicht überlebten, so hinterließen sie doch ein beträchtliches Erbe: qualifizierte Facharbeiter, beschleunigter Warenumschlag, neue Techniken und eine große Kapitalakkumulation. Wie man das institutionelle Klima einschätzen soll, in dem Berliner Kaufleute arbeiteten, hängt davon ab, welchen Stellenwert man der Produktion und Distribution von Luxusgütern für die Entstehung des modernen Kapitalismus einräumt. Jüdische Kaufleute spielten eine zentrale Rolle im Berliner Luxusgüter-Handel; die Hauptabnehmer von Luxusartikeln waren adlige Mitglieder der Hofgesellschaft und reiche Kaufleute. In einer Zeit, in der es riskant war, in Manufakturen zu investieren, war es ökonomisch sinnvoll, Gemälde, Schmuck und Edelsteine zu kaufen. Diese Geldanlage war gerade für Bürger, die auf legalem Wege kein Land erwerben konnten, am sichersten. Natürlich waren nicht alle Berliner Kaufleute Juden. Die meisten erfolgreichen nichtjüdischen Kaufleute kamen aus hugenottischen und slawischen Immigrantenfamilien. Einige nichtjüdische Kaufleute handelten mit Edelmetallen. Doch sie wurden durch keine staatliche Verordnung auf Münzprägung verwiesen, und dadurch fehlte ihnen der Anreiz, sich auf den Fernhandel mit Gold und Silber zu konzentrieren. Der Silberhandel und die Münzprägung spielten eine zentrale Rolle beim ökonomischen Aufstieg Preußens. Die rasche Entwicklung der kommerziellen Wirtschaft in Europa hatte zu einem Silbermangel geführt. Die jüdischen Münzpräger waren zu unverzichtbaren Lieferanten des Metalls geworden. Den nichtjüdischen Kaufleuten fehlten auch die internationalen Beziehungen der Juden, die für den Handel mit Metallen und Münzen wichtig waren. Wenn jüdische Finanziers Familienbanken eröffneten, um die Gewinne aus der Münzprägung und dem Luxushandel zirkulieren zu lassen, dann taten sie der Krone und dem Adel damit einen Dienst. Ihre „privaten“ Banken erfüllten noch bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Funktion in Berlin. Nur wenige nichtjüdische Kaufmannsfamilien gründeten Banken, und die neue königliche Bank verfügte über zu wenig Kapital, um einflußreich zu werden. Im Verlauf des Jahrhunderts gerieten immer mehr Adlige in Geldnot, und folglich stieg von 1770 an die Zahl der Privatkredite, die jüdische Bankiers den verarmten Adligen gewährten. Da die Bankiers und Kaufleute ihre Büros zu Hause hatten und das Vergnügen an Luxusartikeln mit ihren Geschäftspartnern teilten, gestalteten sich die persönlichen Kontakte würdevoller und intimer.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die jüdischen Salons im alten Berlin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.