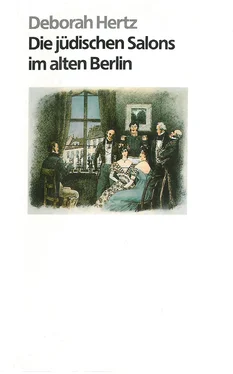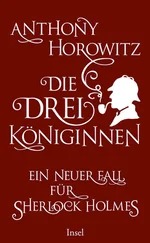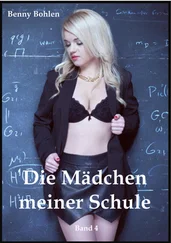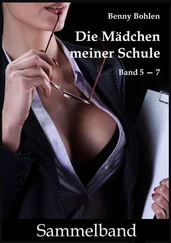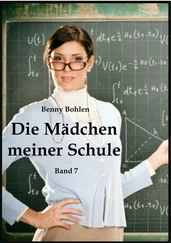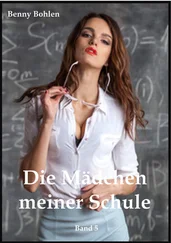Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin
Здесь есть возможность читать онлайн «Deborah Hertz - Die jüdischen Salons im alten Berlin» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die jüdischen Salons im alten Berlin
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die jüdischen Salons im alten Berlin: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die jüdischen Salons im alten Berlin»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die jüdischen Salons im alten Berlin — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die jüdischen Salons im alten Berlin», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ein Jahrhundert früher war es fast undenkbar gewesen, daß mehr Juden als einige ausgewählte Hofjuden mit ihren Familien einen aristokratischen Lebensstil erreichen könnten. Der Pessimismus der Juden in Europa hatte seinen realen Grund, hatte sich doch seit dem Spätmittelalter die Lage des westeuropäischen Judentums drastisch verschlechtert. Im 13. und 14. Jahrhundert waren die Juden aus Frankreich, England, Spanien und Portugal ganz oder teilweise vertrieben und eine Fluchtwelle nach Osten ausgelöst worden. Polen wurde für viele Juden zum Zufluchtsland. Hier konnten sie als Gutsverwalter, als Getreide- und Viehändler sowie als Gastwirte zu Wohlstand gelangen. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Juden war hier stärker auf den Handel beschränkt als in Westeuropa. Da es keine Einwanderungsbeschränkung gab, erlebte Polen einen explosionsartigen Bevölkerungszuwachs.
Die Lage des Mittel- und westeuropäischen Judentums verschlechterte sich im Spätmittelalter, besonders zwischen 1490 und 1570. In allen deutschsprachigen Gebieten häuften sich die Klagen von nichtjüdischen Handwerkern und Kaufleuten darüber, daß das jüdische Geschäftsgebaren ihnen die Lebensgrundlage entziehen oder streitig machen würde. Aber auch wenn Stadträte, Fürsten oder der Kaiser erwogen hätten, die niedergelassenen Juden zu vertreiben oder die Zuwanderung aus dem Westen aufzuhalten: die Dezentralisierung war in den Ländern Mitteleuropas zu stark fortgeschritten, um eine Vertreibung im nationalen Rahmen durchführen zu können. Statt dessen wurde die Verbannung aus großen Städten, wo Handwerker und Händler die jüdische Konkurrenz fürchteten, zum typischen Verfahren in Mitteleuropa. Im 17. Jahrhundert waren deshalb Juden im deutschsprachigen Gebiet über eine größere Zahl von Kleinstädten verstreut als bisher. In den Dörfern dienten sie den Tauschbedürfnissen der ländlichen Umgebung, als Viehhändler, Händler, Hausierer, Geldwechsler, Geldverleiher und Gastwirte. Selten begegnete man ihnen in den Hofstädten. Wenn ein Fürst einen Kredit aufnehmen wollte, dann konnte er sich an die jüdischen Finanziers in den nahegelegenen Handelsstädten wenden oder an den kleinen Kreis von Juden, dem er gestattete, sich in der Nähe des Hofes niederzulassen. Die einzige große Handelsstadt, die eine dauerhafte Ansiedlung von Juden zuließ, war Frankfurt am Main. Aber auch hier drängten örtliche Gesetze die Juden aus dem Handwerksgewerbe hinaus und immer stärker in den Waren- und Geldhandel hinein.
Wo immer damals in Deutschland Juden lebten, wurden sie in der Wahl ihres Berufes und ihres Wohnsitzes stärker beschränkt und höher besteuert als in der Vergangenheit. Das mitteleuropäische Verfahren der örtlichen Verbannung wurde bis ins letzte Drittel des 17. Jahrhunderts angewendet, zuletzt 1670, als die jüdische Gemeinde aus Wien vertrieben wurde. Die Einladung des Großen Kurfürsten an einige der reichsten jüdischen Familien aus Wien, sich in Preußen niederzulassen, hob für Berlin das seit einem Jahrhundert bestehende Ansiedlungsverbot für Juden auf. Fast fünfhundert Jahre lang hatten Juden einst ununterbrochen im Kurfürstentum Brandenburg (der Provinz um Berlin) gelebt. Diese Ära der Toleranz endete im 16. Jahrhundert. 1446,1501 und 1571 kam es zu gewalttätigen Aktionen gegen die Berliner Juden; zwei Juden wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nach dem dritten Gewaltakt wurde die jüdische Gemeinde aus Berlin verbannt.
Friedrich Wilhelms Entscheidung, jüdische Familien aus Wien nach Preußen einzuladen, resultierte nicht aus einer judenfreundlichen Haltung; er und seine Nachfolger teilten einen häufig und heftig zum Ausdruck gebrachten Haß gegen die Juden. Der Kurfürst war aber der festen Überzeugung, daß einige sorgfältig ausgewählte, reiche Juden die Macht Preußens vermehren würden: Die Juden sollten die goldene Gans werden, die goldene Eier legt. Das war eine typisch preußische Entscheidung: Die preußischen Herrscher waren immer bereit, Konventionen über Bord zu werfen, wenn dies den Aufbau eines finanziell starken, militärisch erfolgreichen, autarken Staates förderte. Wie die hugenottischen Handwerker der preußischen Seidenproduktion zur Autarkie verhelfen sollten, so sollten die Wiener Finanziers flüssiges Kapital (und Auslandsbeziehungen) mitbringen, das nötig war, um die Armee auszustatten und zu ernähren, dem Hof Darlehen zu geben, neues Geld zu prägen und altes in Umlauf zu bringen sowie neue Manufakturen zu finanzieren.
Die preußische Entscheidung, so gewagt sie gewesen sein mag, war kein Einzelfall: Wien hieß Juden seit 1675 wieder willkommen. Als sich im 18. Jahrhundert die wirtschaftliche und politische Lage in Polen verschlechterte, setzte eine Auswanderungsbewegung in die entgegengesetzte Richtung ein. Mehr und mehr polnische Juden, darunter einige sehr reiche, suchten eine neue Heimat in den neuen aufstrebenden Staaten, die sich aus ihrem kleinstaatlichen Dasein zu lösen begannen. Einige polnische Juden gingen nach Preußen, und manche hatten das Glück, sich in Berlin niederlassen zu dürfen.
Berlin bot qualifizierten Juden viele Möglichkeiten. Es war die einzige deutsche Hofstadt, wo sich eine jüdische Gemeinde von beachtlicher Größe bilden durfte. Es gab dort kein ausgewiesenes Getto, die Wohnbeschränkungen waren minimal, und die wohlhabendsten Juden lebten im elegantesten Viertel der Stadt. Zudem entwickelte sich Berlin zum Zentrum des regionalen und überregionalen Handels und der Textilproduktion sowie zum Sammelort für Gebildete und Verleger. Nach und nach wurde ausgewählten Mitgliedern der jüdischen Gemeinde gestattet, was den meisten europäischen Juden im 18. Jahrhundert verwehrt worden war. Als Gegenleistung für ihre finanziellen Verdienste räumte Berlin einer kleinen Gruppe von Juden die Möglichkeit ein, enorme Geldmengen zu erwerben – die notwendige materielle Voraussetzung für ihre kulturelle und gesellschaftliche Integration.
Wegen dieser besonderen Möglichkeiten in Berlin hatten weitaus mehr Juden den Wunsch, dort zu leben, als zugelassen wurden. Auch in Berlin waren Juden Repressionen ausgesetzt; doch den Zeitgenossen stellte sich das anders dar. Zu einer Zeit und an einem Ort, wo jeder Untertan und nicht freier Bürger war, war der Grad der Repression schwierig zu ermessen. Es lag im Wesen einer Ständegesellschaft, daß religiöse und soziale Gemeinschaften verschieden hoch besteuert wurden und ihre Mitglieder nur in bestimmten Berufen arbeiten durften. Mit Gesetzeskraft wurde dies durchgesetzt. In diesem Kontext gesehen, war die Tatsache als solche, daß im 18. Jahrhundert in Preußen bestimmte Regeln und Verfahren für die jüdische Gemeinde entwickelt wurden, kein Ausdruck einer Diskriminierung. Auch die französischen und die böhmischen Kolonien waren spezifischen Bestimmungen unterworfen. Doch waren die Vorschriften, die Steuerbelastung und die beruflichen Beschränkungen, die der jüdischen Gemeinde auferlegt wurden, in besonderem Maße drückend. Im Vergleich mit anderen Ständen, die ähnliche Absprachen mit der Krone hatten, zahlte die jüdische Gemeinde viel höhere Abgaben für das grundlegendste aller Rechte, nämlich vom König vor Verfolgung geschützt zu werden.
Die Situation der jüdischen Gemeinde war äußerst „anormal“. Die reichen Berliner Juden waren als Gruppe zu groß, um als Hofjuden bezeichnet zu werden. Doch teilten sie mit ihren Vorgängern im 17. Jahrhundert das Los der „mächtigen Sklaven“. Einige Berliner Juden gehörten zu den reichsten Männern Mitteleuropas. Wenn sie aber nicht das Glück hatten, von den gesetzlichen Vorschriften befreit zu werden, durften sie Berlin nur durch ein einziges Tor passieren, wo sie zudem noch Zoll bezahlen mußten. Moses Mendelssohn empfing seine berühmten Gäste unter den Augen von zwanzig Porzellanaffen: Sein intellektueller Ruhm hatte ihn nicht von der Zwangsabnahme dieser Affen aus der angeschlagenen Luxuswarenindustrie Friedrichs des Großen befreien können. Diese Affen waren so überbezahlt, daß man sie nicht weiterverkaufen konnte; sie waren ein Symbol für die privilegierte Machtlosigkeit der Gemeinde. Als mächtige Sklaven konnten die Berliner Juden aus ihrer „anormalen“ Lage nur dadurch Vorteile ziehen, daß sie ihresgleichen überwachten. Gemeindeälteste suchten regelmäßig den Gasthof außerhalb der Stadttore auf und entschieden, welche wandernden Juden in die Stadt einziehen durften und für wie lange. Aber bevor ein Jude ein „mächtiger Sklave“ werden konnte und als solcher dienen durfte, mußte das erste Hindernis überwunden werden, nämlich ein Niederlassungsrecht für Preußen zu erhalten. Das wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts immer schwieriger. Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) und Friedrich der Große beschränkten die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Juden nach und nach und erhöhten die Steuern für die jüdische Gemeinde erheblich. Ab 1730 war es Juden in Preußen verboten, Kleinhandel zu betreiben, und schließlich wurde ihr möglicher Tätigkeitsbereich auf den Fernhandel mit Luxusgütern, auf die Heeresausstattung und die Münzprägung eingeschränkt. Die königliche Verordnung von 1750 führte zu weiteren Einschränkungen des jüdischen Lebens: Nur noch ein Sohn durfte sich in Preußen niederlassen, und der Handel wurde noch mehr begrenzt. Diese Reglementierungen hatten eine Konzentration der jüdischen Aktivitäten zur Folge und verschafften den Juden Vorteile über die nichtjüdischen Kaufleute. Juden durften neue Waren, wie Schokolade und Kaffee, importieren, was nichtjüdischen Kaufleuten verboten war, und sich im Außenhandel betätigen, wo sie Kontakte besaßen, von denen nichtjüdische Kaufleute ausgeschlossen waren. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß viele Rechte in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts verlorengingen, aber es gab dafür entschädigende Regelungen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die jüdischen Salons im alten Berlin» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die jüdischen Salons im alten Berlin» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.