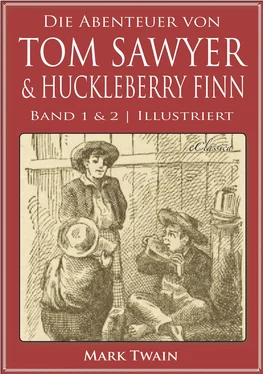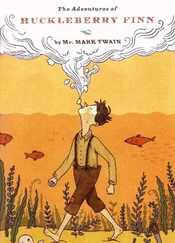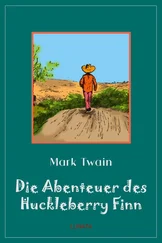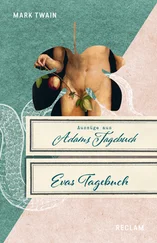1 ...7 8 9 11 12 13 ...28 »Doch, natürlich, das muss ich. Stöhn’ doch nicht so, Tom, das ist ja schrecklich. Wie lang tut dir’s denn schon weh?«
»Ach, stundenlang. Autsch, autsch! Sei doch still, Sid, und lass mich in Ruhe.«
»Warum hast du mich denn nicht früher geweckt? Herr Gott, Tom, hör’ auf, es macht einen ja elend, dich so stöhnen zu hören. Wo tut dir’s denn weh?«
»Ich verzeih’ dir alles, Sid, was du mir je getan hast, (Stöhnen.) Alles, alles, Sid! Wenn ich tot bin –«
»O, Tom, du wirst doch nicht sterben? Sag nein, Tom, komm, sag nein. Vielleicht –«
»Ich vergebe allen Menschen, Sid. (Tiefes Stöhnen.) Sag’s allen. Und, Sid, gib du die schöne gelbe Türklinke, die ich habe, und die einäugige Katze dem Mädchen, das neulich erst gekommen ist und sag ihr –«
Aber Sid hatte schon seine Kleider aufgerafft und war verschwunden. Tom litt nun in Wahrheit, so lebhaft arbeitete seine Einbildungskraft und sein Stöhnen fing an erschreckend natürlich zu klingen.
Sid flog die Treppe hinunter und rief atemlos:
»Tante Polly, Tante Polly, komm schnell, Tom stirbt!«
»Stirbt?«
»Ja, ja, eil’ dich doch, frag’ nicht lang.«
»Dummheiten! Ich glaub’s nicht.«
Trotzdem aber stürzte sie die Treppe hinauf, so schnell sie ihre alten Beine tragen wollten und Mary hinter ihr her. Blass war auch sie geworden und ihre Lippen zitterten. Am Bett angelangt, keuchte sie nur so:
»Tom, Tom, was gibt’s, was ist los?«
»Ach, Tante, ich –«
»Was gibt’s – was ist’s, Kind, was fehlt dir?«
»Ach, Tante, ich – ich hab’ furchtbare Schmerzen da an meiner Zehe, – ich hab’ – ja ich hab’, glaub’ ich – den kalten Brand!«
Erleichtert aufseufzend sank jetzt die arme Tante auf einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, tat dann beides zusammen, was sie wieder so weit herstellte, dass sie Worte fand:
»Tom, Bengel, wie hast du mich erschreckt! Jetzt hör’ aber auf mit dem Unsinn und mach’, dass du aus dem Bett kommst. Es ist Zeit zum Aufstehen! Vorwärts – oder ich geb’ dir was, um deinen kalten Brand zu wärmen!«
Das Stöhnen hörte auf und der Schmerz verschwand aus der Zehe. Kleinlaut und niedergedrückt ob des verunglückten Experiments meinte der Junge:
»Tante, wahrhaftig, ich glaubte, es müsse der kalte Brand sein, es tat so furchtbar weh, dass ich gar nicht mehr an meinen Zahn dachte.«
»An deinen Zahn? Was ist denn mit dem Zahn los?«
»Ach, der wackelt und tut gar schrecklich weh.«
»Na, na, nur nicht wieder stöhnen, ist ganz unnötig! Mund auf! Ja, der wackelt richtig, daran stirbst du aber noch lange nicht! Mary, gib mir einen Seidenfaden und hol’ ein Stück glühende Kohle aus der Küche!«
Eiligst rief Tom, der plötzlich ganz munter wurde: »Bitte, bitte, Tantchen, zieh’ ihn mir nicht aus, er tut schon gar nicht mehr weh. Ei, ich will des Todes sein, wenn ich noch das geringste spüre! Bitte, bitte, nicht, Tantchen, ich will ja doch wahrhaftig nicht zu Hause und von der Schule wegbleiben.«
»So, du willst nicht zu Hause bleiben, mein Junge, willst durchaus nicht, was? Also deshalb all der Lärm! Wärst wohl gern aus der Schule geblieben und dafür fischen gegangen, gelt? Na, ich kenn’ dich, Tom, durch und durch, mir machst du keine Flausen vor, du Bengel! Tom, Tom, und ich hab’ dich doch so lieb und du, – du denkst nur dran, wie du deiner alten Tante das Herz brechen kannst. Geh, schäm’ dich in deine schwarze Seele hinein!«
Mittlerweile waren die zahnärztlichen Instrumente zur Stelle geschafft worden. Ein Ende des Seidenfadens befestigte die Tante mit einer Schlinge an Toms Zahn, während sie das andere um den Bettpfosten schlang, so dass der Faden straff angespannt war. Dann ergriff sie mit einer Zange die glühende Kohle und fuhr damit geschwind auf Toms Gesicht los. Ein Ruck – und der Zahn hing baumelnd am Bettpfosten.
Wie aber jede überstandene Prüfung ihren Lohn in sich trägt, so auch diese. Als sich Tom später mit der neuerworbenen Zahnlücke auf der Straße zeigte, war er ein Gegenstand des Neides für alle Kameraden, denn keiner von ihnen war imstande, auf solch neue, noch nie da gewesene Weise auszuspucken, wie es nun Tom, durch die Lücke in der Zahnreihe, tat. Er zog ein ganzes Gefolge von Bewunderern hinter sich her, die sich für die Schaustellung interessierten, und ein anderer Junge, der bis dahin, wegen eines verletzten Fingers, der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen, sah sich plötzlich all seines Ruhmes beraubt, er musste ohne Erbarmen dem neu aufstrahlenden Gestirne weichen und zurücktreten in den Schatten des Nichts. Sein Herz war ihm drob schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die ihm fern lag, meinte er: das sei auch was Rechtes, so auszuspucken, wie Tom Sawyer. Da schallte ihm ein höhnendes: saure Trauben, saure Trauben! entgegen und beschämt schlich er zur Seite, ein entthronter Held.
Auf dem Wege zur Schule traf Tom den jugendlichen Paria des Ortes, Huckleberry Finn, den Sohn des bekanntesten Stadt-Trunkenboldes. Huckleberry war der Gegenstand des Abscheus und Hasses aller Mütter der Stadt, die ihn fürchteten wie die Pest, weil er faul und zuchtlos, roh und böse war, wie sie dachten, und weil – ihre eigenen Jungen ihn anstaunten und vergötterten, sich förmlich um seine verbotene Gesellschaft rissen und alles drum gegeben haben würden, wenn sie hätten sein dürfen, wie er. Tom, wie alle die anderen »ordentlichen, anständigen Jungen«, beneidete Huckleberry um seine verlockende Existenz, und es war ihm streng untersagt worden, je mit dem »schlechten Kerl« zu spielen. Gerade darum tat er es denn auch gewissenhaft, wenn sich nur irgend Gelegenheit dazu fand – und tat es mit Wonne, Huckleberry steckte immer in alten, abgelegten Kleidern von Erwachsenen, deren Fetzen und Lumpen nur so um ihn herumhingen. Sein Hut war nur die Ruine einer vormaligen Kopfbedeckung, deren Rand zerfetzt auf die Schultern niederbaumelte. Sein Rock, wenn er überhaupt einen trug, hing ihm bis auf die Füße und zeigte die hinteren Knöpfe etwa in der Gegend der Kniekehlen. Nur ein Träger hielt seine Hose an Ort und Stelle, Hosen, deren geräumige Sitzpartie zu leer war und sich nur zuweilen im Winde blähte, während die ausgefransten Enden im Schmutz nachschleiften, wenn sie nicht zufällig aufgekrempelt waren. Huckleberry kam und ging, wie es ihm beliebte. Bei schönem Wetter schlief er auf Treppenstufen oder sonst wo, bei schlechtem in leeren Fässern, alten Kisten, oder wo er eben unterkriechen konnte, wählerisch war er keineswegs. Er brauchte nicht zur Schule, nicht zur Kirche, brauchte niemanden als Herrn anzuerkennen, brauchte keiner lebenden Seele zu gehorchen. Er konnte schwimmen und fischen gehen, wann und wo er wollte, konnte bleiben, solang’ es ihm behagte. Niemand verbot ihm, sich mit anderen zu prügeln, und abends konnte er aufbleiben bis Mitternacht und länger, ihn zankte keiner. Er war der erste, der barfuss lief im Frühling und der letzte, der im Herbste wieder in das lästige Leder kroch. Zu waschen brauchte er sich nie, zu kämmen auch nicht, noch frische Wäsche anzuziehen, und fluchen konnte er wie ein Alter, wundervoll. Mit einem Wort, alles, alles, was das Leben schön und angenehm macht, besaß dieser beneidete Huckleberry im reichsten Maße. So dachte und fühlte jeder einzelne der armen, geplagten, »anständigen« Jungen in St. Petersburg. Tom rief also natürlich diesen für ihn romantischsten aller Helden sofort an:
»Holla, Huckleberry!«
»Holla, du selber!«
»Was hast du da?«
»Tote Katze.«
»Zeig her, Huck. Herrgott, wie steif! Woher hast du’s?«
»Gekauft von ‘nem Jungen.«
»Was hast du dafür gegeben?«
»’ne Schweinsblase und ‘nen blauen Zettel.«
»Woher war denn der blaue Zettel?«
Читать дальше