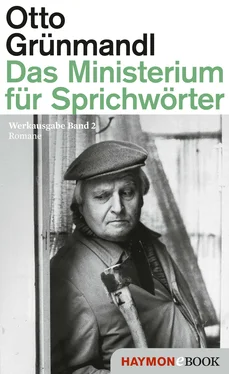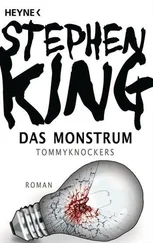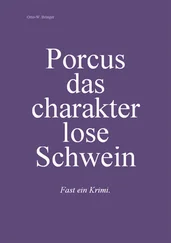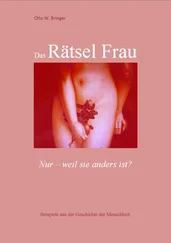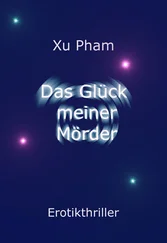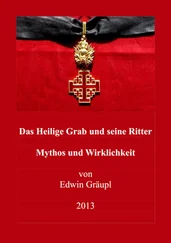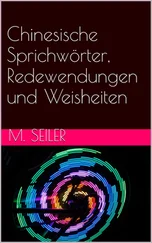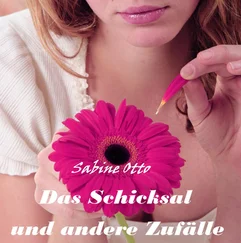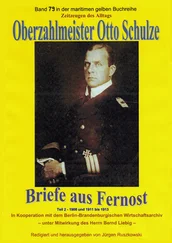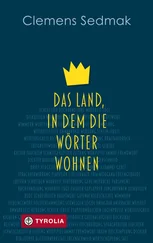Der Lärm störte ihn weiter nicht, und auf den Vorhang sah er eigentlich nur deshalb hin, weil er ihm gerade vor seiner kleinen, spitzen Nase hing.
Dieser Vorhang übrigens hatte seine eigene Geschichte. Der Chef erstand ihn, alt und schäbig, bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung der „Städtischen Bühnen“. Man lasse sich nicht täuschen. Die „Städtischen Bühnen“ bestanden schon damals nur mehr aus einem Theatersaal, der die meiste Zeit unbenützt blieb und nur einige Male im Jahr an reisende Truppen vermietet wurde. Da diese reisenden Truppen immer nur artistische Darbietungen brachten, entschloß man sich, den solcherart nicht mehr benötigten Bühnenvorhang zu versteigern. Zum Wohle der Stadtarmen, versteht sich, nach Deckung der Unkosten, versteht sich. Der Chef bekam den Vorhang zum Nennpreis, es hatte sich für dieses schwerhandliche Ungetüm, wie leicht vorauszusehen war, auch nicht ein Steigerer gefunden. Er ließ ihn chemisch reinigen, und da er für seine Zwecke viel zu groß war, vierteilte er ihn. Von den so entstandenen vier Vorhängen behielt er einen für sich, zu dem bereits bekannten Zweck, das Büro vom Verkaufsraum abzuschließen. Den zweiten gab er in einem Anfall von Großzügigkeit der Pfarrgemeinde, der er schon seit längerer Zeit seinen Pflichtbeitrag schuldete. Der Pfarrer bestimmte den Vorhang nach kurzer Beratung mit den engeren Mitgliedern des erweiterten Kirchenausschusses als Sakristeivorhang. Den dritten verkaufte er einem Kaffeehaus, wo er vor den Eingang zum Spielzimmer gehängt wurde. Den vierten und letzten schließlich bekam der Leichenbestatter eines Nachbardorfes, der bei Begräbnissen erster Klasse die Särge damit drapierte.
Dies alles war Pizarrini genauestens bekannt, denn der Vorhang wurde als Geschäftsfall behandelt und als solcher mit allem Drum und Dran vom chemischen Reinigen bis zum Einsäumen der Teilvorhänge und deren Weiterveräußerung genauestens gebucht.
Dies alles hätte ihn jedoch noch keineswegs zu jenen Betrachtungen verleiten können, als deren in die Tat umgesetzte Konsequenz das am Ende dieses Kapitels berichtete Abenteuer zu verstehen ist, wäre nicht hinzugekommen, daß er als nächste Buchung die sehr verspätete Zahlung jenes ländlichen Leichenbestatters vorzunehmen gehabt hätte, der den letzten Teil des Vorhangs erstanden hatte. So aber blickte Pizarrini mit kritischem Buchhalterauge von der Kopie der dem Leichenbestatter ausgestellten Quittung langsam auf und richtete seinen Blick erneut auf den verwaschenen Stoff hin; damit nahmen die Betrachtungen und im weiteren auch die Dinge ihren Lauf.
Daß dieser Mann, der Leichenbestatter nämlich, der doch bestimmt ein sehr sicheres, umsatzmäßig leicht voraussehbares Geschäft betrieb, daß ausgerechnet der sich erst nach einer dritten, zwar korrekten, aber doch sehr scharf gehaltenen Mahnung herbeiließ, die längst fällige Schuld zu begleichen, das ärgerte Pizarrini, ja erbitterte ihn geradezu. Und er, weiß der Himmel, er hätte dem Mann die höchsten Verzugszinsen gerechnet, die gesetzlich noch überhaupt möglich gewesen wären.
Aber der Chef hatte dazu „nein“ gesagt mit der lächerlichen Begründung, einem Leichenbestatter rechnet man keine Verzugszinsen. Blödsinniger Aberglaube, wem denn sonst, wenn nicht einem Leichenbestatter? Immerhin, der Vorhang, das heißt jener Teil, der bei dem Leichenbestatter gelandet war, machte sich gut. Er hatte es selbst gesehen. Bei einem der ersten vergeblichen Inkassoversuche hatte er es gesehen.
„Sie werden es nicht glauben“, hatte er damals zu seinem Chef gesagt, „wie düster und feierlich das aussah. Der bläßlichrote, irgendwie schon jenseitig schimmernde, auf den nackten Steinboden gebreitete Samt und darauf nichts als ein einsamer schwarzer Sarg. Ob Sie es glauben oder nicht, das hat mich gepackt.“
„Ich glaube es Ihnen“, hatte der Chef geantwortet und anerkennend hinzugefügt, „aber sehen Sie, Pizarrini, so etwas, das merkt eben nicht jeder. Dafür muß man ein Gefühl haben, eine gewisse humanistische Bildung. Die haben Sie, die habe ich, aber jeder hat sie nicht.“ Und genau das mußte er auch jetzt denken: Das merkt eben nicht jeder, und jeder denkt auch nicht über einen alten, ausgedienten und doch noch weiterverwendeten Bühnenvorhang nach, so wie er dies jetzt tat.
Ach, Theater, dachte er, Theater, und biß, wie jeden Tag Punkt zehn Uhr vormittags, in eine Käsesemmel. Es gehörte zu seiner Tagesordnung, um zehn Uhr vormittags eine Käsesemmel zu verzehren.
Theater, dachte er geringschätzig, davon scheint dieser Vorhang nicht loszukommen. Theater ist auch, was die da draußen treiben, Theater und Mummenschanz, die Wirklichkeit ist hier bei mir herinnen.
Beruhigt blickte er auf seine Bücher, in denen alles verzeichnet war, worum die da draußen, hinter dem Vorhang, ihr Theater trieben.
Und wie zur Bestätigung seiner Gedanken kam auch schon einer der Verkäufer herein und fragte nach der Restschuld der Krescentia Haferle, die dieselbe jetzt begleichen wolle.
„Einen Moment“, sagte Pizarrini, „das werden wir gleich haben.“
Krescentia Haferle stand in den Kundenkonti unter H10 und wies eine Restschuld von Kronen 142,37/100 auf.
Der Verkäufer ging hinaus, und Pizarrini sinnierte weiter.
Gut, über den Vorhangteil, der die Sakristei vom sakralen Raum trennte, wollte er sich kein Urteil erlauben. Was aber das Spielzimmer in jenem Kaffeehaus betraf, so war das ganz bestimmt Theater, denn er hatte darin noch nie jemanden spielen, wohl aber ein verdrecktes Fahrrad und sonstiges altes Gerümpel stehen gesehen. Ach, das ist alles Theater, dachte er, Theater und Großtuerei. Das einzige, was ihm frei von Theater schien, war der Verwendungszweck, dem der Leichenbestatter seinen Vorhangteil zugeführt hatte. Ein Leichenbestattungsunternehmen, das schien ihm das reellste Geschäft von allen, und er bedachte immer wieder, daß man eigentlich im Leben eines Menschen mit nichts so sicher rechnen könne als mit der Tatsache, daß er sterben werde. Diese unumstößliche Tatsache zur Grundlage eines Geschäftes gemacht zu haben, hielt er für die genialste Idee, die ein kaufmännisch veranlagtes Gehirn je hervorgebracht hatte. Auf der Suche nach Dingen, die im menschlichen Leben eine ähnliche, unausbleibliche Rolle spielten wie der Tod, kam er im Anschauen seiner noch nicht zu Ende gegessenen Käsesemmel zunächst auf das Essen und dann in schneller Reihenfolge auf das Schlafen, Kranksein und sodann merkwürdigerweise ohne weitere Zwischenstation auf die „Weiber“. (Mit welch etwas rüdem Ausdruck sich ihm unbewußt natürlich ein ganzer Komplex von „damit“ Zusammenhängendem verband.) ‚Merkwürdigerweise‘ deshalb, weil er wahrscheinlich seiner Jugend wegen gewissen vorgefaßten Meinungen zur Stunde noch immer so stark unterworfen war, daß er bisher noch nie etwas „damit“ zu tun gehabt hatte. Warum, fragte er sich, einer plötzlichen Eingebung folgend, warum soll dieses Zusammentreffen der Geschlechter gar so sicher und unausbleiblich sein? Die Antwort, die er sich im selben Atemzug darauf gab, war zwar sehr simpel, hatte aber für ihn die größte Überzeugungskraft, die eine Antwort haben konnte. Ganz einfach deshalb, sagte er sich, weil sich das nun einmal so gehört. Und er beschloß bei sich, nachzuholen, was versäumt zu haben, würde er jetzt vom Tode ereilt werden – was völlig von der Hand zu weisen, vermessen erschien –, ihm zweifellos als Manko angerechnet werden würde.
Nachdem er diesen Entschluß gefaßt hatte, beugte er sich wieder über seine Arbeit, als hätte er nur eben seine alltägliche Käsesemmel gegessen und nicht auch einen ungewöhnlichen Entschluß gefaßt.
Die Bordellwirtin sah – was Wunder, jeder Beruf färbt eben auf seine Leute ab – wie eine Bordellwirtin aus oder, besser, wie man sich eine solche vorstellt.
Читать дальше