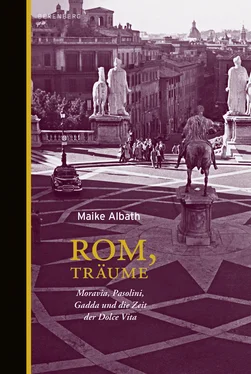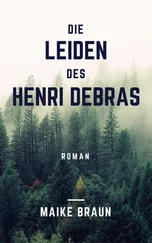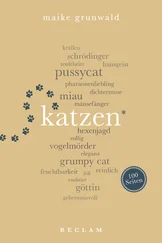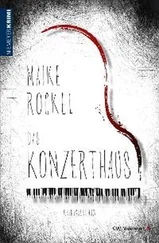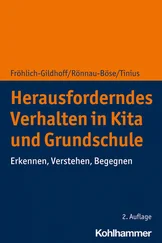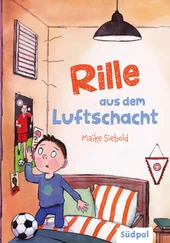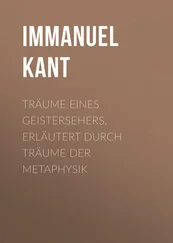»Es waren keine festen Vereinbarungen, doch jeder wusste, dass man in den Cafés und Restaurants an der Piazza del Popolo oder auf der Via Veneto immer jemandem über den Weg lief«, erzählt auch Dacia Maraini. »In der Bar Rosati zum Beispiel traf man Elsa Morante, Pasolini, Calvino, Bassani, Flaiano und Fellini, der in der Via Margutta wohnte, aber auch Luchino Visconti, den Maler Guttuso und andere bildende Künstler. Man aß gemeinsam, jeder bezahlte für sich. Es gab Diskussionen, die sich stundenlang hinzogen, manchmal stritten wir auch, aber es war wunderbar, weil man so ungezwungen zusammenkam. Das gibt es heute nicht mehr. Im Rosati sitzen nur noch Touristen herum und in unseren alten Restaurants auch.« Dacia Maraini erzählt von Weihnachtsabenden mit Moravia, zu denen auch Elsa Morante eingeladen wurde, von gemeinsamen Spielen, für die sie sehr viel übrig hatte. Ratespiele, bei denen man Schriftsteller oder Filme erriet. Morante sei im Zeichen des Löwen geboren und eine sehr extrovertierte Frau gewesen, ungeheuer selbstsicher. »Einmal hat man ihr einen wichtigen Literaturpreis verliehen, den sie nicht persönlich entgegennehmen konnte. Vorher sagte sie einem Journalisten: ›Ich bedanke mich bei allen, die für mich gestimmt haben, und denen, die gegen mich gestimmt haben, verzeihe ich.‹ Sie war sehr schlagfertig und einfallsreich.« Moravia habe ihr immer wieder von den Erfahrungen mit seiner Ex-Frau berichtet und von ihrer Manie, um jeden Preis die Wahrheit sagen zu wollen, selbst Freunden gegenüber, während er eine diplomatische Haltung vorzog. Trotz seiner Warnung habe sie einem befreundeten Dichter ins Gesicht gesagt, wie schrecklich seine Texte seien, und sich dann gewundert, dass der Mann beleidigt abzog. Auch Pier Paolo Pasolini gehörte zu den Besuchern im Rosati. Mit ihm und Alberto Moravia unternahm Dacia Maraini zahlreiche Reisen nach Afrika, Indien und Persien. »Pasolini war bei den gemeinsamen Treffen eher still und verschlossen. Ein Einzelgänger, kein großer Plauderer. Aber er kam immer und genoss die Gesellschaft seiner Freunde. Er hatte viel im Kopf und sprach nur, wenn es um ethische, politische oder ästhetische Fragen ging, da hatte er ganz bestimmte Ansichten. Sonst hörte er lieber zu. Pasolini hing wahnsinnig an seiner Mutter. Das war auffallend.« Dacia Maraini empfiehlt mir noch einige Spaziergänge zu den einschlägigen Orten von damals, dann kehrt sie zurück an den Schreibtisch. Auf dem Rückweg mache ich einen Schlenker zur Bar Rosati an der Piazza del Popolo. Beflissene Kellner mit langen Schürzen, ein herausgeputztes Interieur, ein paar Gäste. Es stimmt – nur Touristen.
Auch deutsche Künstler und Intellektuelle waren seit den fünfziger Jahren von der Atmosphäre Roms angezogen. Die Stadt bot, ähnlich wie für die amerikanischen Schauspieler, die richtige Mischung aus Geschichte und Gegenwart. Kein Vergleich mit den Verheerungen in Berlin, Köln oder München. Ingeborg Bachmann ließ sich 1956 an der Piazza della Quercia nieder, freundete sich mit Prinzessin Caetani an, einer Amerikanerin, die in den römischen Adel eingeheiratet hatte und die Zeitschrift Botteghe Oscure herausgab. Ihr Salon war ein intellektueller Umschlagplatz der Stadt. Die deutschen Besucher waren beeindruckt von der großen Selbstverständlichkeit, mit der sich die unterschiedlichsten Gruppen mischten. Sie trugen sicherlich zur Mythisierung bei, dennoch unterstreichen ihre Beobachtungen die Eigenarten der italienischen Kultur. Mitte der sechziger Jahre schilderte Alfred Andersch, der Italien aus der Kriegszeit und Gefangenschaft kannte – schließlich war er hier aus der Wehrmacht desertiert – die Besucher des Café Rosati. Er beobachtet, wie sich Alberto Moravia nähert, hager und kerzengerade. Der »demokratischste Schriftsteller Italiens« sehe aus »wie ein preußischer Offizier«, wundert er sich. »Er betritt das Rosati, alle Blicke wenden sich ihm zu, der Kommandeur ist eingetreten, aber nimmt von niemandem Notiz, sondern geht sofort auf Pier Paolo Pasolini zu, lässt sich an seinem Tisch nieder, entspannt sich im Gespräch mit dem jungen Bandenführer, den er wohl als seinen Lieblingsschüler betrachten muss, als den Dichter, in dem sein Geist und sein Stil gänzlich verwandelt Schule gemacht haben. Moravia ist streng, während Pasolini scharf ist, ein scharfer böser Junge mit einem kleinen braunen Gesicht hinter einer schwarzen Hornbrille, ein junger Uhu, ein nächtlicher Raubvogel, in allen Künsten des Erschreckens geübt. (…) Der wilde Pasolini ist alles Mögliche zwischen Anarchie, Liberalität und Kommunismus, aber Katholik, Christ oder auch nur Häretiker ist er nicht. Vor allem ist er Pasolini, der junge Mann aus den Slums, den borgate, doch auch er hält Überraschungen bereit, wenn er in der Buchhandlung Einaudi Gaddas Erkenntnis des Schmerzes vorstellt, nicht das ganze Buch, sondern nur einen einzigen Satz, der ihm Gelegenheit bietet, vollendetes ästhetisches Raffinement mit leiser Stimme auszuspielen. Fast deutsche Dichtungsinterpretation verband sich da mit römischer Intellektualität – es war ein Genuss, wenn auch schwer zu verstehen. Verstand ihn Carlo Emilio Gadda, der weißhaarig, groß und schwer dem Opfer beiwohnte, das man ihm zelebrierte? Ich nehme das Epitheton schwer sogleich zurück, denn Gaddas Schwere hat etwas Durchscheinendes, Geistiges, der große abgerundete Mann – nichts Eckiges ist an seinem Körper – strahlt einsame Heiterkeit und nüchterne Harmonie aus. Der frühere mailändische Ingenieur und Wahlrömer wird als der letzte und große Bürger der italienischen Literatur verehrt, wie ich an jenem Nachmittag vernahm. Eigensinnig und geistvoll wies Moravia nach, dass ein General bei Gadda ganz ohne Frage ein General sei; das General-Sein eines Generals werde von Gadda immer als Prämisse hingenommen, niemals infrage gestellt. Eine originelle These, die lebhaft beklatscht wurde. Mir scheint die Rechnung nicht völlig aufzugehen. Ohne Zweifel bietet Gadda als Mensch einen angenehmen bürgerlichen Anblick. Aber seine Sprache ist nicht bürgerlich, sie ist die Sprache eines Künstlers. Was er mit der Sprache treibt, das sind recht unbürgerliche Künste. Barock und konzentriert zugleich, treibt er seine Figuren mithilfe seiner Sprache – und mit ihr allein – aus dem Zustand heraus, der ihnen vorgegeben ist. Freilich ist er ein seltener Gast der literarischen Nachmittage in der Via Veneto, und man denkt sich ihn lieber auf Spaziergängen in den Gärten von Rom. – Doch schien es mir des Aufschreibens wert, wie sich in einem der letzten literarischen Paradiese dieser Erde die großen Kollegen ohne Neid voreinander verbeugen.«
Das stimmungsreiche Feuilleton sagt natürlich nicht nur etwas über Italien aus, sondern ebenso viel über Andersch und die deutschen Projektionen. Seine Schilderung ist von einer großen Sehnsucht durchdrungen, einer Sehnsucht nach anderen Umgangsformen, nach etwas südlich Ungezwungenem, aber auch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe, in der jeder seinen Platz hat und gleichzeitig Vielfalt herrscht. Besonders zu beeindrucken scheint ihn die Zugewandtheit und der tolerante Umgang mit den ästhetischen Vorstellungen des jeweils anderen. Andersch erkennt den sehr eigenen Charakter der Freundschaft von Moravia und Pasolini, die von großem Respekt getragen war. Er nennt Moravia einen »demokratischen« Schriftsteller, vermutlich weil er in seinen Römischen Erzählungen einfache Leute von der Straße porträtierte und hohe Auflagen erzielte. Großbürgerlicher und stärker der Jahrhundertwende verhaftet könnte der Werdegang eines Autors allerdings kaum sein: mit emblematischen Stationen im Sanatorium und der Initiation im Bordell. Aber früher als in der Bundesrepublik bekleidete der Schriftsteller in Italien ein öffentliches Amt. Moravia galt als Institution. Er war damals der Einzige unter seinen Kollegen, der Weltruhm erlangt hatte, Gaddas internationale Entdeckung stand noch bevor, Pasolinis Erfolg auf europäischer Ebene setzte gerade erst ein. Während Elsa Morante eine militante Subjektivität pflegte und unbeirrbar an ihren Romanen schrieb, trat Moravia stärker als Erzieher in Aktion. Er äußerte sich, schrieb Kritiken, hatte zu allem eine Meinung. An Pasolini bewundert Andersch dessen analytisches Vermögen, das offenkundig weniger abgekoppelt wirkte von sinnlichen Empfindungen, als er es von deutschen Intellektuellen kannte. Allerdings war Pasolini mitnichten Moravias Schüler, schon gar kein Bandenführer oder Slumbewohner. Der Kirche als Institution mag er skeptisch gegenübergestanden haben, was aber nichts an seiner Religiosität änderte – immer wieder treibt ihn die Suche nach Restbeständen des Heiligen um. Zum Ärger vieler Freunde – auch Dacia Maraini war empört – sprach er sich gegen Abtreibung und für traditionelle Familienstrukturen aus. Zwischen den italienischen Schriftstellern kam es häufig zu erbitterten Diskussionen, man ging streng miteinander ins Gericht, ohne zu brechen. Es war eine Generation, die unter den Faschisten Propaganda und Scharfmacherei erlebt hatte und großen Wert auf Ehrlichkeit legte.
Читать дальше