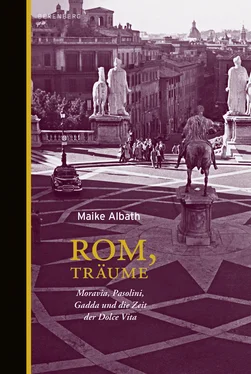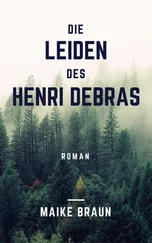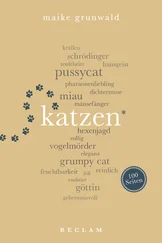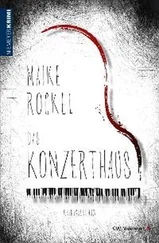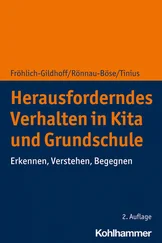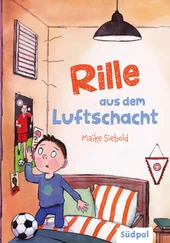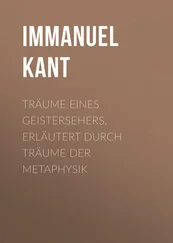Maike Albath - Rom, Träume
Здесь есть возможность читать онлайн «Maike Albath - Rom, Träume» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Rom, Träume
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Rom, Träume: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Rom, Träume»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Rom, Träume — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Rom, Träume», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
In den folgenden Jahrzehnten variierte Moravia seine großen Themen und passte sie an aktuelle Phänomene an, ohne die Intensität seines Frühwerkes zu erreichen. Ihm fiel das Schreiben mitunter zu leicht, er klimperte auf der Schreibmaschine wie ein Pianist bei Fingerübungen. Nachdem er Ende der fünfziger Jahre das Sommerloch der Zeitungen durch neue Römische Erzählungen gefüllt hatte, lief er eines Abends Italo Calvino über den Weg. »Kannst du es immer noch nicht bleiben lassen?«, fragte ihn der Schriftstellerkollege und traf damit einen wunden Punkt. Ein Automatismus hatte sich eingeschliffen, Moravia produzierte Literatur in Serie. Hatten Die Gleichgültigen und Agostino ihre Kraft aus dem untergründigen Beschwören der Sexualität bezogen, verfiel Moravia nach und nach einem quälenden Beschreibungszwang und listete wie ein Buchhalter in Verführungsszenen die Details auf. Seine Abrechnung mit den entleerten Formeln bürgerlichen Wohlverhaltens und die Entlarvung des Trieblebens entwickelten eine merkwürdige Eigendynamik und richteten sich gegen ihn selbst: Moravia kam nicht mehr los vom Sex und erstarrte im Manierismus. Als Intellektueller und streitbarer Journalist spielte er dennoch eine herausragende Rolle und trug viel zur Entstehung einer kritischen Öffentlichkeit nach Kriegsende bei. Gemeinsam mit Alberto Carocci übernahm Moravia 1953 die Leitung der gerade gegründeten Zeitschrift Nuovi Argomenti. Der linke Industrielle Adriano Olivetti finanzierte die marxistisch ausgerichtete Publikation, die mit Schwerpunkten zum Stalinismus oder zu Kunst und Kommunismus von sich reden machte. 1955 traf Moravia eine ungewöhnliche Entscheidung und veröffentlichte ein Langgedicht: » Gramscis Asche«. Es stammte von einem jungen Lehrer aus Norditalien, den er bald darauf kennenlernen sollte. Pier Paolo Pasolini.
ABENDS IM CAFÉ
Piazza del Popolo
Es war Dacia Maraini, die Moravia 1986, vier Jahre vor seinem Tod, nach seinen ersten Erinnerungen befragte und nicht locker ließ, obwohl ihr früherer Mann möglichst wenig mit der Vergangenheit zu tun haben wollte. Er habe sich auch bei seinem eigenen Vater nie nach dessen Kindheit in Venedig und dem beruflichen Werdegang erkundigt. Das Gespräch wurde in der Familie Pincherle nicht gepflegt. »Er hat nichts erzählt, und ich war auch nicht neugierig, etwas über ihn zu erfahren. Ich erkundige mich nicht nach der Vergangenheit von Menschen. Mich interessiert nur ihr Charakter, also ihre Gegenwart«, wehrte Moravia auch das Bohren seiner langjährigen Lebensfreundin ab. Die Verfasserin etlicher Bestseller, Theaterautorin, Protagonistin des italienischen Feminismus ist bis heute sehr vital. Sie muss mehr wissen, auch über die Vergangenheit. Es geht zur Piazza del Popolo, die sich mit den Zwillingskirchen rechts und links wie ein Bühnenbild öffnet und einer der letzten städtebaulichen Geniestreiche des päpstlichen Roms war. In der Mitte steht ein ägyptischer Obelisk, ein Mitbringsel des Kaisers Augustus von seinen Feldzügen. Auch Hinrichtungen wurden hier zelebriert. Unter Papst Paul II. (1464–1471) entstand über die Via del Corso dann eine anderthalb Kilometer lange Achse, die von Santa Maria del Popolo, einer der ältesten Pfarrkirchen Roms, bis zu San Giovanni im Lateran geht und für Pferderennen genutzt wurde. Anderthalb Jahrtausende war die Porta del Popolo das zentrale Eingangstor der Stadt – der junge Weimarer Geheimrat Johann Wolfgang Goethe fiel 1786 auf dieser Piazza in seinen ersten Entzückensrausch. Dahinter liegt die Via Flaminia, benannt nach der alten Konsularstraße, die hier endete. Bis zur Wohnung Dacia Marainis ist es nicht weit.
Wenn Dacia Maraini die Tür öffnet, liegen sofort die siebziger Jahre in der Luft. Das hängt nicht nur mit ihrem knallblauen Lidschatten zusammen, den sie auch die ganzen achtziger und neunziger Jahre hindurch ungerührt trug und der inzwischen längst wieder modern ist. Es ist ihre unkomplizierte Art, die Selbstverständlichkeit, mit der sie mich in Empfang nimmt und ein Gespräch anknüpft. Dass ihre Mutter eine sizilianische Prinzessin war, scheint unwahrscheinlich, genauso wie die Tatsache, dass sie die fünfundsiebzig seit einer Weile überschritten hat. Sie verscheucht eine Katze vom Arbeitstisch in ihrer Dachwohnung, von deren Terrasse man den Petersdom sieht. An den Wänden hängen Erinnerungsstücke ihrer vielen Reisen, die sie mit Alberto Moravia und dem gemeinsamen Freund Pier Paolo Pasolini unternahm, afrikanische Masken, Marionetten aus Fernost. Es gibt überladene Bücherregale und mehrere Tische für ihre verschiedenen Aktivitäten. Ein Schwager klingelt, um sich eines wackligen Küchenschrankes anzunehmen, dann muss die Katze wieder eingefangen werden, schließlich trinken wir Tee. Sie war noch ein Kleinkind, als der Vater Fosco Maraini, ein Ethnologe, mit der Familie 1939 nach Japan übersiedelte. Nach dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten 1943 weigerte sich Fosco Maraini, auf die Republik von Salò zu schwören, weshalb man die Eltern mit ihren Kindern drei Jahre lang in ein Lager steckte, wo sie fast verhungert wären. Die Familie kehrte 1946 nach Italien zurück. »Ich kam Anfang der fünfziger Jahre von Florenz nach Rom. Es war damals vollkommen verschlafen, aber sehr, sehr schön«, erinnert sie sich. »Kein Verkehr, kaum Autos. Am Stadtrand ließen die Schäfer ihre Herden weiden, die fürchterliche Peripherie, die in den folgenden Jahren entstand, gab es noch nicht.« Wieder klingelt es, jetzt kommt der Hausmeister. Normalerweise sei bei ihr nicht so viel los, entschuldigt sie sich. Dacia Maraini hat einen strikten Tagesablauf, darin passte sie zu Moravia: Morgens schreibt sie, nach dem Mittagessen korrigiert sie oder widmet sich kleineren Projekten. Wenn sie an neuen Büchern arbeitet, zieht sie sich aufs Land zurück. Sie ist eine Bestseller-Autorin und in siebzehn Sprachen übersetzt, was ihr bis heute Reisen ins Ausland ermöglicht. Kaum ein internationales Literaturfestival kommt ohne sie aus. »Als Ende der fünfziger Jahre mein erster Roman fertig war, schlug der Verleger vor, ein bekannterer Schriftsteller solle ein Vorwort verfassen. Ich hatte einen Freund, der Alberto Moravia kannte, und so kam ich auf ihn. Auf diese Weise lernten wir uns kennen«, erinnert sie sich. Moravia war damals bereits vierundfünfzig Jahre alt und ein berühmter Mann. Er nahm sie gleich mit auf eine Reise nach Afrika. Dass ihm die blondköpfige, grünäugige junge Autorin mit der ungewöhnlichen Herkunft gefiel, kann man sich gut vorstellen. »Er war ein reizender Mensch, sehr sanft, obwohl alle dachten, er sei eher störrisch«, schildert Dacia Maraini Moravia. »Aber das war er gar nicht, er hatte diese wuchernden Augenbrauen, die ihm etwas Brüskes gaben. In Wirklichkeit war er sehr gesellig, ein blendender Unterhalter und ein großer Geschichtenerzähler. Ein extrem liebenswürdiger Mann.« Seine Autorität als Schriftsteller hat Dacia Maraini, so sehr sie Moravia schätzte, nicht gehemmt: Sie ging ihre eigenen Wege, schrieb im Schnitt alle drei Jahre einen neuen Roman, befasste sich mit weiblichen Schicksalen, dem historischen Sizilien und den Folgen des Faschismus. Knapp zwei Jahrzehnte lang reiste sie mit Alberto Moravia um die Welt und stand auch in Rom im Mittelpunkt des literarischen gesellschaftlichen Lebens. Wieder tauchen dieselben Namen auf.
Ähnlich wie La Capria schildert auch Dacia Maraini eine inspirierende Atmosphäre. Es war eine Phase des Übergangs, die Verhältnisse waren nicht zementiert. Der Krieg lag noch in der Luft, und die Resistenza war für alle Schriftsteller, die zwischen 1908 und 1925 geboren wurden, zu einer Wasserscheide geworden, ein umwälzender, oft auch biographischer Bruch. Jeder musste sich dazu verhalten, egal ob Partisan oder nicht. Moravia und Gadda kreisten in mehreren Büchern um ihr Versäumnis einer aktiven Teilnahme. Der Bürgerkrieg in Norditalien sei ein »Schnellkurs in Geschichte, Ethik und Ästhetik« gewesen, beschrieb es Franco Fortini. Für diejenigen, die im Widerstand ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, war es nur folgerichtig, sich jetzt für den gesellschaftlichen und politischen Umbau ihres Landes zu engagieren. Die Literatur schien ihnen ein geeignetes Mittel, um die Welt zu verändern. Welche großen Hoffnungen man hegte und wie eng Politik und Kultur zu Anfang miteinander verwoben waren, erzählt zum Beispiel Carlo Levi in seinem Roman Die Uhr (1950). Der Turiner Arzt, Maler und Schriftsteller, ebenfalls in Rom zu Hause und Verfasser des berühmten Buches Christus kam nur bis Eboli (1945), war einer der Protagonisten des Partito d’azione gewesen, jener Partei, die während der Resistenza eine große Rolle gespielt hatte, aber bei den ersten Gemeindewahlen im Frühjahr 1946 nur wenige Stimmen bekam. Die Uhr dreht sich um diese erste Erfahrung der Ernüchterung: Bereits im Winter 1945 zerfiel der Zusammenschluss aller antifaschistischen Parteien, die Linke wurde von den Konservativen an den Rand gedrängt, und die Wortführer des Partito d’azione zerstritten sich. Dennoch schien Italien damals veränderbar, trotz der christdemokratischen Regierung unter De Gasperi, die 1948 mit 48,5 Prozent der Stimmen über die »Volksfront« aus Sozialisten und Kommunisten, die nur 31 Prozent erreichten, haushoch siegte. Der Turiner Einaudi-Verlag richtete gleich nach dem Krieg eine Niederlassung in Rom ein, Bompiani zog nach, viele junge Leute kamen in die Hauptstadt, Zeitschriften wurden gegründet, das Kino bot vollkommen neue Arbeitsmöglichkeiten. Nie zuvor und nie danach waren so viele Schriftsteller mit Drehbüchern und Filmen befasst: Moravia, Mario Soldati, Ennio Flaiano, La Capria und bald auch Pier Paolo Pasolini. Es herrschte eine mitreißende Aufbruchsstimmung. Italo Calvino, genau wie Levi Einaudi-Autor, brachte es 1959 auf den Punkt: »Nach dem Krieg gab es in Italien eine literarische Explosion, die vor der künstlerischen auch eine körperliche, eine grundlegende kollektive Erfahrung war. Wir hatten den Krieg erlebt, und wir Jüngeren – die gerade noch rechtzeitig Partisanen geworden waren – fühlten uns nicht erdrückt, besiegt oder ›verbrannt‹, sondern als Gewinner, als exklusive Träger von etwas. Es war kein leichtfertiger Optimismus, im Gegenteil: Wir trugen das tragische Zeichen des Lebens in uns, einen tiefen Grimm, vielleicht auch eine Fähigkeit zur Verzweiflung, aber das Hauptgewicht legten wir immer auf eine kecke Fröhlichkeit. Viele Dinge wurden aus dieser kecken Fröhlichkeit geboren, sie war der Auslöser für meine frühen Erzählungen und meinen ersten Roman. Die Spannung, die uns der historische Moment vermittelt hatte, verlor sich rasch.« In den öffentlichen Diskussionen hielt die Bedeutung der Schriftsteller noch an; ihre Meinung hatte Gewicht und eine ethische Berechtigung. Stärker als je zuvor wurde das kollektive »Wir« als sinnstiftend erlebt.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Rom, Träume»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Rom, Träume» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Rom, Träume» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.