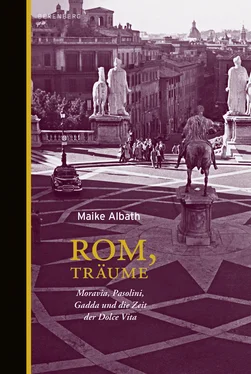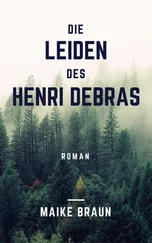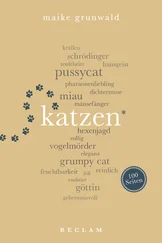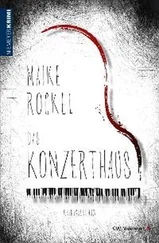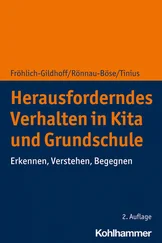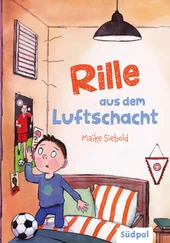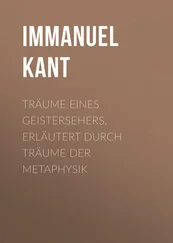Es passte zu Elsa Morante, dass sie sich für den 1933 gegründeten Einaudi-Verlag entschied: Während des Faschismus war das Haus zu einem Sammelbecken kultureller Gegenströmungen geworden. Die jungen Lektoren, die beinahe alle Schriftsteller waren, wollten das Nach-kriegsitalien mitgestalten; sie brachten unbekannte Autoren heraus, waren neugierig, hielten ihre berühmten Mittwochssitzungen ab, die zu einem Treffpunkt der geistigen Elite wurden, und sie waren international auf dem neuesten Stand. Es herrschte eine elektrisierende Offenheit, in die Elsa Morante mit ihrer ungewöhnlichen Schreibweise gut hineinpasste. Don Quichotte und Ariosts Rasender Roland zählten zu den Modellen des neunhundertseitigen Romans, in dem jeder in Sehnsucht gefangen ist und Liebe zu einer fast kultischen Handlung wird. Mit seiner Düsternis und dem sizilianischen Schauplatz, wo sich die Geschichte um die Jahrhundertwende zuträgt, schien das Buch mehr in der Tradition der Brontë-Schwestern zu stehen. Die Literaturkritik zog Vergleiche zu Dostojewski, Melville, Julien Green und Edgar Allan Poe. Die barocke, sinnliche Sprache und die komplexe Syntax waren das Gegenteil der schlackenlosen neorealistischen Erzählweise anderer Einaudianer wie Pavese, Vittorini, Natalia Ginzburg oder Calvino. Mit ihrem Aufgebot narrativer Techniken des 19. Jahrhunderts schwebte Elsa Morante ein Abgesang auf den Roman der bürgerlichen Epoche vor. Italo Calvino, ebenfalls Lektor bei Einaudi und Verfasser des Widerstandsromans Wo Spinnen ihre Nester bauen (1947), nahm in einem Brief vom 16. August 1948 seine Vorbehalte gegen die Sprache Morantes zurück und kündigte ihr eine umfangreiche Rezension des Romans an, die er für die kommunistische Zeitung L’Unità geschrieben hatte. »Du wirst dort mein Urteil finden, streng marxistisch-leninistisch. Hier einige Vorwegnahmen. Die Figuren, die mir am besten gefallen: 1. Elisa, 2. Rosaria, 3. Alessandra. Was mir am meisten auf die Nerven geht: die Verrücktheit. Das wichtigste Gefühl: Vergebung.« In der Besprechung, abgedruckt am 17. August, zollte Calvino der Kollegin großen Respekt. Von dem pittoresken Charakter des Romans dürfe man sich nicht blenden lassen, denn hinter dem raffinierten Spiel mit Elementen der Fabel und des Märchens stecke eine Analyse der Klassengesellschaft. Dass man die eigenen Bücher auch in den Feuilletons der großen Zeitungen lobend besprach, war eine beliebte Praxis des Turiner Verlagshauses. Die Mitarbeiter waren in verschiedenen Bereichen des Literaturbetriebs engagiert; Einaudi stand für eine neue linke Kultur und bemühte sich um Diskurshoheit. Aber gerade unter den linientreuen Kommunisten stieß Elsa Morante auch auf große Ablehnung – ihre Haltung sei zu unpolitisch. Ganz anders das Urteil eines überzeugten Marxisten: Georg Lukács hielt Lüge und Zauberei sogar für den größten italienischen Roman des 20. Jahrhunderts. Am 6. Februar 1968 schrieb Lúkacs der Schriftstellerin aus Budapest: »Die größte Sorge meines Lebens ist, dass die ganze gegenwärtige Zivilisation auf die Zerstörung dessen hinarbeitet, was am Menschen wirklich menschenwürdig ist. Im Kampf dagegen hat man wenig Verbündete. Sie sind eine. In Ihren Büchern zeigt sich immer wieder, dass die menschliche Substanz letzten Endes doch etwas Unzerstörbares ist.«
Als Lüge und Zauberei herauskam, war Elsa Morante Mitte dreißig und keine Nachwuchsautorin mehr. Sie hatte Erfolg, erhielt den prestigereichen Premio Viareggio, und die finanzielle Lage des Ehepaares Moravia verbesserte sich. Elsa Morante und Alberto Moravia zogen in eine größere Wohnung in der Via dell’Oca 27 gleich hinter der Piazza del Popolo, Elsa besaß zusätzlich ein Arbeitsquartier in Parioli, und kaum war Lüge und Zauberei im Juni erschienen, mieteten sie für den Rest des Sommers die pompöse Marmorvilla eines Filmproduzenten auf Capri, luden Natalia Ginzburg und andere Freunde ein und verpulverten vergnügt ihr Geld. Moravia konnte an seine Berühmtheit der Vorkriegszeit anknüpfen. Seine Novelle Agostino war auf Begeisterung gestoßen und in mehrere Sprachen übersetzt worden. Carlo Emilio Gadda hatte die Initiationsgeschichte 1945 in einer ausführlichen Rezension gelobt: Die Klarheit des Stils, die extreme Objektivität und die Art und Weise, wie gesellschaftliche Moral und die Entdeckung der individuellen Sexualität in Widerstreit geraten, all das hatte ihm gefallen. Mit Die Römerin landete Moravia 1947 dann nicht nur bei der Kritik, sondern auch beim Publikum einen Coup. Es war zugleich sein endgültiger internationaler Durchbruch, der durch die Verfilmung mit Gina Lollobrigida noch an Fahrt gewann. Innerhalb weniger Jahre avancierte Alberto Moravia zu einem verlässlichen Vertreter des psychologischen Realismus und veröffentlichte Roman um Roman. Einige glückten, wie Die Römerin, Der Konformist (1951), Die Verachtung (1954) und Cesira (1957), andere weniger. Der Konformist sticht unter den kühlen Sittenbildern der römischen Gesellschaft hervor, denn hier verarbeitete der Schriftsteller die Erfahrung der Ermordung seiner Cousins Rosselli. Es ist das Porträt eines Mitläufers, der sich mehr aus einer inneren Leere heraus denn aus Überzeugung von den Faschisten instrumentalisieren lässt. In seinen anderen konzentriert gebauten, teils chronikartigen Geschichten über manipulative Mütter, triebhafte junge Frauen oder Künstler, die an emotionaler Kälte zerbrechen, diagnostizierte Moravia die neokapitalistische Restauration der Nachkriegszeit. Eros und Sexualität wurden zur Ware.
Wie sehr Alberto Moravia mit seinen Büchern Themen und Stimmungen traf, zeigen die vielen Verfilmungen. Bernardo Bertolucci drehte 1970 nach Moravias Romanvorlage seinen internationalen Kinoerfolg Der Konformist mit Jean-Louis Trintignant, aber schon sieben Jahre zuvor machte Jean-Luc Godard aus Die Verachtung einen Film über die Ästhetik medialer Vermittlung und die Kommerzialisierung künstlerischer Ausdrucksformen: Le Mépris. Es war die Spätphase der Nouvelle Vague, einer Stilrichtung, mit der seit Ende der fünfziger Jahre neben Godard auch François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol und andere die filmischen Erzählformen revolutioniert hatten. Die Regisseure der Nouvelle Vague beriefen sich auf die italienischen Neorealisten, aber auch auf Alfred Hitchcock und Howard Hawks, und Godard galt seit Außer Atem (1960) als ihr radikalster Vertreter. Ihm ging es um Brüche, Tempoverschiebungen und überraschende Schnitte, er hebelte Chronologien aus, arbeitete mit Zitaten und essayistischen Elementen und etablierte eine neue, ungewohnte Bildsprache. Bei der Besetzung von Le Mépris bewies der Regisseur traumwandlerisches Geschick. Michel Piccoli spielte den korrumpierbaren Schriftsteller, Brigitte Bardot seine Frau Camille. Die Geschichte entspinnt sich bei Godard folgendermaßen: Der amerikanische Produzent Jeremy Prokosch, von Jack Palance verkörpert, beauftragt den Schriftsteller, die Odyssee umzuschreiben und einen Filmstoff daraus zu machen. Den Film soll der Regisseur Fritz Lang drehen, der sich selbst spielt, aber mit Prokosch über die angemessene Adaption streitet. Einer der Schauplätze ist die optisch wirkungsvolle Villa Malapartes auf Capri, deren lange Treppe zum Dach Camille alias Brigitte Bardot in der gleißenden Sonne barfuß hinaufsteigt. Jeder Schritt drückt Begehren aus; ihre erotische Anziehungskraft hat etwas Trotziges. Prokosch bedrängt Camille, ihr Mann lässt dies zu, wofür sie ihn verachtet. Godard übernahm von Moravia die Figurenkonstellation und die Verknüpfung von Ehekrise und Filmprojekt, veränderte aber die Nationalitäten des Personals, fügte die geniale Figur der Übersetzerin Francesca ein, stülpte den Zeitrahmen um und ließ die Dreharbeiten für eine Verfilmung der Odyssee, die in der Romanvorlage nur geplant sind, Teil der Handlung werden. Ein Grundkonflikt ist die Frage, ob der antike Stoff publikumswirksam aktualisiert oder historisch vermittelt werden soll. Die karge Geometrie der Malaparte-Villa spiegelt die Innenwelten der Figuren. Der Film ist dem Roman sogar überlegen, weil Moravias Psychologisierungen ins Visuelle verlagert werden und dadurch an Prägnanz gewinnen. Während sich Godard von dem Dilemma zwischen eigenen, künstlerischen Ansprüchen und äußeren Zwängen fasziniert zeigte, ging es Moravia in seinem Roman um den Wandel der Bindungen und Gefühle durch einen neuen Materialismus, der eben auch den Bereich durchdringt, der eigentlich einen Gegendiskurs hervorbringen sollte.
Читать дальше