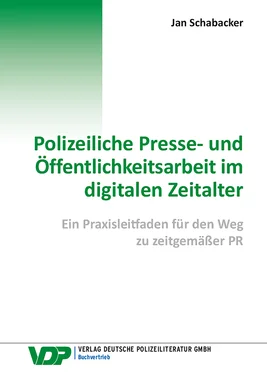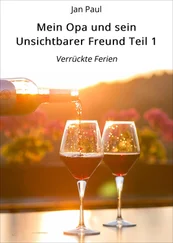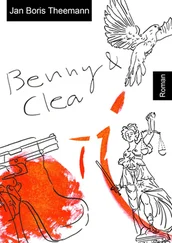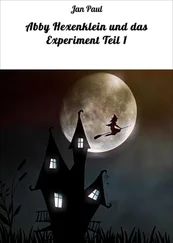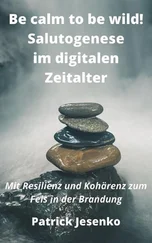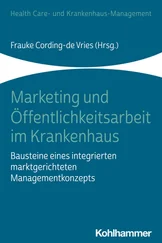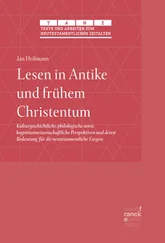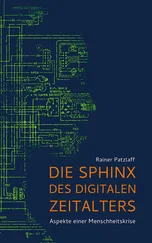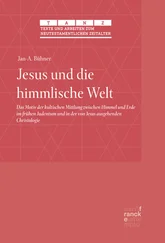Die aktive Veröffentlichung von Bildern und Videos durch die eigene PR-Dienststelle ist aber nicht der einzige Berührungspunkt zum Thema Bildrechte in der polizeilichen Arbeit. Polizistinnen und Polizisten werden immer häufiger während des Einsatzes gefilmt, Videos werden auf YouTube oder anderen Online-Kanälen von Privatpersonen veröffentlicht, und Medien beziehen sich in ihrer Berichterstattung auf diese Bilder, die allzu häufig nur einen kleinen Ausschnitt aus einem Polizeieinsatz zeigen und dessen Gesamtverlauf nicht ansatzweise wiedergeben. Bei Großeinsätzen werden Polizeibeamtinnen und -beamte regelmäßig mit Pressevertretern konfrontiert, die Bilder von ihnen, von den Opfern einer Straftat oder eines Unfalls, von Demonstrationsteilnehmern oder auch völlig unbeteiligten Personen aufnehmen und veröffentlichen wollen. Regelmäßig werden nach daraus resultierenden Konfliktsituationen die PR-Dienststellen mit Fragen zur Rechtmäßigkeit solcher Aufnahmen und zum rechtlich sauberen Umgang mit den Erstellern konfrontiert. Insofern kommt diesem Rechtsbereich auch im polizeilichen Einsatzgeschehen eine immer größere Bedeutung zu. Die folgenden Ausführungen sollen für den polizeilichen Alltag und die Praxis Antworten auf die drängendsten und immer wieder auftauchenden Fragen im Zusammenhang mit dem Thema Bildrechte geben. Klar ist dabei eines: Wir bewegen uns in diesem Rechtsbereich permanent in Grauzonen, die immer wieder eine konkrete Bewertung des Einzelfalls verlangen. Und trotzdem helfen die grundlegenden Rechtskenntnisse dabei, konkrete Situationen in Kenntnis der Rechtsvorschriften mit Augenmaß einzuschätzen.
4.2.1Bilder von Personen und das Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild
Die Grundregel ist simpel: Jeder Mensch kann selbst darüber bestimmen, ob er fotografiert werden möchte und ob diese Bilder veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Wer diesen Grundsatz verinnerlicht, der ist auf jeden Fall mit der notwendigen Sensibilität unterwegs, wenn er eine Kamera zu Zwecken der Public Relations in die Hand nimmt. Aber ohne Bilder von Personen, ohne Videos, in denen Menschen agieren, ist zeitgemäße PR undenkbar. Wie sehr erschwert die Beachtung dieses Grundsatzes also unsere Intention, moderne PR zu betreiben?
Im Mai 2018 trat zudem die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Auch dieses komplizierte Rechtsgebilde strahlt in seiner Wirkung auf das Recht am eigenen Bild, denn ein solches Bild ist zweifelsfrei ein persönliches Datum, das nun auch durch europäisches Recht einem besonderen Schutz unterliegt. Zum Zeitpunkt der Erscheinung dieses Werks herrscht allgemein die rechtliche Auffassung, dass sich aus der Datenschutz-Grundverordnung und den ergänzenden nationalen Gesetzen keine wesentlichen Änderungen der Rechtslage hinsichtlich der Nutzung von Fotos und Videos ergeben haben. In der folgenden Darstellung beziehe ich mich hinsichtlich der Aktualität der rechtlichen Einschätzung auf den Zeitpunkt der Erscheinung dieses Werkes und verweise noch einmal auf die Pflicht aller Beschäftigten im Bereich der Public Relations einer Polizeibehörde, sich hinsichtlich der aktuellen rechtlichen Entwicklungen permanent auf dem Laufenden zu halten.
Die europäische Datenschutz-Grundverordnung eröffnet in Artikel 85 Abs. 1 den Mitgliedstaaten nationale Gestaltungsspielräume für den Ausgleich zwischen Datenschutz und der Meinungs- und Informationsfreiheit. Damit bleibt nach herrschender Rechtsmeinung in Deutschland das Kunsturhebergesetz gültige Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung von Bildmaterial. Die dort enthaltenen Regelungen fügen sich in die grundsätzlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung ein. Das Kunsturhebergesetz ist damit Teil der deutschen Anpassungsgesetzgebung im Sinne der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Nun können die Leserinnen und Leser aufatmen, die sich schon länger mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und damit auch mit dem Recht am eigenen Bild auseinandersetzen: Gravierende Änderungen aufgrund der Einführung der Datenschutz-Grundverordnung gibt es damit nämlich nicht. Für alle anderen seien hier die grundsätzlichen Regelungen erläutert, die im Umgang mit Bildern und Videomaterial zwingend beachtet werden müssen.
Eigentlich vom so genannten Urheberrechtsgesetz abgelöst gelten wichtige Paragrafen des Kunsturhebergesetzes von 1907 bis heute. Aus den §§ 22 und 23 KUG ergeben sich spezialgesetzlich geregelt sowohl das Recht am eigenen Bild als auch die möglichen Ausnahmen davon.
Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie
§ 22
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten
§ 23
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben.
Einfach ausgedrückt regelt § 22 die Nutzung von Fotografien und Videos, auf denen Personen abgebildet sind. Sie dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Bei Minderjährigen überträgt sich das Einwilligungserfordernis auf die Eltern. Auch die mündliche Einwilligung des Abgebildeten ist ausreichend, kann sich aber im Nachgang in der Beweisbarkeit als problematisch darstellen. In der Regel erfolgt die Einwilligung des Abgebildeten zu einem bestimmten Zweck und nicht zur freien, zweckungebundenen Nutzung. Die schriftlich formulierte Einwilligung und Zweckbindung schafft für den Nutzer mehr Rechtssicherheit. Dabei sollte der Verwendungszweck so detailliert wie möglich benannt werden. So kann beispielsweise die Autorisierung zur Nutzung eines Bildes für das Internet auf bestimmte Seiten begrenzt werden. Gerade hier ist das besonders wichtig, um gegebenenfalls rechtliche Ansprüche gegen eine Fremdnutzung geltend machen zu können.
Von der grundsätzlich notwendigen Einwilligung gibt es aber auch Ausnahmen, die sich aus § 23 KUG ergeben.
Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild
1.Personen der Zeitgeschichte
Geltendes Recht unterscheidet zwischen absoluten und relativen Personen der Zeitgeschichte. Absolute Personen der Zeitgeschichtesind unter anderem Politiker, Künstler, Schauspieler, Schriftsteller, Sportler sowie Angehörige der Königshäuser. Doch auch diese Personen haben ein Recht auf Privatsphäre und am eigenen Bild, wenn es sich bei dem Rahmen der Erstellung des Bildes nicht um ein Ereignis der Zeitgeschichte handelt. Wenn ein bekannter Politiker beim Friseur sitzt und das Bild des Haareschneidens im Internet veröffentlicht wird, gilt diese Ausnahmeregelung nicht. Es muss ein berechtigtes Informationsinteresse der Allgemeinheit vorliegen, das mit dem Recht am eigenen Bild und dem Recht auf Privatsphäre des Betroffenen abzugleichen ist. Dass die Grenzziehung in solchen Fällen sich durchaus als problematisch darstellen kann, erschließt sich von selbst. Absolute Personen der Zeitgeschichte spielen für die polizeiliche PR in der Regel aber auch nur dann eine Rolle, wenn es sich tatsächlich um zeitgeschichtliche Ereignisse handelt, beispielsweise der Besuch einer Polizeibehörde durch den Innenminister oder eine Kampagne mit Unterstützung eines prominenten Sportlers.
Читать дальше