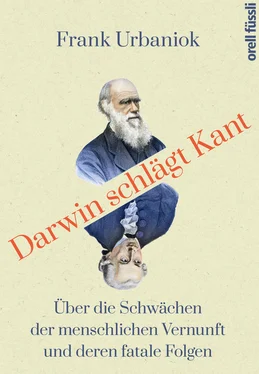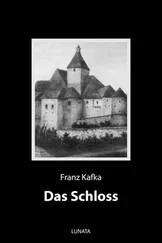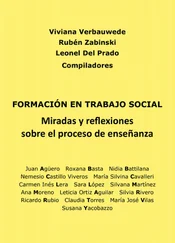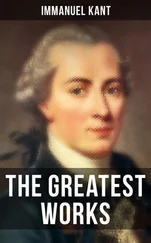1 ...6 7 8 10 11 12 ...32 Der Rückschaufehler spielt eine große Rolle bei der Prognose zukünftiger Ereignisse und insbesondere bei der Einschätzung von Risiken. Wird z. B. ein Risiko, das 1 Prozent beträgt, zutreffend als gering bezeichnet, dann bedeutet das, dass sich dieses Risiko in 100 Fällen einmal realisiert und 99 Mal nicht. Kommt es aber dann zu diesem Fall, dann wird dieser nicht zu den 99 Fällen, die gut gegangen sind, in Beziehung gesetzt. In der Logik des Rückschaufehlers heißt es, die Einschätzung war falsch. Denn, wenn das Risiko tatsächlich gering war, dann hätte es ja nicht zu diesem Fall kommen dürfen.
Kahneman demonstriert den Rückschaufehler anhand von Prognoseeinschätzungen bei Ärzten, Finanzberatern, Trainern, Topmanagern, Sozialarbeitern, Diplomaten, Politikern. Demnach neigen wir dazu, »Entscheidungsträger für gute Entscheidungen, die einen negativen Ausgang nehmen, zu tadeln und für erfolgreiche Maßnahmen, die erst im Nachhinein naheliegend erscheinen, nicht genug zu loben.« [4, S. 252] Allgemein sei es so, dass Rückschaufehler zu einer erhöhten Scheu vor Risiken – insbesondere bei Entscheidungsträgern – führten. Allerdings »bringen sie unverantwortlichen Hasardeuren auch unverdiente Belohnungen, wie etwa einem General oder einem Unternehmer, die ein aberwitziges Risiko eingingen, das sich auszahlte. Führungspersonen, die Glück haben, werden nicht dafür bestraft, dass sie zu hohe Risiken eingegangen sind.« [4, S. 253]
Der Rückschaufehler begegnet uns in der Politik, in der Wissenschaft, aber auch in unserem täglichen Leben an vielen Stellen. Die Kontrollfrage, die man sich stets selbst stellen kann, lautet: Wären vor dem Ereignis, ohne Kenntnis des Ausgangs des Ereignisses, die gleichen Argumente in der gleichen Weise angeführt worden?
Der Halo-Effekt ist ein Klassiker der Psychologie. Wenn wir glauben, eine Eigenschaft einer Person oder einer Sache erkannt zu haben, dann besteht die starke Tendenz, dieser Person oder Sache weitere ähnliche Eigenschaften zuzuordnen, ohne dass es hierfür eine Grundlage gibt. Für dieses weitverbreitete Phänomen gibt es zahlreiche Beispiele. Wenn eine Person in einem bestimmten Bereich eine gute Leistung bringt, dann werden ihr auch in anderen Bereichen überdurchschnittliche Kompetenzen zugetraut. Wirkt eine Person sympathisch auf uns, dann vermuten wir eine Fülle weiterer positiver Eigenschaften bei ihr. Von einem Politiker, der unser Vertrauen genießt, nehmen wir an, dass er ein ausgeglichenes Familienleben hat und von bestimmten Sexualpraktiken Abstand hält, die wir selber unangemessen finden. Man ist überrascht, wenn man erfährt, dass ein als seriös geltender Finanzminister sadomasochistische Sexualpraktiken auslebt.
Häufig hat der Halo-Effekt auch eine absichtsvoll finalistische Qualität. Das heißt, ein bestimmtes Ergebnis, eine bestimmte Sichtweise auf eine Person oder auf eine Sache ist uns angenehm. Dann werden wir bereitwillig nach Aufhängern suchen, die uns dieses Bild bestätigen. Man kann das bisweilen im Urlaub beobachten. Die meisten Menschen wollen ein positives Urlaubserlebnis. Sie stellen dann in der Ferne plötzlich eine Fülle von Dingen fest, die besser sind als zu Hause (die Menschen sind viel freundlicher, hilfsbereiter, das Essen schmeckt besser, es herrscht allgemein eine größere Zufriedenheit, der Zusammenhalt zwischen den hiesigen Familien ist besser etc.). Es gibt im Übrigen auch das Gegenteil, das einem subjektiv bestätigt, dass zu Hause alles besser ist. Auch hier wird es – wie bei den vorangegangenen Beispielen – häufig so sein, dass insgesamt eigentlich ein gemischtes Bild vorliegt, das aber einseitig interpretiert wird.
Es sei an dieser Stelle schon festgehalten, dass für uns gemischte Bilder, also Sichtweisen, die Ambivalentes zutage fördern, generell unbequem sind. Der Halo-Effekt ist daher Ausdruck eines Bedürfnisses nach eindimensionaler Klarheit, die keine Verwirrung auslöst. Wir wollen klare, einfache, eindeutige, lineare und einheitliche Verhältnisse haben. Wir bevorzugen klare Polaritäten (schwarz/weiß, Freund/Feind, gut/schlecht). Eigentlich wissen wir, dass es häufig komplizierter ist. Unsere Sehnsucht ist aber auf klare Polarität gerichtet. Diese Sehnsucht wird in Politik, Werbung und der Wirtschaft ausgiebig bedient. Man kann sich hier wiederum vorstellen, dass die Tendenz zu klaren, linear harmonisierten Beurteilungen evolutionär Vorteile hatte. Die Wirklichkeit differenziert erfassen? Nein, denn Geschwindigkeit und Klarheit sind wichtiger als der Inhalt. Das ist der Sinn der Generalisierungstendenz des Halo-Effekts. Homogene Beurteilungen bieten eine bessere Grundlage dafür, rasch und eindeutig zu handeln, als differenzierte Sichtweisen, deren Einzelaspekte nicht alle in der gleichen Richtung angeordnet sind. Wie beim paranoiden Urzeitmenschen begünstigt die Evolution falsche Sichtweisen, wenn dafür ein Gewinn in der Handlungskompetenz erreicht werden kann (rasches und eindeutiges Handeln).
2.4What you see is all there is (WYSIATI-Regel)
Wir haben eine außerordentlich hohe Bereitschaft, uns aus wenigen, oft zufälligen und unvollständigen Informationen eine Geschichte zu zimmern, die subjektiv passt. Dabei leisten uns der Halo-Effekt, der Rückschaufehler und viele weitere verzerrungsanfällige Mechanismen gute Dienste. Die subjektiv passende und angenehme Geschichte glauben wir gerne, halten sie für wahr, und das mit einem hohen Maß an innerer Überzeugung. Unser intuitives System ist darauf ausgerichtet, möglichst schnell eine kohärente Geschichte parat zu haben. Die Kohärenz der Geschichte ist das entscheidende Kriterium. Auf wie vielen Informationen diese Kohärenz beruht, von welcher Qualität diese Informationen sind, welche Informationen fehlen, das alles spielt keine Rolle. Häufig verfügen wir zwar nur über sehr wenige Informationen. Das beeinträchtigt aber nicht unsere Überzeugung, die wir mit einer Geschichte verbinden. Hier spielt nur die höchst subjektiv empfundene Kohärenz der Geschichte eine Rolle. Das ist der Kern der WYSIATI-Regel: Was wir nicht sehen, was wir nicht wissen, das gibt es nicht.
Kahneman beschreibt, dass es nicht auf die Menge oder die Qualität von Informationen ankommt. Wie stark wir von etwas überzeugt sind, hänge vor allem »von der Qualität der Geschichte ab, die wir über das erzählen können, was wir sehen, auch wenn wir nur wenig sehen«. Ist die Geschichte stimmig, dann sind wir restlos überzeugt. Zweifel und mögliche Widersprüche werden unterdrückt, und uns fällt gar nicht auf, dass uns viele wichtige Informationen fehlen. [4, S. 115]
Ein anderes Beispiel für die WYSIATI-Regel ist der Framing-Effekt: Die 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Operation zu überleben, wirkt beruhigender als die Aussage, dass ein 10-prozentiges Sterberisiko besteht. Dies, obwohl beide Aussagen inhaltlich genau das Gleiche bedeuten.
»In ähnlicher Weise ist Aufschnitt, der als ›90-prozentig fettfrei‹ beschrieben wird, anziehender als ›Aufschnitt mit 10 Prozent Fett‹. Die alternativen Formulierungen sind ganz offenkundig gleichbedeutend, aber eine Person sieht normalerweise nur eine Formulierung und ›nur was man sieht, zählt.‹« [4, S. 115]
Ein anderes Beispiel ist der Basisratenfehler. Er beschreibt, dass wir völlig unabhängig von der zugrunde liegenden statistischen Wahrscheinlichkeit einer Tatsache diese für wahrscheinlich oder unwahrscheinlich halten, je nachdem, ob uns eine um sie herum konstruierte Geschichte subjektiv kohärent erscheint oder nicht. Einer Versuchsgruppe werden zum Beispiel zwei Eigenschaften einer Person präsentiert: sanftmütig und ordentlich. Dann werden die Probanden gefragt, welchen Beruf diese Person wohl habe. Die meisten entscheiden sich in der dargebotenen Auswahl für den Beruf des Bibliothekars und nicht des Landwirts. Denn das Bild eines ordentlichen und sanftmütigen Bibliothekars kreiert eine subjektiv kohärente Geschichte. Statistisch gibt es aber sehr viel mehr männliche Landwirte als Bibliothekare, sodass es ungleich wahrscheinlicher ist, dass eine zufällig ausgewählte Person Landwirt statt Bibliothekar ist. [4, S. 17–18, 115]
Читать дальше