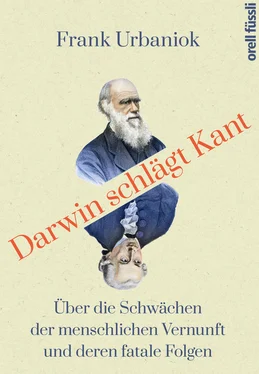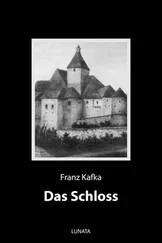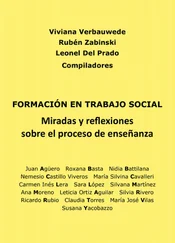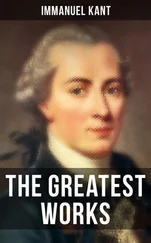1 ...7 8 9 11 12 13 ...32 Der Begriff Priming bezeichnet Phänomene, bei denen zufällig – zumeist unbewusst – eine Information aufgenommen wird, die dann später – ebenso zufällig – unsere Urteilsbildung oder unser Verhalten beeinflusst.
In einem Experiment erhielt die Hälfte einer Gruppe von Studenten Wörter, die mit älteren Menschen assoziiert werden. Sie sollten die ungeordneten Wörter durch eine Satzaufgabe ordnen. Dann wurden sie in ein anderes Büro geschickt. Der Fußweg zu diesem Büro war das eigentliche Experiment. Denn nun wurde gemessen, wie schnell sie diese Strecke bewältigten. Die Studenten, die Wörter bearbeitet hatten, die mit Alter zu tun haben (z. B.: vergesslich, grau, Florida oder Falte), bewältigten die Strecke erheblich langsamer als eine Gruppe, die andere Wörter erhalten hatte. Kahneman führt zu diesem Experiment aus: »Der ›Florida-Effekt‹ umfasst zwei Priming-Phasen. Zunächst primt die Menge der Wörter Gedanken an hohes Alter, obwohl das Wort ›alt‹ nie erwähnt wird; anschließend primen diese Gedanken ein Verhalten, langsames Gehen, das mit Betagtheit assoziiert ist. All dies geschieht unbewusst.« [4, S. 73]
Das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Das heißt, motorische Aktionen beeinflussen die Tendenz unserer Wahrnehmungen: »In einem Experiment sollten die Versuchspersonen durch neue Kopfhörer Botschaften lauschen. Ihnen wurde gesagt, Zweck des Experiments sei es, die Qualität der Audiogeräte zu testen, und sie sollten ihre Köpfe wiederholt bewegen, um mögliche Klangverzerrungen festzustellen. Die Hälfte der Teilnehmer sollte mit dem Kopf nicken, während die anderen den Kopf schütteln sollten. Die Nachrichten, die ihnen vorgespielt wurden, waren Radiokommentare. Diejenigen, die nickten (eine bejahende Geste), stimmten der Nachricht, die Sie [sic] hörten, im Allgemeinen zu, während diejenigen, die den Kopf schüttelten, sie tendenziell ablehnten. Wieder waren sich die Probanden dessen nicht bewusst, vielmehr bestand nur eine gewohnheitsmäßige Beziehung zwischen einer ablehnenden oder zustimmenden Einstellung und ihrem üblichen mimischen Ausdruck.« [4, S. 74]
In verschiedenen Experimenten wurden Teilnehmer auf das Thema »Geld« geprimt. Sie sollten etwa zunächst Wörter zu einem Geldthema ordnen. Das Priming auf Geld funktioniert aber auch sehr viel subtiler, wie zum Beispiel durch scheinbar zufällig im Hintergrund herumliegendes Monopoly-Geld auf einem Tisch oder den Bildschirmschoner eines Computers, der scheinbar zufällig ein Dollarzeichen zeigt. All diese Stimuli reichten aus, um das Verhalten der entsprechend geprimten Personen zu verändern. Sie hielten zum Beispiel bei einem Experiment doppelt so lange durch wie andere Teilnehmer, zeigten sich auf der anderen Seite aber auch signifikant egoistischer. So waren sie weniger bereit, einem anderen Studenten zu helfen, der die Teilnehmer, als Teil des Experiments, um Hilfe bat. [4, S. 75–76]
Studenten wurden aufgefordert, die Zahl aufzuschreiben, bei der ein rotierendes Glücksrad stehen blieb. Das Glücksrad war so eingestellt, dass es nur den Wert 10 oder 65 anzeigen konnte. Dann wurden den Studenten zwei Fragen gestellt: 1. Ist der Prozentsatz afrikanischer Staaten bei den Vereinten Nationen größer oder kleiner als die Zahl, die Sie notiert hatten? 2. Wie hoch schätzen Sie den konkreten Prozentsatz?
Die Zahl auf dem Glücksrad hatte offensichtlich nichts mit den beiden Fragen zu tun. Trotzdem hatte sie einen starken Einfluss auf die Antworten. Die Studenten, die die 10 notiert hatten, schätzten den Prozentsatz im Schnitt auf 25 Prozent. Die Studenten, die die Zahl 65 gesehen hatten, schätzten den Prozentsatz auf 45 Prozent.
Das Beispiel zeigt, dass vor allem unser intuitives System sehr offen dafür ist, beliebige Informationen aus der Umwelt entgegenzunehmen und uns dann an anderer Stelle wieder unterzujubeln.
Ankereffekte können Ergebnis eines – unbewussten – Priming-Effektes sein. Sie können aber auch dem bewussten, kognitiven Prozess entspringen. Dann wird der Anker bewusst berücksichtigt. Interessant ist, dass der Einfluss von Ankereffekten auf unsere Beurteilungen und unser Verhalten vollkommen losgelöst von einem rationalen Zusammenhang ist. [4, S. 152–153] Deswegen werden Ankereffekte intensiv im Rahmen von Verkaufs-, Marketing- und Verhandlungsstrategien eingesetzt.
Altbekannt und ein Prinzip, das die Werbung, aber auch die Politik ausgiebig gebraucht, sind Wiederholungen. Aussagen, die wir häufig hören, wirken vertraut. Vertrautheit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Aussage unabhängig von ihrem tatsächlichen Wahrheitsgehalt glauben. Generell weniger glaubwürdig erscheint uns eine Aussage, die wir noch nicht kennen.
Kahneman beschreibt diesen Effekt so: »Wenn man sich nicht an die Quelle einer Aussage erinnern kann und keine Möglichkeit hat, sich auf andere Dinge zu beziehen, die man kennt, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich an die gefühlte Mühelosigkeit des Denkens zu halten.« [4, S. 85]
Vertrautheit ist für unser Denken sehr bequem. Denn wir müssen uns ein Wissen nicht durch geistige Anstrengung erarbeiten, sondern erkennen einen Sachverhalt einfach wieder. Deswegen glauben wir Dinge, die wir schon häufiger gehört haben, leichter.
Es gibt sehr viele Befunde, die zeigen, dass die Wahrnehmung von Kausalität, also das Wahrnehmen von Ursache-Wirkungs-Beziehungen, ein sehr frühes Muster ist, das Menschen auf Vorgänge der Außenwelt projizieren. Kahneman schildert das Experiment von Fritz Heider und Mary-Ann Simmel aus dem Jahr 1944:
»Sie stellten einen Film her, der nur eine Minute und vierzig Sekunden lang ist und in dem man ein großes Dreieck, ein kleines Dreieck und einen Kreis sieht, die sich um eine Figur bewegen, die aussieht wie die schematische Ansicht eines Hauses mit einer offenen Tür. Die Betrachter sehen ein aggressives großes Dreieck, das ein kleineres Dreieck drangsaliert, einen verschreckten Kreis, wobei sich der Kreis und das kleine Dreieck verbünden, um den Rüpel zu überwältigen; sie sehen auch viel Gezerre an einer Tür und dann ein explosives Finale. Der Eindruck von Absicht und Emotionalität ist unwiderstehlich; nur Menschen, die an Autismus leiden, erleben dies nicht. Natürlich geschieht dies nur in unserem Kopf. Unser Gehirn ist nicht nur bereit, sondern regelrecht darauf aus, Akteure zu identifizieren, ihnen Persönlichkeitszüge und spezifische Intentionen zuzuschreiben und ihre Handlungen als Ausdruck individueller Neigungen zu interpretieren.
Auch hier sprechen die empirischen Befunde dafür, dass wir mit einer Anlage für intentionale Attributionen geboren werden: Schon Säuglinge unter einem Jahr identifizieren Rüpel und Opfer und erwarten von einem Verfolger, dass er den kürzesten Weg nimmt, um das zu fangen, hinter dem er her ist.« [4, S. 102–103]
Wir sind extrem darauf ausgerichtet, Kausalität und stimmige Geschichten zu konstruieren. Man kann sich leicht vorstellen, warum das sinnvoll ist. In einer Flut möglicher Informationen und Details ist es ein Gebot der Effizienz, nicht jede einzelne Information und jedes einzelne Detail abzuspeichern, sondern nach übergeordneten Mustern zu suchen. In einer kausalen Ordnung, in einer stimmigen Geschichte, in einem erklärenden Muster lassen sich Informationen in ökonomischer Weise verdichten. Neben der Reduzierung von Komplexität vermitteln uns Kausalität und andere identifizierte Muster ein Gefühl von Sinn und Kontrolle. Wir haben Angst, uns in zusammenhanglosen, für uns sinnlosen Informationen und Zufälligkeiten zu verlieren. Deswegen gibt es die starke Tendenz, Informationen und Ereignisse, mit denen wir konfrontiert werden, in ein Muster oder eine runde Geschichte zu zwängen. Wir lieben es, am Schluss etwas Kompaktes, Übersichtliches und Eindeutiges vor uns zu haben, einem Auto gleichend, das in einer Schrottpresse zu einem kompakten Rechteck zusammengedrückt wurde.
Читать дальше