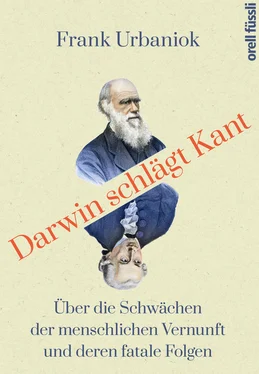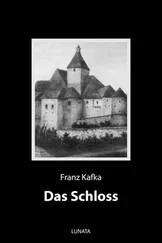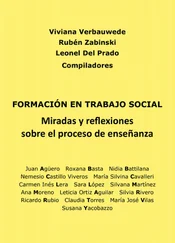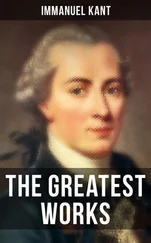1.1Grünes Blatt und roter Ball, alles Täuschung oder was?
Will man Grenzen und Schwachstellen der menschlichen Urteilsfähigkeit untersuchen, kommt man nicht an der philosophischen Erkenntnistheorie vorbei. Denn wie erwähnt betrifft sie gewissermaßen das Betriebssystem unseres Denkens. Im Zentrum steht die Frage, was man überhaupt mit dem menschlichen Verstand erkennen kann und wo prinzipielle, also theoretische Grenzen liegen. Hier muss noch einmal Immanuel Kant erwähnt werden. Die Ideen Kants sind keine leichte Kost, aber ich hoffe, die Leserinnen und Leser lassen sich nicht abschrecken. Wem dieser philosophische Einstieg aber zu abstrakt ist, der kann dieses Kapitel auch problemlos überschlagen und gleich mit den »Apps«, also der operativen Programmierung unserer Vernunft, fortfahren.
Bevor wir uns im Zusammenhang mit dem »Betriebssystem« mit synthetischen und analytischen Urteilen und anderen Ideen Kants beschäftigen, möchte ich mit einem praktischen Beispiel beginnen. Es verdeutlicht das prinzipielle Problem, um das es Kant und anderen Philosophen geht: Wenn wir ein grünes Blatt oder einen roten Ball sehen, dann sagen wir: Das Blatt ist grün oder der Ball ist rot. So empfinden wir es auch. Das Grün empfinden wir als eine Eigenschaft des Blattes und das Rot als eine Eigenschaft des Balls. Für uns sind es ein grünes Blatt und ein roter Ball. Aber sind diese Farben, die wir wahrnehmen, wirklich Eigenschaften des Blattes und des Balls?
Philosophisch gesprochen: Hat das »Ding an sich«, also das, was wir als Blatt, und das, was wir als Ball wahrnehmen, wirklich diese Farbeigenschaften? Ist das Blatt auch dann grün, wenn wir nicht hinschauen? Ist der Ball auch dann rot, wenn wir ihn nicht ansehen? Sind die grüne und die rote Farbe also Eigenschaften, die etwas über den tatsächlichen Charakter der beiden Dinge aussagen? Oder entstehen die grüne und die rote Farbe durch die Art, wie wir sehen, und sind eigentlich Eigenschaften, die mehr über uns als über das Blatt und den Ball aussagen? Dass sich die Farben, die wir den Dingen zuordnen, mit anderen Augen ganz anders darstellen, kann man sich leicht am Beispiel der Bienen verdeutlichen. Bienen können im Gegensatz zu uns ultraviolettes Licht sehen. Rot hingegen existiert für sie nicht. Was für uns rot ist, ist für die Biene schwarz. Aber dafür sehen Bienen prachtvolle Farbmuster, die wir nicht erkennen können und bei denen wir nur eine einzige Farbe sehen.
Physikalisch ist es so: Unsere Farbwahrnehmung beruht auf der Wahrnehmung von Licht. Licht ist eine elektromagnetische Strahlung. Es kommt in verschiedenen Wellenlängen vor. Je nachdem, mit welcher Wellenlänge das Licht auf unsere Netzhaut trifft, werden sogenannte Farbrezeptoren aktiviert. Diese Farbrezeptoren lösen bei uns eine Farbwahrnehmung aus. Die Farben entstehen also in unserem Kopf und sind ein subjektiver Eindruck. Hat das Licht eine Wellenlänge zwischen 490 und 570 Nanometer, dann löst das bei uns die Wahrnehmung der Farbe Grün aus. Trifft Licht mit einer Wellenlänge zwischen 640 und 780 Nanometer auf unsere Netzhaut, dann wird damit der Schalter für »Rot« gedrückt und wir »sehen« rot.
Das Blatt ist in unseren Augen deswegen grün, weil es selber gar nicht grün ist. Was meine ich damit? Das Blatt kann die Wellenlängen schlucken (absorbieren), die Rot oder Blau entsprechen. Einzig die Wellenlänge zwischen 490 und 570 Nanometer kann das Blatt nicht verarbeiten. Sie wird abgewiesen und damit reflektiert. Wenn wir also das Blatt ansehen, dann trifft dieses reflektierte Licht auf unsere Netzhaut und wir sehen »grün«. Genauso ist es beim Ball. Er ist in unseren Augen deswegen rot, weil er das Licht im Wellenspektrum von Rot reflektiert. Man könnte sagen, wir ordnen dem »Ding an sich« genau die Farbe als Eigenschaft zu, die am allerwenigsten mit dem eigentlichen Charakter des »Dings an sich« zu tun hat. Denn es ist ja die Farbe, die das »Ding an sich« von sich abweist und zurück in die Umwelt reflektiert.
Man kennt das Prinzip der Farbwahrnehmung aus dem Physikunterricht. Es ist ein gutes Beispiel für eine fundamentale Frage, die weit über Farben und Sinneswahrnehmungen hinausgeht. Was können wir tatsächlich von uns selbst und von der Welt, in der wir leben, erkennen? Können wir unseren Sinnen und unserer Vernunft vertrauen oder spielen uns beide ein Theater vor, das mit der »wirklichen Welt« wenig oder gar nichts zu tun hat? Viele Philosophen haben über die Erkenntnismöglichkeiten und deren Grenzen nachgedacht, die mit unseren Sinneswahrnehmungen und unserer Vernunft verbunden sind. Bis in unsere Gegenwart prägend ist das Werk Immanuel Kants.
Kant rückte die Gesetzmäßigkeiten der Vernunft und ihren Zusammenhang mit den Erkenntnismöglichkeiten der Wirklichkeit ins Zentrum seiner Metaphysik. Die Metaphysik ist der Zweig der Philosophie, der sich mit den Dingen beschäftigt, die »hinter« den Dingen stehen bzw. zu vermuten sind. Die Metaphysik sucht also nach den großen und letzten Wahrheiten. Kant zog es bei dieser Suche nicht hinaus in die Welt. Vielmehr machte er das Instrumentarium, mit dem wir die Welt zu erkennen glauben, selbst zum Forschungsgegenstand. Er kehrte also erst einmal vor der eigenen Haustür und beschäftigte sich mit der menschlichen Vernunft und den menschlichen Wahrnehmungen. »Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten«. [2, S. XVI]
»A priori« ist ein Terminus, der bei Kant häufig vorkommt. Er meint damit ein Wissen, das unabhängig von konkreten Erfahrungen besteht. Also ein Wissen, das es schon »vorher« gibt, bevor wir irgendeine Sinneswahrnehmung oder Erfahrung einleiten. Kant hatte eine sehr genaue Vorstellung davon, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit man von einer »Erkenntnis a priori« sprechen kann. Doch dazu später mehr.
Jedenfalls bringt Kant mit seinem Zitat Folgendes auf den Punkt: Wir haben es mit den Erscheinungen der Dinge zu tun, nicht aber mit den Dingen an sich. Wir sehen den roten Ball so, wie er auf unserer Netzhaut erscheint. Wir wissen aber nicht, wie er aussieht, wenn wir nicht hinschauen. Die Erscheinungen, so wie sie sich uns darbieten, so wie sie in unserem Bewusstsein stattfinden, sind nach den Regeln unseres eigenen Erkenntnisvermögens aufgebaut. Das heißt, sie spiegeln in hohem Maße die Regeln unserer eigenen Wahrnehmung und Vernunft wider. Manche Autoren greifen diesen Gedanken auf und sagen: Das »Ding an sich« gibt es doch dann gar nicht. Denn das »Ding an sich« wäre die wahre Identität hinter der Erscheinung, so wie sie unabhängig von einem Beobachter existiert. Wir kennen aber nichts anderes als diese Erscheinungen, die in unserem Kopf entstehen. Alles das, was wir wahrnehmen, sei daher eine Art Illusion, die wir selbst produzieren. Das glaube ich nicht. Auch Kant meinte, dass es »ungereimt« sei, anzunehmen, »daß Erscheinung ohne etwas wäre, was da erscheint«. [2, S. XXVII] Ein anderes Argument für die Existenz des »Dings an sich« sei »der moralische Vernunftglaube, der, auf das Bewusstsein der Pflicht gestützt, von hier zum Unbedingten, das heißt zu Gott, Freiheit und Unsterblichkeit aufsteigt«. [3, S. 17]
1.2Kant und seine synthetischen Urteile a priori
Wie kann man nun aber wissen, welcher Teil unserer Wirklichkeitswahrnehmung nur eine Folge der Struktur unseres Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögens ist und welcher Teil unabhängig davon tatsächlich existiert? Kant unterscheidet analytische von synthetischen Urteilen. Analytische Urteile sind solche, die sich zwingend aus der Logik einer Aussage ergeben. Patzig definiert das so: »Ein Satz ist analytisch in einer Sprache S, wenn über seine Wahrheit entschieden werden kann allein aufgrund der Bedeutungsregeln von S und der Gesetze der Logik.« [3, S. 23] Ein einfaches Beispiel dafür ist der Satz: Alle Schimmel sind weiß. Aufgrund der Definition von Schimmel (Schimmel = weißes Pferd) folgt logisch, dass der Satz wahr ist. Denn er heißt im Grunde nichts anderes als: Alle weißen Pferde sind weiße Pferde. Demgegenüber sind synthetische Urteile solche, bei denen der Wahrheitsgehalt nicht anhand solcher immanent vorhandenen logischen Regeln entschieden werden kann. Kant spricht in diesem Zusammenhang auch von einem Erweiterungsurteil.
Читать дальше