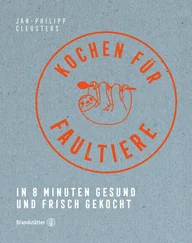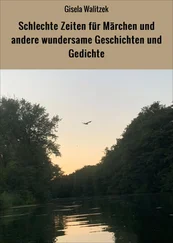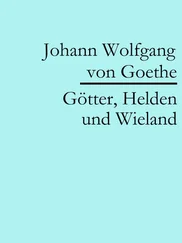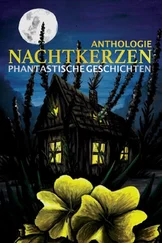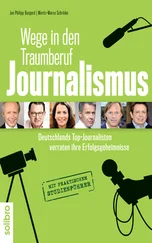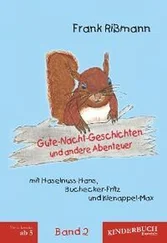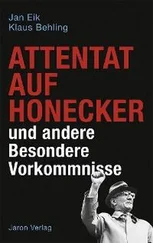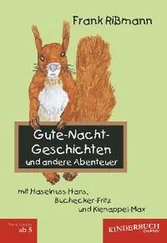Zwar wird Theseus König von Athen, aber auch er scheitert an dem Versuch, aus dem Status des Helden in den eines normalen Staatsoberhaupts zu wechseln; als er sich dann auf die väterlichen Güter zurückziehen will, gehören die längst einem andern, und er wird vom neuen Besitzer umgebracht. Das Ende des Herakles kennen wir in manchen Varianten. Euripides gestaltet es so: Nachdem er wider Erwarten heil aus dem Hades zurückgekehrt ist, überfällt ihn der Wahnsinn, er tötet Frau und Kinder, ein ans Töten Gewöhnter kann nicht ablassen.
Mit den Helden ist nichts anzufangen, wenn ihre Arbeit getan ist. Schlimmer: Sie können mit sich nichts anfangen. Am besten, sie kommen irgendwie um, bevor sie Schaden stiften und das in Gefahr bringen, was sich dank ihrer Taten in leidlicher Stabilität als durch Recht und Institutionen gefügtes Gemeinwesen etabliert hat. – Heldengeschichten sind zwar das, woran wir immer zuerst denken, die großen Kämpfe und strahlenden Siege, aber auch die Folgegeschichten gehören dazu, wo es keinen rechten Ort mehr für sie gibt – im schlimmsten Fall müssen sie erschlagen werden, damit das Leben – spitzen wir es zu: das zivile Leben, das erst als Folge ihrer Taten sich gefügt hat – weitergehen kann.
*
Man hat das Film-Genre des »Western« oft als eine moderne Neuerzählung der alten Heldengeschichten bezeichnet. Das ist nicht falsch; vor allem finden wir immer wieder den prekären Status des Helden. Der berühmteste Western High Noon beginnt mit – einer Hochzeit und den Vorbereitungen einer Hochzeitsreise. Der Sheriff (Gary Cooper) zieht sich mit Frau (Grace Kelly) in sein Privatleben zurück. Aber die Nachricht trifft ein, daß eine Verbrecherbande, deren Chef er einst ins Gefängnis gebracht hat, sich an ihm, vor allem: in »seiner« Stadt rächen will. Während der Kutschfahrt wird ihm klar, daß er seine Stadt nicht im Stich lassen kann, und kehrt um. Übrigens ohne mit der neben ihm sitzenden Frau darüber zu sprechen. Wieder angekommen, will er sich den Gangstern stellen (ihr Zug kommt um zwölf Uhr mittag an) und sucht nach Unterstützung. Nun ist er als Sheriff zuständig – er repräsentiert das Monopol auf die Gewalt –, aber er ist allein, der Sheriff ist als Einzelperson fast mehr Symbol der monopolisierten Gewalt als ihre reale Verkörperung. Er kann zwar Deputies ernennen, also gewissermaßen das Gewaltmonopol aufrüsten. rekrutieren kann er sie aber nicht, er ist auf Freiwillige angewiesen. Die findet er nicht. So hat er nur sich und seinen Revolver. Wir haben also die Situation, daß die Sicherheit der Stadt auf etwas angewiesen ist, das sie nicht nur nicht garantieren kann, sondern auch nicht will. Die Weigerung der Bürger, die gemeinsame Sache zu der eigenen zu machen, wirft die Stadt in den vorzivilisatorischen Stand zurück, in dem es Helden braucht. Jedoch so einfach ist das nicht. Der Bürger muß den Helden ja nicht spielen, für seinen Schutz hat er den Sheriff, und zum Deputy muß er sich eben nicht ernennen lassen. Der Bürger hat das Recht und Privileg, kein Held zu sein. Er darf auch ein Feigling sein. Wenn … ja, wenn es denn klar wäre, was da los ist, in welcher Zone der Gewalt und der Befriedung sich die Stadt befindet. Die Institution des Sheriffs (dieser Art) ist ja ein Notbehelf; sie markiert den Schritt hin zu einem ordentlich institutionalisierten Gewaltmonopol (mit ihm als Chef eines noch so kleinen Polizeiteams). Wo diese provisorische Institution nicht funktioniert (oder nicht funktionieren kann), wäre nach der Auffassung von Thomas Hobbes an jeden die Verantwortung für Sicherheit und Leben rückübertragen. Entweder sieht jeder, wo er bleibt, oder … es findet sich ein Held. So wird der Sheriff zum auf sich gestellten Helden. Und er ist erfolgreich – fast. Den letzten Schuß, der ihm das Leben rettet, gibt seine Frau aus einem Fenster ab. Sie ist Heldin an seiner Seite, was noch einmal unterstreicht, zu welcher Zone der Regellosigkeit die Stadt sich gewandelt hat, denn sie agiert ja nicht etwa als Deputy mit dem Stern am Brautkleid, sondern als Frau, die ihren Mann retten will, ganz privat. Am Ende steht die unterbrochene Fahrt in die Flitterwochen – und die Geste, mit der der Ex-Sheriff seinen feigen Mitbürgern den Stern vor die Füße wirft. Menschlich verständlich, aber, wie gesagt, es gibt ein Bürgerrecht auf Feigheit, und wenn er beschlossen hat, als Held zu agieren, so tut er das auf eigene Verantwortung und nicht einmal mehr als Vertreter der Stadt, sondern eben als Held, und das heißt nur für sich allein.
Ein Held steht nämlich nicht für das »Gute« (was immer das sein mag), sondern nur für sich und allenfalls seinen Ruhm. Als Gary Cooper die Kutsche wendet und seiner Frau nicht sagt, warum, kappt er die bürgerlichen Bande. Er kündigt die Pflichten aus dem Bund auf, den er eben geschlossen hat, und kehrt, wie sich zeigen wird, auch nicht als Pflichtbewußter zurück, sondern als einer, der nicht feige sein will . Auch er muß ja nicht. Wenn er keinen Deputy findet, ist er nicht gehalten, ein Selbstmörder zu werden, denn ultra posse nemo obligatur.
*
Helden sind nicht nur auf sich selbst gestellt, sie agieren auch nicht im ideellen Dienste von irgend etwas. Auch Wilhelm Tell hat nicht die Schweiz befreit, sondern sein Händel mit Geßler ist ausschließlich privat, mag eine Eidgenossenschaft, zu der er, wie Schillers Stück herausstreicht, nicht gehört, auch von seinem Agieren profitieren.[6] Mag Schiller seinen Tell vor allem als sorgenden Hausvater präsentieren, so führt doch auch bei ihm kein Weg daran vorbei, ihn als (wenn man so will: phallischen) Narzißten zu porträtieren. Seine Armbrust trägt er so notorisch mit sich herum, daß er im Personenverzeichnis als Tell-mit-der-Armbrust figuriert. Tell tötet Geßler wie ein wildes Tier, das die Herden bedroht, aus dem Hinterhalt. Achill gehört zwar nicht zu den Zivilisationshelden, er ist ein Krieger, aber seine Heeresfolge ist auf keine soziale Verpflichtung gestellt. Er betont das selbst im Streit mit Agamemnon: Er habe keinen Streit mit den Troern, sie hätten ihm nichts getan, er wolle Agamemnon helfen, seine Ehre wiederzuerhalten. Umso ehrempfindlicher ist er, als Agamemnon Achills Ehrengabe – die schöne Briseis – beansprucht, weil er die seine zur Besänftigung Apolls zurückzugeben bereit ist. Achill ist der Krieg als solcher so gleichgültig, daß er achselzuckend in Kauf nimmt, daß sein Rückzug aus der kämpfenden Truppe das Heer in Schwierigkeiten bringt, auch Versuche, ihn der gemeinsamen Sache wieder gewogen zu machen – Rückerstattung der genommenen Beute, kompensatorische Geschenke – weist er zurück. Maß des Akzeptablen ist für ihn allein sein verletztes Ehrgefühl. Und als er in den Krieg wieder eintritt, tut er das, um den Tod seines Freundes Patroklos zu rächen und sich vor anderen auszuzeichnen. Achill, so kann man pointieren, handelt nicht in einem sozialen Raum, er schafft sich einen eigenen, gewissermaßen vorsozialen, den die anderen zu akzeptieren gezwungen sind, und aus diesem Grund kann man ihn einen Helden nennen, einen spätzeitlichen.
Dietrich von Bern ist auch ein spätzeitlicher Held. Er tut noch, was ein Held tut, beseitigt allerlei Riesen, aber sonst ist er König. Ein geachteter, aber nicht immer ein vorbildlicher. Auch hinsichtlich seines Status als unüberwindlicher Held ist er nicht ganz stabil. Den Kampf mit seinem späteren Gefolgsmann Wittich verliert er beinahe wegen dessen besserer Bewaffnung (Wittich ist der Sohn des berühmten Schmiedes Wieland), und um diese Scharte auszuwetzen, macht er sich erneut auf, um einen Outcast zu stellen, und ist wieder nur knapp erfolgreich. Es ist etwas wie eine Regression. Da dieser Waldläufer ihn, Dietrich, zum Kampfe hatte stellen wollen, hätte er sich comme il faut zur Berner Burg begeben müssen und dort dem König den Kampf antragen. So aber geht Dietrich ins Ungebahnte und behauptet sich nur mit Mühe.
Читать дальше