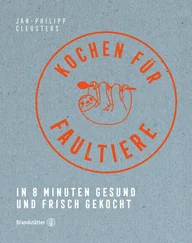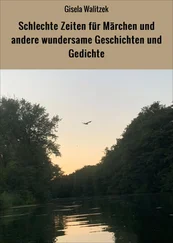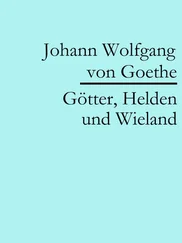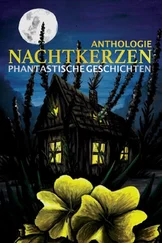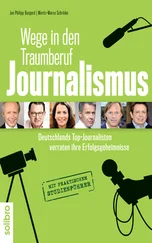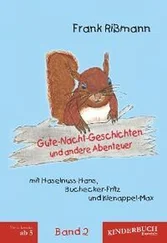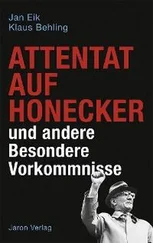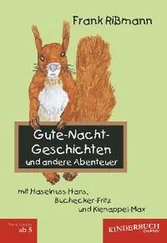Interessant ist, daß es in dieser Serie ab und zu (und häufiger, wie mir scheint, als die Wahrscheinlichkeitsrechnung erlaubt) vorkommt, daß Chirurgen und Chirurginnen ihre eigenen Verwandten oder Partner auf dem Operationsplan vorfinden. In der Regel wollen sie – gegen alle Professionalität – selbst operieren, worauf dann der Klinikchef einschreiten muß (»Sie wissen doch …«). Klar: dem betroffenen Operateur könnte die Hand zittern, wenn er seine eigene Frau aufschneiden soll und wenn es an ihm hängt, ob er ihr Leben retten kann oder nicht. Wäre die Serie etwas weniger sentimental, könnte auch die Ambivalenz gegenüber dem geliebten Objekt zur Sprache kommen sowie der Umstand, daß nur der ein guter Chirurg ist, der gerne Körper aufschneidet (ich jedenfalls würde mich keinem Chirurgen anvertrauen, der kein Vergnügen an seinem Beruf hätte). Wichtiger aber scheint mir, daß durch den Verwandten auf dem Tisch die narzißtische Steuerung der Berufsausübung gestört wird – die Objektbeziehung (wie immer sie auch beschaffen sein mag) kommt ihr in die Quere. Der Chirurg muß sich vor zu großer Identifizierung – in Liebe oder Haß – mit seinem Patienten hüten. Er muß stolz auf die Präzision seiner Arbeit sein – und damit auf sich. Das Signal dafür ist in der Serie, daß die Chirurgen und Chirurginnen einander dauernd wechselseitig bestätigen (auch wenn sie einander zuvor in den Haaren gelegen haben), wie gut sie sind (»Ausgezeichnete Arbeit, Frau Kollegin!«).
Aus dem Nähkästchen geplaudert: Ich habe einmal ein kleines Buch geschrieben, das in die öffentliche Debatte, ob unter bestimmten Umständen die Wiedereinführung der Folter legitimierbar und mit dem Grundgesetz-Artikel I,1 vereinbar sei, eingreifen sollte. Das Buch wurde, obwohl zu Teilen rein juristisch argumentierend (was sich Juristen von einem, der nicht vom Fach ist, selten gefallen lassen), positiv angenommen. Nun ergab es sich, daß ein führender Jurist dieses Landes, mit dessen Ausführungen ich mich kritisch beschäftigt hatte, irgendwann einen Aufsatz schrieb, der mir eine Korrektur seiner früheren Ansichten auszudrücken schien. Ich merkte nun, daß mich das nicht nur von der Sache her interessierte, sondern daß mir die Phantasie – mehr war das nicht –, diese Veränderung sei auf Grund der Lektüre meines Büchleins erfolgt, außerordentlich gefiel. Nicht nur: die Situation hat sich verbessert, sondern: ich habe sie verbessert. Ohne solche Phantasien – die ich mir natürlich nicht immer bewußt gemacht habe, die man sich generell nicht immer bewußt macht – hätte ich das Buch gar nicht geschrieben. An einer Sache, die man für gut hält, bloß mitzuwirken, ist in der Regel kein zureichender Grund zum Handeln, sondern man will einen entscheidenden Beitrag leisten. (Und die Wirklichkeit kommt dem narzißtischen Antrieb entgegen: Da man, handelnd, keinen großen Überblick hat, sondern nur den Ausschnitt der Welt sieht, in dem man gerade tätig ist, vergrößert sich das eigene Tun notwendigerweise. In der Notaufnahme kann so – bei aller nervtötenden Routine – jeder angelegte Verband zu einem Beitrag zur Rettung der Welt werden. Und für den, der den Verband bekommt, ist das auch so.)
Worauf das hinausläuft, ist das Folgende: Der Held ist jemand, der seinen Narzißmus in einem Maße lebt, das der Alltag normalerweise nicht zuläßt (und vor allem: uns nicht gestattet, und das von uns im Alltag selten anderen gestattet wird). Der Held ist jemand, der dennoch Anerkennung, Bewunderung, Liebe erhält, ja zum Übermenschen (»Heros«) verklärt wird. Nicht trotz , sondern wegen seines Narzißmus, dessen Ausleben wir in unschuldiger Bewunderung ansehen können und der in uns die besagte Saite zum Klingen bringt, weil er einen a-sozialen Trieb als Antrieb für Handlungen nützt, die sozialen Tugenden entsprechen. Man könnte von einem »schuldlosen Narzißmus« sprechen, aber es ist wohl eher unsere Bewunderung, die uns schuldlos vorkommt, weil wir meinen, die sozial produktiven Tugenden zu bewundern, wo wir doch sein wollen wie der, der sich über die Welt der anderen erhebt. Wäre das anders, wir würden eben die Resultate schätzen, nicht die Taten und den, der sie vollbracht hat, bewundern. Die Resultate repräsentieren das gemeinschaftliche Gute (wenn wir uns – kulturell – einig sind, was das ist, was, siehe oben, oft nicht der Fall ist), Helden das über die Gemeinschaft sich Erhebende, die extrem gesteigerte, also seltene Form des Handelns für das Allgemeine – und so gibt es immer eine Kluft zwischen dem, was wir schätzen, weil es dem Allgemeinen zugute kommt, und der Bewunderung für den Helden.
Susan Neiman hat in ihrem Kapitel über die »Heroes of Enlightenment« Sätze zitiert, die das sozial Produktive der narzißtischen Antriebe dokumentiert. Sarah Chayes: »I sometimes feel I’m laying my body down as a bridge over the chasm that Bush and Bin Laden are trying to open.« Der nächste Satz lautet: »Not that I suppose my efforts are large enough to make a difference.«[24] Wäre dieser zweite Satz nicht, der erste wäre purer Größenwahn. Aber wäre der erste nicht, der zweite wäre pure Resignation. Es braucht das Realitätsprinzip des zweiten Satzes kombiniert mit der narzißtischen Phantasie des ersten, um etwas auszurichten – und um unsere Bewunderung zu erzeugen. – »I don’t want to act for the record!« schreit Shulman einen Mitarbeiter an und dementiert expressis verbis den Helden-Status (oder das Bedürfnis, nach ihm zu streben). Doch dann folgt nicht etwa: »This misery has to come to an end«, oder: »We have to help to end this misery«, sondern: »I just want this misery to end.«[25] Es braucht solche Gedanken, solche Sätze. »You are not going down there to try to be heroes […] You have a job to do«,[26] sagt Bob Moses zu den weißen Freiwilligen, die bei der Kampagne in Mississippi mitmarschieren wollen. Das war nötig, um die Aktionsbereitschaft einzuhegen. Gleichzeitig wird berichtet, daß Moses ein hinreißender Redner war, dem es gelang, Martin Luther King als Redner zu deklassieren. Niemand ist ein guter Redner, der sich nicht als Redner genießt.
Ohne unsere Sehnsucht, unseren Narzißmus bewundern zu lassen (und dieses in der Identifikation zu phantasieren), gäbe es keine Helden. »Es erscheint«, schreibt Freud, »[…] daß der Narzißmus einer Person eine große Anziehung auf diejenigen anderen entfaltet, welche sich des vollen Ausmaßes ihres eigenen Narzißmus begeben haben […] der Reiz des Kindes beruht zum guten Teil auf dessen Narzißmus, seiner Selbstgenügsamkeit und Unzugänglichkeit, ebenso der Reiz gewisser Tiere, die sich um uns nicht zu kümmern scheinen, wie der Katzen und großen Raubtiere, ja selbst der große Verbrecher und der Humorist zwingen in der poetischen Darstellung unser Interesse durch die narzißtische Konsequenz, mit welcher sie alles ihr Ich Verkleinernde von ihm fernzuhalten wissen.«[27] – Man bedenke, wie diese Charakteristik des Narzißmus – Selbstgenügsamkeit, Gleichgültigkeit – der klassischen Definition des »Erhabenen« entspricht.
Wäre das anders, könnten wir keine Helden bewundern, die Dinge tun, die uns moralisch eigentlich nicht in den Kram passen oder die wir wenigstens selber nicht tun würden. In den Rocky -Filmen muß der Protagonist von seinem Trainer (und ganz zuletzt, als letzter Anstoß, von seiner Frau) narzißtisch aufgerüstet werden, er muß nur noch den Kampf und den Triumph am Ende sehen, nicht mehr die Familie oder was auch immer. In Rocky IV kommt es dahin, daß sein Gegner, ein linientreuer Sowjetbürger, der für die Glorie des Vaterlands der Werktätigen in den Ring steigt, am Ende seinem Publikum zuruft: »Ich kämpfe für mich! – für mich!«, was den oberflächlichen politischen Sinn hat, daß der im Kollektiv Großgezogene endlich erkennt, daß jeder seines eigenen Glückes Schmied ist, aber vor allem bedeutet, daß er ohne Mobilisierung seiner narzißtischen Energien nicht durchhalten kann. Rockys Ecke rüstet dessen Grandiosität mit Appellen an seine Aggressivität auf: »Schlag den russischen Affen tot!« Nach dem Kampf folgt, natürlich, ein Appell für Frieden und Völkerverständigung, und Gorbatschow applaudiert, aber das ist Zugabe.
Читать дальше