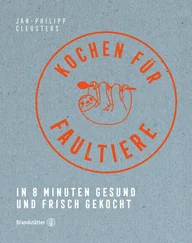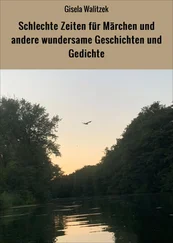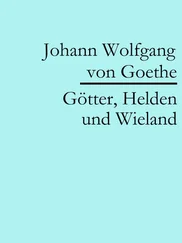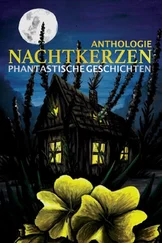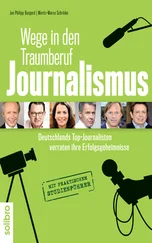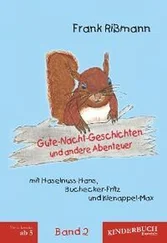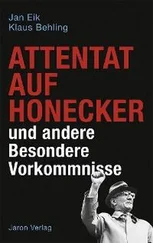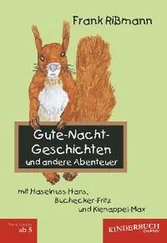Daß Achill Briseis nicht bekommt, stört ihn nicht wegen des verlorenen Objekts, sondern wegen der Kränkung. In Patroklos liebt er den Achill-Look-alike. Die Mutter stabilisiert ihn, indem sie ihn tröstet und indem sie seinen Narzißmus anheizt – auf mütterlich ambivalente Weise: Sie möchte einen Helden-Sohn und gleichzeitig einen, der sich nicht in Gefahr begibt. Am Ende führt Achill nicht zu Ende, was er begonnen hat. Er kämpft nach dem Sieg über Hektor den Kampf nicht bis zum Sieg über die Stadt, die er doch entscheidend geschwächt hat, er erobert nicht Troja an der Spitze des griechischen Heeres, sondern wendet sich ab, um Patroklos, seinem Alter ego, eine Zeremonie der Verklärung zu widmen und um den Leichnam des Hektor zu schänden. Aus dem latent a-sozialen Helden wird ein anti-sozialer Berserker .
Helden kann es nicht geben, ohne daß ihr Ich in ungewöhnlichem Maße ihre Person bestimmt. Daß man sich an seinen Namen erinnern werde, sagt Achill in dem Film Troja , und Susan Neiman sagt über David Shulman und die anderen Friedensaktivisten, die palästinensischen Familien helfen, ihre agrarische Subsistenz aufrechtzuerhalten: »they will remember who helped them stay«.[28] Helden kann es nicht geben, wo sie nicht als Personen bewundert werden. Und Helden kann es nur geben, wenn sie jene narzißtische Saite in uns zum Klingen bringen, die kräftig anzuschlagen wir normalerweise nicht die Gelegenheit haben oder eben allenfalls in der Phantasie, »something outside the usual routine« zu tun.
Ich habe zu Beginn den Begriff des Helden aus einer Parodie des Nibelungenliedes zu gewinnen gesucht – nun endlich zu John Lennon. »Working Class Hero« beginnt mit der eingangs zitierten Zeile:
As soon as you’re born they make you feel small
und geht weiter mit:
By giving you no time instead of it all
Till the pain is so big you feel nothing at all
und dann folgt der Refrain, der durch den Sound und den Vortrag so klingt, als wäre tatsächlich nichts plausibler als das:
A working class hero is something to be.
Das ganze Lied ist eine Aufzählung von Demütigungen, Schmerzen und die Schilderung einer Abrichtung hin zu einem funktionierenden, ja auch durchaus erfolgreichen Gesellschaftsmitglied –
When they tortured and scared you for twenty-odd years
Then they expect you to pick a career
When you can’t really function you’re so full of fear
A working class hero is something to be.
Was ist das? Der Held der Arbeiterklasse als Ausweg aus einer demütigenden Kleinbürgerkarriere? Redet so ein Held der Arbeiterklasse, vielleicht im Rückblick? Redet so ein Held? Nein, so reden Helden nicht, die einen nicht wie die andern. So reden die, die Helden sein wollen und denen die Phantasie so weit durchgeht, daß sie meinen, sie wären wirklich welche. John Lennon war ein wunderbarer Musiker (einer der besten Rock’n’Roll-Sänger, die es gegeben hat, hören Sie sich noch einmal »Twist and Shout« an), der allerlei erfreuliche und unerfreuliche Streiche in der Öffentlichkeit gespielt hat, aber »a working class hero«? Wollte er selbst das auch sein? »Just follow me« – man stelle sich das eingangs beschriebene Bild vor Augen: gereckter Arm, geballte Faust, Ballonmütze – ein Working-class-hero-look-alike. Kein Achill, nicht einmal ein Patroklos. Aber ein zeit seines Lebens narzißtisch Übersteuerter, bis hin zu seiner Selbstabschließung im New Yorker »Dakota«, gewiß in der Meinung, die Welt drehe sich ohne ihn wenigstens anders – »singe, Göttin, den Zorn …« –, einer Selbstabschließung, aus der er (wie Montaigne aus seiner Exklusion mit den Essais , in denen er »Ich« sagte wie keiner vor ihm) mit einigen betörend schönen Liedern, besser aussehend denn je, wieder auftauchte und in seinem letzten Interview seinen früheren Allüren den Laufpaß gab – und dann wurde er erschossen, und der gewaltsame Tod der großen Narzißten verklärt sie immer, er mag so banal sein wie der Autounfall von Albert Camus.
Doch einen Augenblick noch. Der Song vom »Working Class Hero« ist doch eigentlich eine deprimierte Selbstauskunft. Von der Pose mit Ballonmütze und geballter Faust bleibt nur das Eingeständnis, woher es kommt. Das Geständnis, daß auf der Couch des Analytikers gemacht werden könnte, Lennon aber der ganzen Welt macht, das Geständnis, daß da einer so klein gemacht worden ist, daß er sich selbst verloren hätte, hätte ihn nicht eine Phantasie aufgefangen. Er habe sich immer gewundert, hat er später erzählt, daß niemand bemerkt habe, daß er ein Genie sei. Lennon hat übrigens Auskunft gegeben, wie das alles anfing. Seine Mutter hatte ihn früh bei seiner Tante in Pflege gegeben, von deren Haus er auf das Waisenhaus, das den Namen »Strawberry Fields« trug, blickte, und als sich die Mutter wieder um den Halbwüchsigen kümmern wollte, wurde sie von einem betrunkenen Polizisten totgefahren. Das Lied »Mother« mit seiner Refrain »Mother don’t go / Daddy come home!«, gesteigert bis zu einem heiseren Schrei, gibt deutlicher Auskunft über frühen und schrecklichen Objektverlust (wie man so sagt) als viele Texte anderer Leute, die auch von so etwas handeln.
»Mother don’t go / Daddy come home!« – der Stoff, aus dem die Helden sind? Der Stoff, mit dem unsere Helden-Phantasien befeuert werden? Manche Helden gewiß, manche Phantasien auch. Bei manchen wird die Unmöglichkeit, die Leere zu füllen, das Scheitern der Kompensation zu mörderischer Wut. Das sind vielleicht die, von denen die großen Geschichten erzählen. Das muß aber so nicht sein. Entscheidend ist, was die Helden – mit solchem Hintergrund oder ohne ihn – aus sich machen. Und was sie uns bedeuten, hängt an unseren narzißtischen Bedürfnissen – und unseren zivilisatorischen Präferenzen.
Dietrichs mißlungene Brautwerbung
Über Heldengeschichten
»Dietrichs mißlungene Brautwerbung« hieß eine Zwischenüberschrift der Nacherzählung der Sagen um Dietrich von Bern in Gerhard Aicks Deutschen Heldensagen . Ich mochte die Passage nicht. Einmal gehörte eine solche Brautwerbung – sie findet durch einen Abgesandten statt, einen »Rosenkavalier« sozusagen – nicht in eine »Heldensage«, wie mir damals schien, und zweitens schon gar nicht als mißlungene. Aber ignorieren konnte ich sie nicht – sie brachte in den melancholisch-endzeitlichen Ton, der die Dietrich-Sage ausmacht und ihre literarische Qualität begründet, einen privaten, gleichsam bürgerlich-traurigen Zug hinein, der – das weiß ich nun – unerläßlich dazugehört. »Dietrichs mißlungene Brautwerbung« – ich habe diesen Zwischentitel nie vergessen, sprechen wir über ihn, wenn wir von »Helden« sprechen.
Worum ging’s dabei? Dietrich von Bern, der, wie die Sage immer wieder sagt, größte der Helden seiner Zeit, ein Mann, der eine seltsam intermittierende Heldenbiographie hat, beschließt irgendwann zu heiraten, sucht – das heißt, läßt suchen – nach einer passenden Frau, und ihm wird »Hilde von Bertangaland« – ich folge hier der Fassung von Therese Dahn – genannt, die Tochter von König Artus. Er schickt einen Werber, Herburt, der an den Artushof reist, sich in Hilde verliebt, seinem Auftrag aber treu bleibt und diesen ihr vorträgt. Sie will wissen, wer und wie Dietrich denn sei, und ich zitiere:
»Was für ein Mann ist Dietrich?«
»Er ist der größte Held der Welt und der mildeste[1] Mann.«
»Vermagst du wohl, Herburt, mir an die Steinwand hier sein Antlitz zu zeichnen?«
»Das kann ich leicht: und jeder, der Dietrich einmal sah, würde ihn an diesem Bild erkennen.« Und er zeichnete ein Antlitz an die Wand, groß und schrecklich.
»Sieh, hier ist’s, Jungfrau: und so ein Gott mir helfe, – König Dietrichs Antlitz ist noch schrecklicher.«
Читать дальше