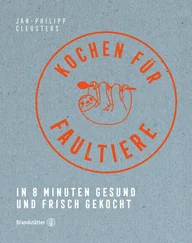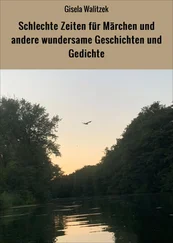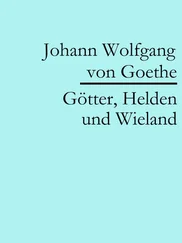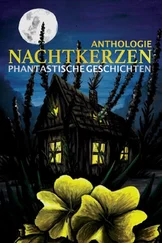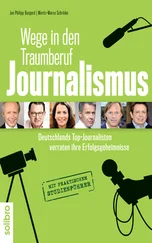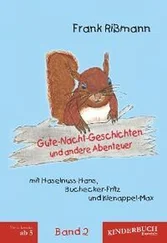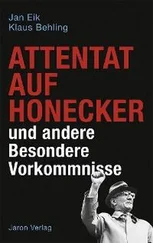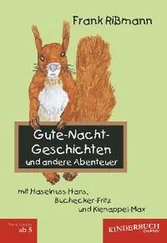Der Western hat für die Verfassung des Helden ein Redensart gewordenes Schlußbild gefunden: Er reitet – allein – in die untergehende Sonne, sprich: in den Westen, wo die Zivilisation noch nicht hinreicht. Dort, wo er heldenhaft gehandelt hat, gehört er nun nicht mehr hin. Er hat die Bedingungen geschaffen, daß dort etwas anderes gebaut werden kann, in dem er dann nicht mehr gebraucht wird und im Zweifelsfall aneckt oder die Leute erschreckt. James Fenimore Coopers »Lederstrumpf« Natty Bumppo, wiewohl kein Held im Sinne der großen Taten, aber ein Virtuose des siegreichen Agierens im Ungebahnten, landet in der Stadt der Ansiedler am Susquehanna wegen Verletzung der Schonzeitbestimmungen kurzzeitig im Gefängnis und verläßt dann die Zivilisation in Richtung Westen, wo nur Büffel sind und unbesiegte Reiterstämme (und manchmal ein Treck auf der Durchfahrt). Dort wird er sterben, ohne eine andere Spur zu hinterlassen als die Geschichten über ihn.[7]
*
In Der Mann, der Liberty Valance erschoß , dem nach meiner Meinung klügsten (und schönsten) Film seines Genres, kommt ein Rechtsanwalt namens Stoddard (James Stewart) in eine Grenzstadt – eine Stadt an der Grenze zwischen dem »Draußen«, wo noch das Recht von Faust und Feuerwaffe gilt, also keines, und dem einigermaßen zivilisierten Hinterland. Der Sheriff dieser Stadt kann und will sich gegen die sporadisch einbrechende Bande des Desperados Liberty Valance nicht wehren. Der Anwalt versucht, das Gesetz gegen die Übergriffe des Straßenräubers, dessen Opfer er gleich bei seiner Ankunft geworden ist, in Stellung zu bringen, aber mehr als Rhetorik kann es nicht sein, und die Zeitungsredaktion wird prompt verwüstet, das Schild seiner Ein-Mann-Kanzlei bald abgerissen, und so beginnt er irgendwann, sich das Revolverschießen beizubringen, das heißt, sich darauf vorzubereiten, das »Gesetz in eigene Hand zu nehmen«, wie man sagt, also außerhalb des Gesetzes zu handeln bzw. sich auf den Zustand vor der Einführung des Gewaltmonopols einzulassen. Die Gegenfigur des Anwalts ist der außerhalb der Stadt lebende eigentliche Held Tom Doniphon (John Wayne (nicht im Sinne der ersten dramatis persona, das ist James Stewart)), der dem Anwalt klarmacht, daß die Welt, die er vorfindet, noch nicht die ist, in der es Anwälte braucht, und der ihm auch klarmacht, daß er nicht der sein wird, der Liberty Valance erschießen kann. Es kommt (ich kürze das alles sehr ab, ich bitte um Verzeihung) dennoch zum Showdown – Valance wird erschossen, Stoddard hat geschossen. Damit beginnt die öffentliche Karriere des Anwalts als »der Mann, der Liberty Valance erschoß«, die ihn bis in den Washingtoner Senat führt. Die Geschichte wird als Rückblende und Erzählung Stoddards an Tom Doniphons Sarg erzählt. Er will ihm mit seiner Frau, die damals das Leben mit ihm dem mit Doniphon, dem sie eigentlich versprochen schien, vorgezogen hatte, das letzte Geleit geben. Stoddard berichtet seinen Zuhörern, darunter einem Journalisten, der die Geschichte von der Heimkehr des Senators an den Schauplatz seiner Ruhmestat schreiben will, daß ihm Doniphon einst die wahre Geschichte erzählt habe: Er habe in dem Augenblick, als Stoddard abdrückte, Valance aus dem Dunkeln erschossen. Der Anwalt habe keine Chance gehabt, ein Duell wäre Mord gewesen, und so habe er eben den Desperado erschossen – auch das war Mord.
Der Journalist will die eigentliche Geschichte nicht schreiben und der Öffentlichkeit mitteilen, der Westen brauche diese Heldengeschichten für seine Identität, Stoddard sorgt dafür, daß Doniphon mit seinen Stiefeln begraben wird, und fährt zurück nach Washington – in den Osten, in die andere Richtung. In der Bahn überlegt er mit seiner Frau, ob sie nicht Washington verlassen und in den Westen – den nunmehr zivilisierten notabene, es geht um eine Rentneridylle – zurückkehren, aber der Billetkontrolleur unterbricht die Gedanken, er will ihm die Hand drücken, ihm, dem »Mann, der Liberty Valance erschoß«. So fährt Stoddard denn zurück nach Washington – er ist übrigens nicht nur Senator, sondern war auch Botschafter in London, eine Anspielung auf Thomas Jefferson – zusammen mit seiner Frau, die der einsam gestorbene Tom Doniphon einst liebte. Helden sterben nicht verheiratet, und pensioniert werden sie auch nicht.
*
Heldengeschichten sind Geschichten, in denen sich Gesellschaften ihre Vergangenheiten ausmalen. Es sind keine »Erinnerungen«, kein »kollektives Gedächtnis«, ohnehin eine verunglückte Metapher. Es sind fiktive Geschichten, in denen man sich Zeiten ausmalt, in denen es noch hoch herging. Über Theseus kann man keine Dokumentarreportage mehr verfassen, über Wyatt Earp schon. Die ist dann interessant, aber keine Heldengeschichte mehr. Die TV-Serie Deadwood hat versucht, einen Grenzort, eben jenes »Deadwood«, das es tatsächlich und mit diesem Namen gab – nicht mehr ungebahnter Westen (»Indianerland«) und noch kein Teil der Vereinigten Staaten und also tatsächlich gesetzlos –, abzubilden, und sie ist (wenigstens in der ersten Staffel, die zweite und dritte sind weniger gelungen) ein faszinierendes Stück gedankenspielender Soziologie geworden, das mit der Frage umgeht, wie sich in einer noch nicht institutionenverfaßten Gemeinschaft jene absehbaren Machtroutinen herausbilden, die es braucht, um für ihre Mitglieder das herzustellen, was man »soziales Vertrauen« nennt, also ein geteiltes Prognosevermögen, wie es denn gemeinsam »weitergeht«. Im Falle Deadwoods sind es gewaltgestützte Routinen, gewiß, aber doch nicht allein gewalt basierte . Erstaunlich (und plausibel), wie viel Aushandlungssache ist. Für Helden ist auch dort kein Platz mehr. Der Sheriff, den der mächtigste Mann am Ort, der den historischen Quellen entnommene Bordell- und Saloon-Besitzer Swearengen, gewissermaßen anstellt, damit der Ruf Deadwoods als gesetzloser, aber doch wegen Goldvorkommen attraktiver Ort nicht dazu führt, ihn in die USA einzugliedern und ihm den Rechtsstaat zu verpassen, ist keiner, der aufräumt (obwohl er den klangvollen Namen »Seth Bullock« trägt), sondern bastelt vielmehr daran, die gesetzlosen (vorgesetzlichen) Deadwood-Routinen etwas mehr an das anzupassen, was östlich davon Routine unter dem Gesetz ist: So gehört zu seinen ersten selbstverordneten Aufgaben, die Toten, die zuweilen herumliegen, manchmal gegen Bares dem Chef des Chinesenviertels übergeben werden, der mit ihnen die Schweine füttert, auf einem Friedhof mit ein wenig Bibellesung unter die Erde zu bringen. Ja, die Zivilisation fängt vielleicht dort an, wo man weiß, wo die Toten liegen. Mit Realismus kann man keine Heldengeschichten erzählen.
Heldengeschichten sind Geschichten, in denen das erzählt wird, was »hinter uns« liegt: Gott sei Dank! Wir malen uns gern Helden aus, weil wir gerne in der Phantasie Abenteuer erleben, die uns die Wirklichkeit erspart. Es ist wie bei der Marlboro-Reklame, als es die im Kino noch gab. »Der Geschmack von Freiheit und Abenteuer«? – achwo, vielleicht ein kleines Kälbchen auf dem Arm, dann Feierabend, Gartengrill, Bier, ’ne Zigarette. – Schon Ilias und Odyssee sind Spätzeitgeschichten. Achill zeigt, eine wie prekäre Existenz ein narzißtischer Heerführer ist, der prätendiert, aus eigenem Heldenrecht zu agieren, und Odysseus gelingt es zwar, dem Riesen Polyphem, nachdem der einige seiner Gefährten gefressen hat, mit Hilfe der Überlebenden sein eines Auge auszustechen, aber er ist kein Held, weil er stärker ist – kein Herakles, kein Theseus, kein Dietrich –, sondern weil er intelligenter ist, meinethalben schlauer, weil er postheroische Tugenden erfolgreich repräsentiert. Am Ende kommt er nach Hause und – ist wieder König und hat seine Frau wieder. Kein Held.
Kleist gibt uns in seinem Prinzen von Homburg einen, der ein Held sein möchte und eine Frau kriegen. Er schlägt sich in der Schlacht zwar gut, aber befehlswidrig, wodurch er zwar eine Art heldenhafte Draufgängerei an den Tag legt, aber, weil man in kriegerischen Dingen keine Helden braucht, sondern ein koordiniertes Vorgehen, den Schlachtplan vermasselt. Am Ende steht etwas wie eine Scheinhinrichtung und eine Abkehr von individuellen Ambitionen: »in den Staub mit allen Feinden Brandenburgs!« Das Stück ist auch ein Wink: Du sollst dir keine Lorbeerkränze winden, heutzutage gehört der Lorbeer in die Küche. – Ernst Jünger inszeniert seine Kriegserlebnisse nicht als neubeatmete Heldengeschichten, seine Phantasie ist der entindividualisierte Held (beschreiben tut er den durchhaltenden und den traumatisierten Soldaten).
Читать дальше