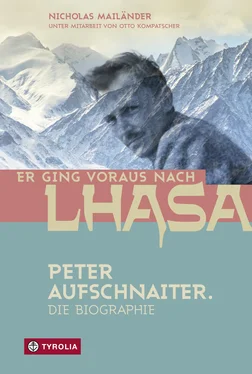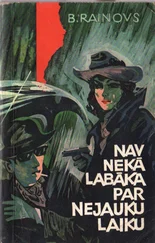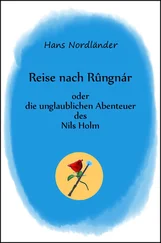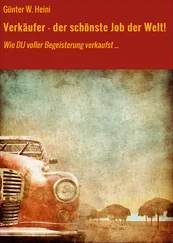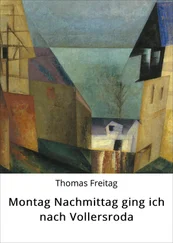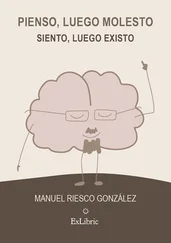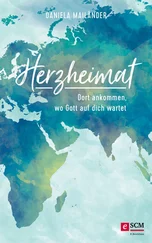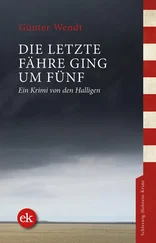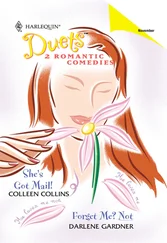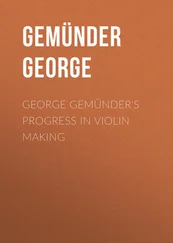1 ...6 7 8 10 11 12 ...23 Im Winter 1921/22 dürfte Aufschnaiter wiederholt daheim in Kitzbühel gewesen sein, von wo aus er auf die verschneite Goinger Halt im Kaiser gestapft ist und mit Skiern den Kamm Ehrenbachhöhe – Großer Rettenstein – Falsenhöhe überschritten sowie das Kitzbüheler Horn und das Kitzsteinhorn erklommen hat. Im Sommer 1922 suchte „Petrus“ Aufschnaiter – wie er im AAVM-Tourenbericht genannt wird – nicht nur die Hörsäle und Übungsräume der TH München auf, sondern fand auch noch reichlich Zeit, sich in den unterschiedlichsten Gebirgsgruppen herumzutreiben. Die in den Publikationen des AAVM veröffentlichten Fahrtenberichte belegen, dass die bisweilen geäußerte Vermutung falsch ist, Peter Aufschnaiter habe nach seinem schweren Sturz in der Fleischbank-Ostwand das extreme Klettern aufgegeben. Es dürfte kein Zufall gewesen sein, dass es ausgerechnet diese Fleischbank-Ostwand war, die als eine der ersten Touren in seinem Fahrtenbericht für das Jahr 1922 aufgeführt wird: Sich mit einer Niederlage abzufinden – darauf hatte Peter offenbar keine Lust. Zu den zahlreichen durchgeführten Touren zählten auch der schwierige Campanile Basso – die „Guglia“ – in der Brenta und mit der Westverschneidung des Predigtstuhls seines Vereinskameraden Emil Gretschmann auch eine der damals schwierigsten Kletterfahrten im Wilden Kaiser.
Auf derselben Doppelseite, auf der Aufschnaiters Fahrtenbericht abgedruckt ist, finden sich auch die Tourenlisten zweier ebenfalls neu aufgenommener Mitglieder des AAVM, denen namhafte Besteigungen in den Schweizer Hochalpen geglückt waren: Paul Bauer und Julius „Jules“ Brenner. Beide sollten in Peter Aufschnaiters Leben noch eine wichtige Rolle spielen. Ihnen war im Sommer 1922 die Besteigung von nicht weniger als zwölf Viertausendern im Wallis gelungen, darunter sehr anspruchsvolle Berge wie das Matterhorn und die Dufourspitze des Monte Rosa! Diese Leistung ist noch beachtlicher, wenn man die Umstände bedenkt, unter denen diese Unternehmungen stattfanden. Die Bedingungen schildert Paul Bauer in eindrucksvoller Eindringlichkeit:
„Der Geburtsort unserer Auslandsbergfahrten ist das Isartal vor München. Freund Brenner und ich hatten uns einmal mittellos – 1922 in der Inflationszeit – dorthin zurückgezogen. […] Das Feuer lohte des Nachts, die Stadt, das ganze Deutschland, für das wir fünf Jahre lang jede Stunde zum Sturm anzutreten bereit waren und das uns nun so schrecklich fremd geworden war, das alles lag in unserem Rücken meilenfern […] Nahe war uns nur die Natur, unsere stets getreue Freundin, die uns so manchesmal mit einem goldenen Abendhimmel die schwersten Schlachttage, die bittersten Verluste hatte vergessen lassen […] Unsere Gedanken wanderten von einem Ende der Welt zum anderen und verweilten überall, wo Menschen im Kampf stehen mit der unberührten Natur; schließlich hefteten sie sich an den silbern schillernden Fluss vor uns, sie folgten seinem Lauf zu den Bergen, sie flogen von Gipfel zu Gipfel bis zu Fernen, die uns, den von einem Wall der Verleumdung, der Feindschaft, der Armut eingeengten Deutschen, damals unerreichbar waren. […] Die Worte flossen langsam über das Feuer hinüber und herüber, sie wurden bestimmter, zielgerichtet. Als der Morgen graute, da erhoben wir uns von unseren Felsen, der Plan war in allen Einzelheiten fertig: Proviant für sechs Wochen aus Deutschland mitnehmen, Entfernungen mit dem Rad zurücklegen, im Zelte wohnen. – Es wäre zum Lachen, wenn es uns nicht gelingen würde, allen Schwierigkeiten zum Trotz die hohen Berge dort drunten zwischen Italien und der Schweiz aufzusuchen; es musste gelingen, denn es war höchste Zeit für uns, aus der drückenden Enge, in die der Krieg Deutschland geschlagen hatte, herauszukommen.“ 12
Für Paul Bauer und Julius Brenner hatte dieser Befreiungsschlag auch eine politische Dimension: Sie waren entschlossen, „den Wall, den wirtschaftliche Knechtung und die feindliche Hasspropaganda um Deutschland aufgerichtet hatten, niederzureißen, um deutschem Bergsteigertum in der Welt wieder Anerkennung zu verschaffen. Der erste Vorstoß erfolgte im Jahre 1922 in die Schweiz …“ 13
Ihre alpinen Leistungen schützten Bauer und seine Freunde jedoch nicht vor dem Spott ihrer Vereinskameraden. Eine Karikatur in der AAVM-Kneipzeitung des Jahres 1922 zeigt sie in total abgerissener Montur vor einem Schweizer Hotel. Bildunterschrift: „Würdige Vertreter des Deutschtums im Ausland“. Die Kneipzeitung des Jahres 1925 enthält eine Zeichnung, auf der Paul Bauer gerade verspätet einen Sitzungsraum betritt. Sprechblase: „Ich weiß zwar nicht, was mein Vorredner gesagt hat, aber ich bin dagegen!“ In Münchner Bergsteigerkreisen dürfte sich niemand darüber gewundert haben, dass Adolf Hitler für diesen streitbaren Geist und seine Freunde „bereits 1923 der Mann [war], den wir nicht antasten ließen.“ 14Aber das war nur eine Seite der Medaille. Paul Bauer war auch ein treuer Kamerad, dem das Wohl eines ihm nahestehenden Bergfreundes weit wichtiger war als weltanschauliche Unterschiede. So setzte sich Paul Bauer nach dem Sturz der Münchner Räterepublik im Mai 1919 erfolgreich für die Freilassung des inhaftierten Rotarmisten Otto Herzog ein. 15Obwohl politisch konträr gesinnt, waren beide Mitglieder der wertkonservativen, renitenten und leistungsorientierten Alpenvereinssektion Bayerland.

Paul Bauer war einer von Aufschnaiters besten Bergfreunden .
In Paul Bauers Umfeld gab es da noch einen akademischen Bergfreund namens Wilhelm Fendt, der gemäß einer beim AAVM kursierenden Anekdote am 9. November 1923 bei Hitlers Umsturzversuch mitgemischt haben soll! Am Marsch auf die Feldherrnhalle wäre er nur deshalb nicht dabei gewesen, weil er die Oberföhringer Brücke gegen die anrückende Reichswehr hätte sichern müssen – schwer bewaffnet mit einer sechsschüssigen Pistole. Es hieß, Fendt hätte seinen Aufnahmeantrag in den AAVM mit einem einzigen Satz begründet, nämlich „Ich war beim Freikorps.“ 16
Ein weiteres ehemaliges Freikorpsmitglied in den Reihen des AAVM war der Medizinstudent Eugen Allwein. Im Jahr 1917 hatte er sich freiwillig zum Militärdienst gemeldet. Nach Kriegsende wechselte der junge Soldat ins Freikorps Oberland. Ende April 1919 nahm er an einer Feldschlacht gegen die „Rote Armee“ bei Dachau teil und mischte anschließend mit bei der „Befreiung“ Münchens. Wegen seiner Mitwirkung an dem militärisch zwar erfolgreichen, politisch jedoch wirkungslosen Sturm auf den Annaberg in Schlesien am 21. Mai 1921 verpasste Allwein das Notabitur für Kriegsteilnehmer daheim in München. Aufgrund „seiner Verdienste um Reich und Vaterland“ ermöglichte der Rektor des Wilhelms-Gymnasiums dem Freikorpskämpfer jedoch den Zugang zum Studium durch eine handschriftlich ausgestellte „ordre du mufti“.
Zu dem Freundeskreis um Paul Bauer im AAVM zählte damals auch der am 10. November 1900 in München geborene Wilhelm „Willo“ Welzenbach. Er hatte sich im Wintersemester 1920 an der Technischen Hochschule München eingeschrieben und war im Februar 1921 dem AAVM beigetreten. Es dauerte nicht lange, bis der zielstrebige Maschinenbau-Student die meisten seiner Vereinskameraden alpinistisch überflügelt und die damals schwierigsten Felstouren in den Nördlichen Kalkalpen gemeistert hatte. Im März 1923, mitten in der ärgsten Inflation, zog er fast ohne Barschaft, dafür aber mit zwei von Lebensmitteln schier platzenden Rucksäcken in die Schweiz. Per Ski bestieg er zwei Mal den Monte Rosa und eilte weiter in die Berner Alpen, um den Gipfeln von Mönch, Jungfrau, Finsteraarhorn und der Grindelwalder Fiescherhörner einen Besuch abzustatten. Im Sommer des Jahres wurde Welzenbach von dem versierten Westalpenmann Hanns Pfann im Wallis in die Kunst des Eisgehens eingeführt. Nach einer zweitägigen kombinierten Überschreitung von Matterhorn und Dent d’Hérens trafen die beiden in Zermatt zufällig den österreichischen Spitzenalpinisten Fritz Rigele, welcher dem Leser bereits bekannt ist als Freund von Peter Aufschnaiters Seilpartner Otto Zimmeter.
Читать дальше