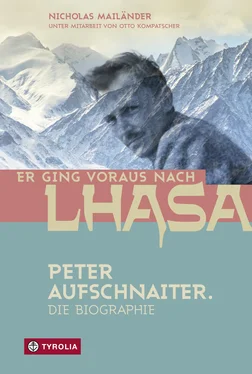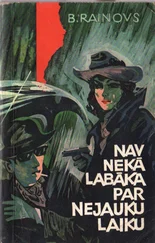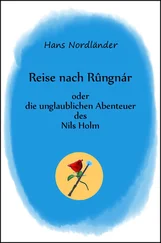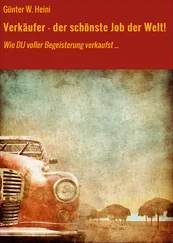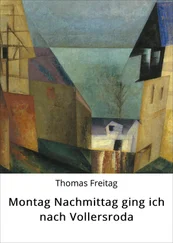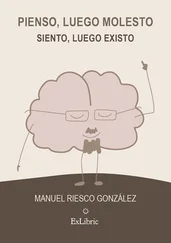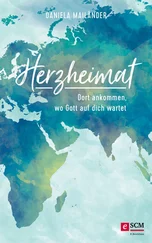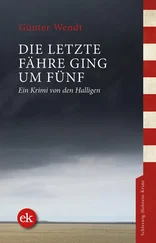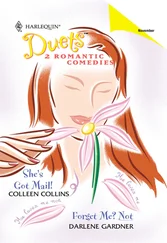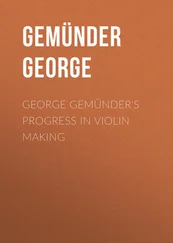Wir können also davon ausgehen, dass Peter Aufschnaiter im Herbst 1921 mit einigen Kopfblessuren sein Studium der Landwirtschaft an der Technischen Hochschule München antrat. Den im Programm der Technischen Hochschule des Jahres 1921/22 enthaltenen dringenden Rat, „vor Beginn des Hochschulstudiums sich längere Zeit in der Landwirtschaft praktisch auszubilden“, hatte der lädierte Studienanfänger in den Wind geschlagen. 2Dies dürfte eine entschuldbare Unterlassung gewesen sein; denn am Beginn des agrarwissenschaftlichen Studiums an der Technischen Hochschule München stand damals die Aneignung der theoretischen Grundlagen im Vordergrund: „Da bei einem großen Teil der Fächer des Landwirtschaftsstudiums und seiner Grund- und Hilfswissenschaften im Winterhalbjahre mit den grundlegenden Vorlesungen begonnen wird und das Sommerhalbjahr auf das im Winter gewonnene Wissen aufbaut, so ist das Studium im Winterhalbjahr zu beginnen.“ 3Den Weg von seiner Studentenbude in der Adelgundenstraße 10 im Stadtteil Lehel zur rund zweieinhalb Kilometer entfernten Hochschule legte Peter Aufschnaiter wohl auf dem Fahrrad zurück, um dann von der Luisenstraße einige Treppenstufen zu ersteigen und weiter in den Hörsaal zu humpeln.
Ziemlich sicher ist auch, dass der Studienanfänger nach dem erlittenen Schaden nicht für den gutmütigen Spott sorgen musste, als er eines Abends das Nebenzimmer des Restaurants „Domhof“ betrat, wo seit neuestem die Versammlungen des Akademischen Alpenvereins München (AAVM) stattfanden. Die Quellen weisen darauf hin, dass der frischgebackene Studiosus agrarius in diesem sowohl gesellschaftlich als auch alpinsportlich elitären Zirkel von Beginn an willkommen war. 4Damals schon hatte dieser zwar kleine, aber feine Verein bereits international einen sehr guten Namen.
Die Gründung des AAVM war im Jahr 1892 von jungen Münchner Spitzenbergsteigern wie Albrecht von Krafft und Rudolf Reschreiter sowie den Brüdern Josef und Ernst Enzensperger ausgegangen, die durch anspruchsvolle Erstbegehungen in den Nördlichen Kalkalpen von sich reden gemacht hatten. Der Akademische Alpenverein München war keine Sektion des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, sondern eine verbandsunabhängige alpinistisch orientierte Studentenverbindung. Viele ihrer Mitglieder gehörten auch der DuÖAV-Sektion Bayerland an, einer Sektion, deren „Ideal der bergsteigerischen Tat“ dem AAVM sehr nahestand. 5
International in Erscheinung trat der AAVM, als sein Mitglied Adolf Schulze am 26. Juli 1903 als erster Mensch den Gipfel der extrem schwierigen Uschba im Kaukasus erreichte. Im August desselben Jahres setzten seine AAVM-Kameraden Ludwig Distel, Georg Leuchs und Hans Pfann noch eins drauf und überschritten den Süd- wie den Hauptgipfel des Bergriesen in einer fünftägigen Gewalttour. Neun Jahre später markierten die „Akademiker“ Hans Dülfer und Werner Schaarschmidt den Beginn der „klassischen Moderne“ im Klettersport durch ihre Erstbegehung der Peter Aufschnaiter inzwischen gut bekannten Fleischbank-Ostwand im Kaisergebirge. Im darauffolgenden Jahr legten Hans Dülfer und Wilhelm von Redwitz mit der Erstbegehung der Direktführe durch die Westwand des Totenkirchls die Latte noch etwas höher.
Nach dem Ersten Weltkrieg hatten Mitglieder des AAVM sofort an diese stolze alpine Tradition angeknüpft. Der 1893 in München geborene Jurastudent Emil Gretschmann war in der Vorkriegszeit als Mitglied der Alpenvereinssektion Bayerland mit dem ebenfalls zu dieser Sektion gehörenden Klettergenie Paul Preuß in Kontakt gekommen und hatte sich unter dessen Einfluss dem lupenreinen Freiklettern verschrieben. Gretschmann gab diese Haltung an seinen AAVM-Kletterlehrling und alpinen Senkrechtstarter Herbert Kadner weiter, der sich wenige Monate zuvor, am 1. Mai 1919, im Zuge der Niederschlagung der Münchner Räterepublik beim Sturm auf den von der „Roten Armee“ besetzten Hauptbahnhof eine schwere Schussverletzung zugezogen hatte. 6
Kadner war nicht der einzige AAVMler gewesen, der sich damals als Freikorps-Milizionär oder als Angehöriger der rechtslastigen Einwohnerwehr an der „Befreiung“ der bayerischen Landeshauptstadt beteiligt hatte. Im Verlauf des Weltkriegs hatte sich der kleine Verein von einem Zusammenschluss eher unpolitischer Bergbegeisterter zu einer nationalkonservativen Gesinnungsgemeinschaft gewandelt. Dazu mag auch beigetragen haben, dass 27 von rund 260 Mitgliedern auf den Schlachtfeldern geblieben oder an im Kriegsdienst zugezogenen Leiden verstorben waren. 7Der Jahresbericht des AAVM über die Kriegsjahre schließt mit einer programmatischen Aussage:
„Der Krieg ist anders ausgegangen, als wir hofften. Von innen heraus zermürbt, brach unser Vaterland zusammen, unbesiegt von den Heeren seiner äußeren Feinde. Machtlos stehen wir jetzt da, wehrlos hasserfüllten Feinden preisgegeben, durch innere Unruhen fast an den Rand des Verderbens gebracht. Kein Hoffnungsfünkchen scheint die düstere Zukunft zu erhellen. […] Aber sollen wir nun tatenlos zusehen, wie der Zusammenbruch unseres Vaterlandes weiter und weiter schreitet? Nein und tausendmal nein! So gewiss wie der AAVM im Kriege seine Pflicht tat, so gewiss werden wieder Zeiten kommen, in denen man mit Achtung und Ehrfurcht den deutschen Namen in der Welt nennen wird, Zeiten, in denen kein Welscher mehr wagen wird, deutsches Alpenland zu vergewaltigen.
Mitzuhelfen, dass diese Zeit bald kommen möge, das ist eine Aufgabe, würdig des AAVM […] Lasst uns darangehen, Männer zu erziehen, die die Traditionen unserer Väter hochhalten, Männer, die noch Freude haben an Kampf und Sieg, wie ihn die Bergwelt hundertfach verheißt! Ein körperlich gesundes Geschlecht wird auch gegen geistige Fäulnis gefeit sein.
Da mitzuarbeiten sei unsere vornehmste Aufgabe!“ 8
Obwohl das Bergsteigen für die tonangebenden Mitglieder des AAVM nach dem Vertrag von Versailles gewissermaßen zu einer Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln geworden war, dürfen wir uns Herbert Kadner und seine Freunde vom AAVM aber nicht als verbissene, allein aufs Politische fixierte Haudegen vorstellen. In einem als „Erlebnis Fels“ titulierten Essay machte der neue Stern am alpinen Himmel deutlich, was ihm am extremen Klettern vor allem wichtig war: „Darum möchte ich mich auch gegen eine allzu scharfe Betonung eines Gegensatzes zwischen Gefühls- und Leistungsalpinismus wenden. Es gibt nur eine Form des Bergsteigens, die Berechtigung hat: Jene, die das Streben nach Erhebung aus den Niederungen des Alltags verkörpert.“ 9
Als der Artikel von Herbert Kadner im Mai 1921 in der Zeitschrift Der Alpenfreund erschien, hatte ein Spaltensturz in den Ötztaler Alpen dem Leben des Verfassers bereits ein jähes Ende gesetzt. Der Tod Herbert Kadners überschattete noch das Vereinsleben, als Peter Aufschnaiter im Herbst 1921 begann, an den wöchentlichen Versammlungen des AAVM teilzunehmen. Die Trauer um Kadner hielt aber weder die „Aktiven“ noch die „Alten Herren“ davon ab, am 17. Dezember 1921 das 29. Stiftungsfest der alpinen Studentenverbindung im Restaurant „Deutsches Haus“ gebührend zu feiern. Die Bergsteigermaler Rudolf Reschreiter und Ernst Platz sorgten durch ihre pikanten Beiträge zur Kneipzeitung für Erheiterung während des offiziellen Teils der Veranstaltung, nach dessen Beendigung „noch an einem anderen Ort bis Morgengrauen weitergezecht wurde“. 10
Im Verlauf des Wintersemesters konnte Aufschnaiter seinen alpinen Lehrmeister Franz Nieberl begrüßen, der bei den Münchner „Akademikern“ einen Vortrag über seine Erfahrungen an der Kleinen Halt im Kaisergebirge hielt, wo ihm noch kurz vor Kriegsausbruch zusammen mit Hans Dülfer die Erstbegehung der abweisenden 700 Meter hohen Nordwestwand gelungen war. Aufschnaiter scheint schnell heimisch geworden zu sein im Kreis der Münchner Studenten-Bergsteiger. In der letzten geschäftlichen Sitzung vor dem Osterfest des Jahres 1922 wählten sie ihn zum Ersten Schriftführer des Vereins. 11
Читать дальше