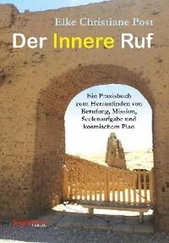Ich frage: Kann es sein, dass der Gegenspieler, diese Personifizierung der Destruktivität in uns, Zeugen braucht für sein eigenes Unglück? Kann es sein, dass er letztlich von seinem Hass aufs Leben befreit sein möchte? Kann es sein, dass ihm eine geheime Sehnsucht nach Bejahung von Leben innewohnt? Und wenn das so wäre, was würde das über den persönlichen Bereich hinaus bedeuten: gesellschaftlich, politisch? Es würde sich lohnen, dieser Frage gründlich nachzugehen.
Wie finde ich den Gegenspieler?
Ich brauche ihn nicht zu suchen, denn er findet mich, zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jeder Situation. Es ist nur wichtig zu wissen, dass er da ist, dass er keine psychologische Erfindung ist, sondern eine gegen das Leben gerichtete Realität. Wann immer wir den Eindruck haben, dass es uns nicht gut geht, dass wir nicht verstehen, warum wir mit uns nicht eins sind, wann immer wir uns unfrei fühlen, wann immer wir tun, was wir »eigentlich« nicht wollen, sollten wir uns fragen, ob der Gegenspieler seine lebensverneinende Tätigkeit aufgenommen hat.

Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich Ihnen ein vom Gegenspieler bestimmtes Leben vorstellen, das meines Erachtens in besonderer Weise die Macht der Lebensverneinung in Gestalt des Gegenspielers veranschaulicht.
Jürgens Trauerspiel: Ein langes Leben im Griff des Gegenspielers
Ich erzähle Ihnen nun von einem Mann, dem ich hin und wieder begegnete. Jürgen war nie mein Klient. Er war das, was man einen guten Bekannten nennt. Er war wie ich ein am Leben interessierter Mensch. Aber es ging von ihm eine große Schwere aus, denn sein ganzes Leben kreiste um einen bestimmten Verlust. Wann immer wir uns sahen, sprach er darüber und fühlte sich als dessen Opfer. Er erwartete mein Mitgefühl und bekam es auch. Trotzdem belastete seine Opferhaltung unsere Beziehung im Lauf der Zeit mehr und mehr. Denn ich bin daran gewöhnt, so weit wie möglich schwierige Lebensgefühle ändern zu helfen.
Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Auch nicht, weil wir inzwischen in unterschiedlichen Ländern leben. Vermutlich auch deshalb, weil Gespräche mit ihm wegen der Fixierung auf seinen Verlust für mich anstrengend wurden. Ich hatte gehofft, er würde irgendwann seine Opferhaltung aufgeben. Doch er zog sich immer mehr in sich zurück. Er ist inzwischen verbittert und sieht die Ursache seines gesamten unglücklichen Lebens in diesem einen Verlust.
Jürgens Mutter war sehr jung, als sie ihn gebar. Sie bekam ihn nicht einmal zu Gesicht, denn er wurde gleich nach seiner Geburt den Adoptiveltern zugeführt. Dass er zur Adoption freigegeben werden sollte, war von langer Hand vorbereitet. Weder die junge Mutter noch der junge Vater waren in Überlegungen einbezogen worden. Jürgens Eltern wussten auch lange Jahre nicht, wohin ihr Kind verbracht worden war.
Jürgens Adoptiveltern – ich habe sie viele Jahre später kennengelernt – waren einfache, freundliche Menschen, die nach ihren Möglichkeiten alles für ihn taten. Doch Zärtlichkeit war ihre Sache nicht. Jürgen konnte sich nicht daran erinnern, dass Vater und Mutter ihn einmal in den Arm genommen hätten. Doch da er nichts anderes kannte, vermisste er lange Zeit ihre Zärtlichkeit nicht. Jürgen war ein hübscher, intelligenter, emotionaler und sozialer Junge, dem seine Eltern nicht gewachsen waren. Deshalb ließen sie ihm vieles durchgehen, was ihnen selber fremd war. Sie wussten, dass ihr Sohn »anders« war als sie selbst, und taten trotzdem alles erdenklich Mögliche, ihm gute Eltern zu sein.
Dann kam der Tag, der sein Kinderleben veränderte. An einem Sonntagnachmittag im Sommer – Jürgen war inzwischen 14 Jahre alt – kehrte er verschwitzt und fröhlich nach Hause zurück. Sein Vater stand vor der Haustür und empfing ihn mit den Worten: »Mein Junge, wir müssen dir was sagen.« Dann legte er ihm seine große Hand auf die Schulter und führte ihn ins Wohnzimmer, wo bereits seine Mutter saß, die sich an ihrer weißen Schürze zu schaffen machte. Jürgen bemerkte, dass sie blass aussah und seinem fragenden Blick auswich. Die Unruhe der Eltern begann sich auf ihn zu übertragen. Sein Blick wanderte zwischen beiden hin und her. Dann stieß er hervor: »Was ist denn? Was ist passiert? Ist jemand krank?« Ihm fiel auf, dass sein Vater nach einem Stuhl Ausschau hielt, obwohl sich ihm mehrere Stühle anboten. Jürgens Unruhe steigerte sich. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, sagte noch einmal: »Nun sagt es schon! Was ist los?«
Der Vater setzte sich neben Jürgen, der seinen Lieblingsplatz auf dem Sofa eingenommen hatte, legte noch einmal seine Hand auf die Schulter des Jungen und begann: »Weißt du, deine Mama und ich haben dich lieb. Das weißt du.« Jürgen hob ruckartig seinen Kopf, denn einen solchen Satz hatte er noch nie von ihnen gehört. Sein Herz schlug schneller. »Aber da ist etwas, was du wissen solltest. Du bist ja nun groß und wirst sicher verstehen, was ich dir jetzt sage.« Jürgen fiel auf, dass seine Mutter ihre weiße Schürze nahm und sie zum Gesicht führte. Ob sie weinte? Ihre Hand zitterte. Jürgen war inzwischen aufgestanden und suchte Halt an einer Schrankwand. Er sah, wie sich auch sein Vater Schweißperlen von der Stirn wischte. (Als mir der erwachsene Jürgen diese Szene zum ersten Mal erzählte, schien es mir, als habe er diese Stunde erst gestern erlebt.) Der Vater fuhr stockend fort: »Was du noch nicht weißt, ist, dass du eigentlich einen anderen Papa und eine andere Mama hast. Deine Mama durfte dich nicht behalten, weil sie sehr jung war und ihr eigener Papa ihr verboten hatte, für dich zu sorgen.« Jürgen lehnte kreidebleich an der Schrankwand. Was er da hörte, verschlug ihm die Sprache. »Und dein eigentlicher Papa hat leider nicht um dich gekämpft«, ergänzte Jürgens Vater. »Er hat dann später eine andere geheiratet.«
Jürgen sagte nichts, rannte auf sein Zimmer. Dann hörten seine Eltern ein lang gezogenes Heulen, das man sogar in der Nachbarschaft gehört hatte. Beide Eltern hatten versucht, mit ihm weiter zu sprechen, aber Jürgen hatte die Tür zu seinem Zimmer verschlossen. All ihr Bitten und Betteln half nicht, er wollte allein sein. In der folgenden Nacht schlief er kaum, aber er fasste einen Plan: Er wollte seine Mutter suchen.
Am nächsten Abend kam er nicht nach Hause. Zwei Tage war er verschwunden. Seine Eltern benachrichtigten die Polizei. Sie fand ihn nach einer Woche in der benachbarten Stadt auf einer Parkbank, auf der er vor lauter Müdigkeit eingeschlafen war. Mit seinem ersparten Geld hatte er sich eine Fahrkarte gekauft und war in den nächsten Zug gestiegen. Als man ihn später fragte, ob er denn gewusst habe, wo seine Mutter wohnte, sagte er nur: »Nein, ich wollte doch nur zu ihr.« Seine leibliche Mutter fand er kurz vor seinem 30. Geburtstag. Ich wurde später Zeuge der Liebe zwischen Mutter und Sohn.
Jürgen machte seinen Adoptiveltern keinen Vorwurf, warum sie ihm nicht schon längst ihr Geheimnis mitgeteilt hatten. Er war und blieb »brav«, war weiterhin ein guter Schüler, verbrachte viele Stunden mit einem Freund, spielte Fußball und es schien, als habe er seine Verzweiflung überwunden. Als er sich zum ersten Mal verliebte, heiratete er gleich das hübsche Mädchen. Drei Jahre später wurde ihr Sohn geboren. Er schien glücklich zu sein.
Jürgen machte eine Fortbildung nach der anderen und kletterte die Karriereleiter immer höher. Aber er hatte nicht genügend Zeit für seine junge Frau gehabt. Die Folge war, dass sie sich auf andere Männer einließ. Die Ehe wurde geschieden. Ihm war klar, dass er sich früh auf eine Ehe eingelassen hatte, weil seine Sehnsucht nach einer eigenen Familie so stark gewesen war. Er heiratete nicht wieder. Wurde er von Freunden darauf angesprochen, zuckte er nur mit den Schultern und sagte: »Was wollt ihr? Mir geht’s gut. Ich traue sowieso keiner Frau mehr über den Weg.«
Читать дальше