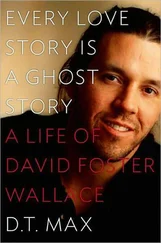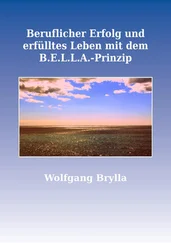Uwe Böschemeyer
Sinnerfüllt leben
mit Krebs
story.one - Life is a story

1. Auflage 2022
© story.one – the library of life – www.story.one
Eine Marke der Storylution GmbH
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Gesetzt aus Minion Pro und Lato.
© Coverfoto: Orkhan Farmanli, unsplash
© Fotos: unsplash, privat
Printed in the European Union.
ISBN: 978-3-903715-18-9
eISBN: 978-3-903715-19-6
Für Christiane
Der Schock
Die ersten Nächte der Diagnose
Der zweite Schock
Die Zuversicht wächst
Unvernunft oder hoffnungsvolles Wagnis?
Der Weg ging nicht gerade bergauf
Hoffnung ist das stärkste Motiv zum Leben
Wertimaginationen als Hoffnungsfinder
Der dritte Schock und die Wende
Arbeit als „Therapeutikum“
Bedenken, dass wir sterben müssen
Leben ist Leben, solange ich lebe
Ich habe Krebs. Inzwischen ist er nach zehnjähriger Krankheit nicht mehr aktiv. Ich kenne also diese Krankheit aus Erfahrung, und deshalb wage ich, darüber zu schreiben.
Es war im Urlaub 2011 auf der Nordseeinsel Norderney. Das Wetter war gut, das Meer wie immer für mich ein Genuss, die Menschen um mich herum fröhlich. Nur: Da waren die heftigen Rückenschmerzen, die sich immer mehr ausbreiteten. Ich konnte kaum noch gehen. Deshalb schleppte ich mich zu einem Physiotherapeuten, der mich täglich behandelte, allerdings ohne Erfolg. Auch der Besuch im Krankenhaus brachte keine Klärung und also auch keine Hilfe. Man vermutete einen Bandscheibenvorfall. Die Tage und Nächte wurden zur Hölle. Nachts legte sich meine Frau zu mir auf den Teppich, weil ich im Bett nicht mehr liegen konnte. Ihre Nähe tat mir gut.
Solange ich auf der Insel war, kam ich nicht einmal auf die Idee, ich könnte Krebs haben. Und hätte mir jemand eine solche Idee nahe zu bringen versucht, hätte ich ihn schweigend abgewiesen.
Gleich nach unserer Rückkehr nach Hamburg suchte ich einen Arzt auf, der auch als Osteopath einen guten Namen hatte. Nachdem er mich behandelt hatte, legte er mir behutsam nahe, in der Radiologie ein MRT machen zu lassen. Da sich auch durch seine Behandlung keine Besserung einstellte, meldete ich mich in der Radiologie an. Das Ergebnis der Untersuchung war für mich zunächst niederschmetternd. Eine junge Ärztin – sie war nicht mit besonderem Mitgefühl gesegnet – zeigte auf den Bildschirm und sagte: „Sehen Sie hier, das ist Krebs.“ Glücklicherweise war meine Frau bei mir. Wie es vermutlich vielen Leidensgenossen ergeht, verweigerte ich die Erkenntnis der offenbar klaren Diagnose: „Das kann ja gar nicht sein etc. etc. etc.“ Doch die Ärztin ließ sich nicht beirren und entließ uns.
Da sehe ich uns nun auf dem kalten Flur der Radiologie stehen, meine sehr junge Frau und mich. Mit der nicht ausgesprochenen Frage: „Wie lange noch?“ Wir sprachen kaum. Wir umarmten uns lange. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, ehe ich noch einem älteren Arzt vorgestellt wurde, der nur sagte: „Dagegen kann man doch ´was tun...“ Was für eine Wohltat war dieser Satz! Trotzdem: Als wir nach Hause kamen, schien alles anders zu sein. Alles schien leer, nicht mehr zu mir gehörig, fremd. Ich fühlte mich von der Welt getrennt. Von allen Seiten kroch die Angst in Körper und Seele. Was sollte ich tun?
Wie von selbst setzte ich mich an den Schreibtisch und arbeitete an dem Buch weiter, an dem ich vor einiger Zeit zu schreiben begonnen hatte: „Machen Sie sich bitte frei! Entdecken Sie Ihre Furchtlosigkeit.“ Erst viel später ging mir auf, dass die Flucht in die Arbeit für mich etwas außerordentlich Hilfreiches gehabt hatte. Das Eintauchen in die mir vertraute Tätigkeit verschaffte mir für einige Stunden – und später immer wieder - einen gewissen Abstand zu meiner Angst.

Die ersten Nächte nach der Diagnose
An Schlaf war in der ersten Nacht nicht zu denken. Trotzdem kehrte eine gewisse Ruhe bei mir ein und wohl auch bei meiner Frau. Das hatte einen Grund, denn wir sprachen aus, was uns bedrängte: Unsere Ängste und unsere Hoffnungen -, die Frage nach dem Warum der Erkrankung und doch noch sehr zögerlich nach dem Wozu. Und dieses Aussprechen wirkte wie ein kleines Wunder: Es war, als entfernten wir uns ein Stück weit von dem, was uns zu fixieren begonnen hatte. Nur zwischendurch bemerkte ich, wie die Angst ihr hässliches Gesicht wieder zu zeigen begann. Und wenn das geschah, sprach ich aus, was ich empfand und gewann wieder ein wenig Abstand.
Schaue ich auf diese ersten Nächte zurück, der viele weitere folgten, kommt mir ganz nahe, was es für Menschen bedeuten muss, wenn sie in einer solchen oder ähnlichen Situation allein sind, begreife ich, was Einsamkeit ist. Umso dankbarer war ich und bin ich bis heute, dass ich dieses Schicksal nicht erleiden musste.
Noch etwas anderes ging mir auf, wenn ich an diese Nächte denke: Ich empfand es als meine Aufgabe, mich in meiner Angst nicht gehen zu lassen, sondern so weit wie möglich dafür zu sorgen, dass auch meine junge Frau in ihrer Angst nicht unterging. Und ebenso erlebte sie es: dass ihre Offenheit für meine Not ihr einen gewissen Abstand zu ihren eigenen Ängsten verschaffte.
Vielleicht begriff ich da zum ersten Mal, was Viktor Frankl mit dem Wort, „sich selbst transzendieren“ meinte.
Unsere Gespräche führten dazu, dass früh in mir der Wunsch erwachte, viel zu lesen, vor allem theologische Literatur, vor allem die von vielen Zeitgenossen geschmähte Trilogie über Jesus von Nazareth, die der kluge und nicht weniger weise deutsche Papst verfasst hatte. Da ich vor meiner psychotherapeutischen Existenz auch als Theologe gearbeitet hatte, regte mich die Lektüre Benedikts XVI. sehr an, meine Spiritualität zu überdenken. Mehr als das: Ich gewann auf diese Weise mehr Gelassenheit und – Hoffnung. Vielleicht liegt in dieser Lektüre der Grund, warum ich später davon sprechen konnte, dass es zwei Formen von Hoffnung gibt. Ich komme gleich darauf zurück.
Diese Nächte gehörten zu den Sternstunden unseres Lebens. Tagsüber arbeitete ich, und das tat mir gut. Aber bereits am Abend erlebten wir eine gewisse Vorfreude auf die Stille der nächsten Nacht und darauf, was und wie wir miteinander sprechen würden. Ich bekenne, dass ich kaum glauben konnte, was diese nächtlichen Stunden in mir bewirkten. War es die rückhaltlose Offenheit zwischen meiner Frau und mir, die noch einmal unsere Beziehung vertiefte? War es das Aussprechen der Hoffnungsgedanken, von denen viel Ermutigung ausging? Was immer es gewesen sein mag, was diese Stunden so attraktiv machte: Wann immer Menschen miteinander so sprechen, dass nichts Unklares mehr zwischen ihnen steht, beginnt die Wüste zu blühen.
Читать дальше