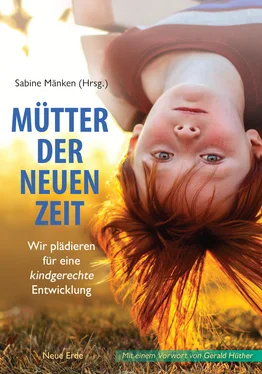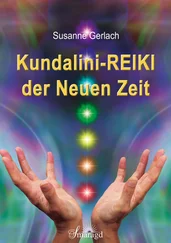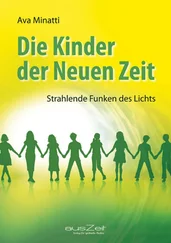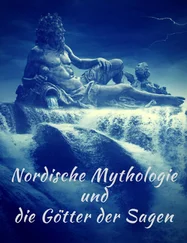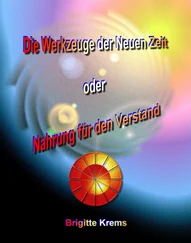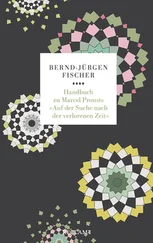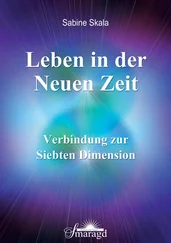Der Impuls, zu promovieren entstand bei mir kurz nach der Geburt meines ersten Kindes. Ich fühlte eine ungeheure Energie und Euphorie in mir, obwohl es eine schwere Geburt und meine Tochter ein wirklich anspruchsvolles Baby war. Neugeboren lehrte sie mich, dass sie möglichst rund um die Uhr getragen und viel mehr gestillt werden möchte, als ich es mir zuvor vorgestellt und auch sagen lassen habe. Der Stubenwagen stand bei uns schnell nur noch als hübsche Innendekoration im Wohnzimmer und verschwand alsbald im Keller. Mit Selmas Geburt wurde aber nicht nur ein neues Kind geboren, sondern auch ich fühlte mich als ganz anderer Mensch. So viel Liebe, so viel Energie, so viele und starke, intensive Emotionen. Auch ich war wie neugeboren im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war ein anderer Mensch. Und jedes neugeborene Kind wurde zur Liebe meines Lebens. Nur fünfzehn Monate später kam mein erster Sohn zur Welt. Zwei Jahre darauf hatte ich ein großzügiges Promotionsstipendium und eine Vereinbarung mit dem Wissenschaftsverlag meiner Träume in der Tasche.
Natürlich wollte ich meine Doktorarbeit auch bewältigen und mir damit eine berufliche Zukunft als Autorin und Kunstwissenschaftlerin aufbauen. Mich interessierte das Thema ausgesprochen. Ich war ehrgeizig, vor allem wollte ich aber nicht im Kleinklein von Brotjobs versumpfen, sondern meinem Leben eine klare Richtung geben: Das Schreiben und Sprechen über Malerei und die Bildbetrachtung machten mich glücklich, warum also nicht daraus einen tragfähigen Beruf für mich kreieren?
Die beiden kleinen Kinder aber hielten natürlich nicht immer gleichzeitig und gleich lang ihre Siesta. Ihre nicht immer reibungslos planbaren Schlafenszeiten genügten mir nicht: Ich brauchte ein bisschen mehr Zeit für die konzentrierte Schreibarbeit. Meine zwei ersten Kinder gingen deshalb mit 2¼ Jahren beziehungsweise schon mit 13 Monaten zu ihrer Tagesmutter Bettina, damit ich an der TU Dresden meine Doktorarbeit über zeitgenössische Malerei verfassen konnte. Ich sah es schon damals nicht ein, weshalb meine ältere Tochter woanders fremdbetreut werden sollte, wenn ich mit dem zweiten Baby ohnehin zu Hause wäre. Deshalb ging sie für heutige Verhältnisse erst so spät in eine Tagesbetreuung.
Von unseren Familien erhielten wir leider so gut wie keine Unterstützung. Die Großeltern wohnten in einer anderen Stadt, und die Schwiegermutter erklärte mir rundheraus, sie hätte mit ihren fünf Kindern schon genug geleistet, nun lägen ihre Interessen woanders (in der Arbeit und der Erholung). Da es auch finanziell sehr schwierig war, entschied ich mich schließlich für die Tagesmutter. Es musste sich einfach etwas ändern, denn ich hatte es satt, immer am Rande des Existenzminimums zu vegetieren. Das Gehalt meines damaligen Mannes als Theaterschauspieler reichte trotz Festanstellung, großformatigen Plakaten und üppigem Applaus leider gerade so für die Basics – zum Glück bezahlte meine Mutter uns die wöchentliche Kiste mit Biogemüse vom Bauern, aber das nur am Rande. Es war eine rein rationale und auch aus der Not getroffene Entscheidung, die beiden kleinen Kinder in fremde Hände zu geben. Mein Mann konnte sich nicht dazu durchringen, seine Arbeitszeiten zugunsten der Kinder und mir einzuschränken. Innerlich waren weder ich noch Selma und Timon soweit, einen wesentlichen Teil des Tages getrennt zu verbringen, nicht mehr morgens miteinander auf den Spielplatz zu gehen, durch den Auwald zu abenteuern, nicht mehr gemeinsam »Zmittag« zu kochen und zu essen und auf die ruhige Geborgenheit der Siesta zu Hause zu verzichten. Für mich war es eine seltsame Vorstellung, die Kinder woanders schlafen zu lassen.
Sicher hat das auch viel mit meiner Schweizer Sozialisierung zu tun, wo es die längste Zeit einfach nicht üblich war, Kleinkinder überhaupt fremdbetreuen zu lassen und der Kindergarten auch heute nur drei bis vier Stunden am Vormittag dauert. Doch ganz unabhängig davon musste ich zusehen, wie meine Kinder bei fast jedem Abschied heulten. Zwar erklärte uns die liebevolle Tagesmutter geduldig, dass dies ganz normal sei und sie sich beruhigen würden, für mich aber fühlte es sich falsch an. Eigentlich hätte ich die beiden quirligen Zwerge lieber immer um mich gehabt oder aber sie in den Händen von Familienmitgliedern gewusst.
Mir fehlten meine Großmütter, meine Tanten und Schwestern, meine Freundinnen. Für meinen Mann war ich (von Berlin) nach Leipzig gezogen, wo ich niemanden kannte. Im Grunde genommen fühlte ich mich einsam und auch teils überfordert von den andauernden existenziellen Bedürfnissen der Kinder. Mit der bisherigen Gleichberechtigung war es nach den beiden Geburten nämlich schlagartig vorbei. Mein Mann tauchte tagsüber jeweils für ein paar Stunden auf, um die Kinder nachmittags mit seinen Schauspielkünsten zu bespaßen und zu bezirzen – für den nicht immer zuckersüßen Rest war im Wesentlichen ich zuständig. Er nahm damals noch nicht einmal die sonst üblichen zwei Monate Elternzeit. Sie tagsüber für ein paar Stunden betreuen zu lassen, war damals die einzige Lösung. Weder konnte ich mir mein Netzwerk in die fremde Stadt zaubern noch meinen Mann dazu bewegen, mehr da zu sein.
Mit Bettina hatten wir großes Glück: Neben meinen beiden Kindern betreute sie nur noch eine Spielkameradin meiner Kinder, die wir ohnehin regelmäßig trafen. Wir brachten sie um 9 Uhr morgens und holten sie nach der Siesta so früh wie möglich ab, oft ließ ich sie auch ein oder zwei Tage zu Hause, fuhr mit ihnen zu meiner Verwandtschaft und den Freunden in Basel. Das war mein Kompromiss. Unsere Tagesmutter war der pure Luxus im Vergleich zum regulären Betreuungsschlüssel: Ehrlich gesagt kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich sechs Kindern unter drei Jahren so viel Kraft und Aufmerksamkeit entgegenbringen könnte, wie sie es zu Hause einfordern.
Heute bin ich 39 Jahre alt, geschieden und lebe in einer neuen Partnerschaft. Inzwischen bin ich mit Auszeichnung promovierte Kunsthistorikerin, mehrfache Buchautorin und stolze Mutter von drei Kindern. Unser Nesthäkchen kam vor zwei Jahren zur Welt, und die beiden großen Kinder sind jetzt zehn und zwölf Jahre alt. Der Kleine geht erst in den Kindergarten, wenn er wirklich reif dafür ist, von der Umgebung profitiert – und nicht in erster Linie, damit ich noch mehr meinem Beruf nachgehen kann. Meine beiden Fast-Zwillingskinder begannen, rückblickend betrachtet, erst im Alter von etwa dreieinhalb, vier Jahren, wirklich intensiv mit anderen Kindern zu spielen. Erst ab diesem Alter gingen sie auch gerne und von sich aus in den Kindergarten.
Vor kurzem brachen wir nach nur vier Wochen Valentins Eingewöhnung ab, weil er deutlich zeigte, dass er noch nicht so weit war. Unter anderem wurde er sehr krank, was mich zutiefst beunruhigte: Für mich war es ein deutliches Warnsignal, dass sein ganzer Körper auf diesen Löseprozess noch mit Stress und Überforderung reagierte. Die beiden Erzieherinnen unterstützten mich auf diesem Weg, und ich bin ihnen dankbar. Er ist wieder gesund, seitdem wir die Eingewöhnung beendet haben. Dies bestätigt mich in meiner Entscheidung, ihn weiterhin selbst zu betreuen.
Mit endlosen Spielnachmittagen, Verkleiden und Rollenspielen, gemeinsamem Backen, Malen, Erzählen und langen Spaziergängen habe ich meine eigene Kindheit sehr behütet und fröhlich in Erinnerung. Ich bin meiner Mutter dankbar für diese gemütliche und heile Kinderwelt. Meinen Vater dagegen empfand ich als streng, wenig kindgerecht in der Kommunikation und unberechenbar. Er hielt uns endlose Vorträge, egal, ob es uns interessierte oder nicht. Im Alter von sechs Jahren teilte ich ihm bei einem Besuch auf dem Flughafen mit, er bräuchte mir nicht immer alles zu erklären (es ging um die technische Funktion von Turbinen). Er nahm mich beim Wort, und heute führen wir die anregendsten und spannendsten Gespräche, die man sich nur wünschen kann. Bis heute bin ich der Meinung, dass Kindern oft viel zu viel und alles bis ins kleinste Detail erklärt wird; dabei ist es viel besser, sie die Welt selbst entdecken und erfahren zu lassen. Wenn sie fragen, genügen kleine, behutsame Hilfestellungen oder eine Antwort, die zu mehr Fragen einlädt, sodass zwischen Kind und Erwachsenem ein angeregtes Gespräch entstehen kann.
Читать дальше