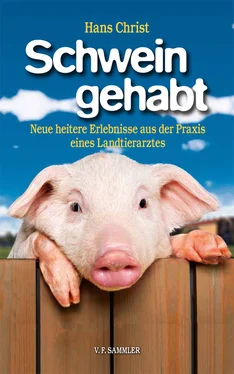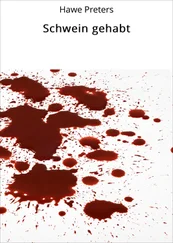Aus Ärger, dass der Hintersteiner meine Warnung, Futter im Stall aufzubewahren, in den Wind geschlagen hatte, hielt ich den Mund und verzichtete auf eine Aufklärung. Das sollte sich auszahlen, ganz nach dem Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!
Weil mir der Wagnerbauer in der darauffolgenden Woche breitgrinsend mitteilte: „Na, mit dem Hintersteiner haben Sie sich ja einen Fan aufgerissen!“
„Wieso?“
Der Wagner lachte: „Der Mensch hat am Sonntag im Wirtshaus jedem, den er erwischt hat, vorgeschwärmt: ‚So einen Tierarzt muss man einmal finden! Weiß schon im Voraus, dass der Stier am nächsten Tag was hat!‘“
Liebe geht unter die Haut
Haus und Stallgebäude vom Strampflgut hätten für jeden Historienfilm eine authentische Kulisse abgegeben. Das Haus stammte aus dem frühen siebzehnten Jahrhundert, wenn man der in den Türbalken eingeschnitzten Jahreszahl trauen durfte. Der Stall war zwar zwischenzeitlich einmal abgebrannt, hatte aber auch schon mehr als zweihundert Jahre auf dem Buckel, will sagen, den Dachschindeln.
Und der Strampflbauer selbst, der Letzte seiner Sippschaft, weil unbeweibt und daher auch kinderlos, zumindest wusste er von keiner Vaterschaft, passte haargenau in diese Idylle, um den hätte sich ebenfalls jeder Regisseur für eine Komparsenrolle gerissen. Weil original!
Sein Alter ließ sich nicht einschätzen, und als ich ihn einmal danach fragte, erklärte er, er wüsste es selbst nicht genau. So achtzig oder mehr, um Formalitäten hätte er sich zeitlebens nie gekümmert.
Er war ein dürrer Mann von mittlerer Größe, kein Gramm Fett auf den Rippen und unter der scharfen Hakennase wucherte ein grauer Vollbart, mit dem man eine Seegrasmatratze neu hätte stopfen können.
Sommers wie winters trug er eine ausgeschossene Lodenweste und eine Lederhose, deren ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war, die jedoch infolge der beständigen Stallarbeit von selbst starr in der Ecke stehen würde, täte sie der Strampfl in der Nacht ausziehen, woran ich beträchtliche Zweifel hegte.
Graue Kniestrümpfe und ein speckiger Filzhut mit einem räudigen Gamsbart vervollständigten sein tägliches Erscheinungsbild. Als unerlässliches Attribut hielt er eine Gesteckpfeife aus Holz zwischen den gelben Zähnen, was seiner Redeweise einiges an Verständlichkeit raubte.
Ein Tierarzt, der lauter solche Kunden hätte, würde binnen Kürze genauso daherkommen, weil eine Visite am Strampflgut ein Ereignis war, das vielleicht nur alle Schaltjahre einmal passierte.
Diesmal aber musste es sein.
„Servus Doktor“, nuschelte der Strampfl und kratzte sich zur Begrüßung ungeniert am Hosenboden.
„Was gibt es für ein Problem“, fragte ich und war heilfroh, dass er mir nicht die Hand gegeben hatte, weil ich auf den ersten Blick den hässlichen Ausschlag an seinen Händen und teilweise Unterarmen erkennen konnte.
„Ein Kalb! Gestern auf die Welt gekommen. Trinkt nicht!“ Mit den Worten ging er ebenso sparsam um, wie mit allen anderen Dingen, vor allem der Hygiene.
„Schlecht“, antwortete ich. Wenn er mundfaul war, stand mir auch nicht der Sinn nach Volksreden.
Das Kalb lag in seinem Kobel und atmete schwer. Obwohl ich vermutete, was die Ursache war, steckte ich ihm der Vollständigkeit halber das Thermometer in den Hintern. Genau wie ich dachte, normale Temperatur.
„Lungenentzündung?“, blies der Strampfl in einer Rauchwolke heraus.
„Weißfleischigkeit!“
„Sie können sein Fleisch doch gar nicht sehen?“ Offenbar fand er, ein wenig Skepsis konnte nicht schaden.
Jetzt musste ich doch etwas weiter ausholen: „Das ist auch nicht nötig. Weißfleischigkeit nennt man einen Selen- und Vitamin-E-Mangel. Die Muskeln können nicht richtig funktionieren. Die Zwerchfellmuskulatur ebenso wenig wie die Schlundmuskulatur. Kann es aufstehen?“
„Mit Mühe. Und nicht lange.“
„Na, da haben wir es ja. Aber keine Sorge, eine Spritze und in vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden ist alles in Ordnung.“
Während ich zum Wagen marschierte, um das Medikament zu holen, musterte ich im Vorübergehen die kleine Kuhherde.
Nachdem ich dem Kalb die Injektion verpasst hatte, fragte der Strampfl. „Was kostet das?“
Ich nannte ihm den Preis, worauf er nuschelte: „Auch schon einmal billiger gewesen“, worauf ich lachte: „Ja, vor acht Jahren, als ich das letzte Mal hier war. Damals war alles billiger!“
Der Strampfl förderte aus der Brusttasche einige zerknüllte Geldscheine zutage und wollte sie mir geben.
Angesichts seines Hautzustandes machte ich jedoch keinen Gebrauch davon und sagte: „Ich schicke Ihnen in den nächsten Tagen einen Erlagschein!“
„Wie Sie wollen“, zuckte er die Schultern und ließ den Mammon wieder verschwinden.
„Was tun Sie eigentlich gegen Ihren Ausschlag?“, wollte ich wissen.
„Schnaps und Lärchpech!“, nuschelte er und ließ mich im Ungewissen, was er davon innerlich anwendete.
„Nicht gut“, sagte ich.
„Wissen Sie denn, was das ist?“
„Ich habe mir vorher Ihre Kühe angeschaut. Die mittlere hat Euterpocken, an der haben Sie sich angesteckt.“
„Ich hab’ die Pocken?“, fragte er entgeistert und schaute entsetzt auf die kreisrunden Geschwüre.
„Nur die Kuhpocken“, beruhigte ich ihn.
Kuhpocken oder falsche Pocken, auch Pseudopocken genannt, werden durch ein Paraboxvirus verursacht, welches jedoch, im Gegensatz zu den oft tödlich verlaufenden echten Pocken, unangenehme, aber harmlose Hautveränderungen hervorruft, die binnen sechs bis acht Wochen ohne Narbenbildung wieder abheilen. Sie kommen vor allem auf den Zitzen von Kühen, Schafen sowie Ziegen vor und werden durch Kontakt auch auf den Menschen übertragen.
Der englische Arzt Edward Jenner hatte beobachtet, dass jemand, der die Kuhpocken bereits gehabt hatte, nicht mehr an den echten Pocken erkranken konnte. Es musste sich um eine Verwandtschaft handeln. Von Erregern wusste man damals noch nichts, aber so kam er auf die Idee, mit der harmlosen Variante eine künstliche Infektion als Schutz gegen die bösartige Form zu erzielen.
Die Impfung war geboren. Und da das Serum aus der Lymphe kranker Kühe stammte und die Kuh auf Latein, der damaligen Gelehrtensprache, vacca heißt, spricht man bis heute bei allen möglichen Impfungen von Vaccinationen. 1796 wandte Jenner zum ersten Mal diese neue Methode bei einem Knaben an.
Selbst im alten Studentenlied „Ich bin der Doktor Eisenbarth“ findet die Vaccination gegen Kuhpocken ihren Niederschlag:
Zu Ulm kurierte ich einen Mann,
wiwide witt, bumm bumm,
dass ihm das Blut vom Beine rann,
widewide witt, bumm bumm.
Er wollte gern gekuhpockt sein,
widewide witt juchheiraßa,
ich impft’ ’s ihm mit dem Bratspieß ein,
widewidewitt, bumm bumm!
Wegen der Ansteckung durch Melken nannte man die Hautveränderungen Melkerknoten. Heutzutage sind diese fast vollständig von der Bildfläche verschwunden, weil das Handmelken ebenfalls der Vergangenheit angehört.
Der Strampfl, natürlich, bildete eine Ausnahme. Er tat sich mit seinen drei Kühen dabei aber auch leicht. Vor zwanzig Jahren hatte ihm ein Nachbar eine alte mobile Melkmaschine geschenkt, weil er selbst auf eine damals moderne Rohrmelkanlage umgesattelt hatte. Das Trumm sah aus wie ein umgebauter Rasenmäher und machte auch so einen Krawall.
Ich bin mir sicher, der Strampfl hatte das Präsent kein einziges Mal benutzt. Er hatte es lieber, während des Melkens dem Fressen seiner Kühe, die sich an duftendem Heu gütlich taten, und dem Vogelgezwitscher im Apfelbaum vor dem Stallfenster zuzuhören.
Nachdem ich ihn aufgeklärt hatte, meinte er: „Und, haben Sie was dagegen?“
„Gegen das Virus gibt es nichts. Damit muss das Immunsystem selbst fertig werden. Aber ich habe was, mit dem die Heilung schneller geht.“
Читать дальше