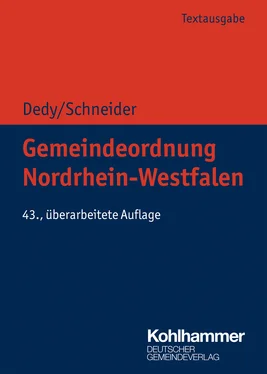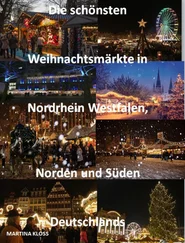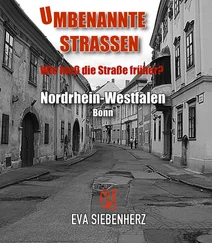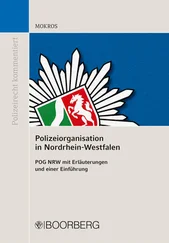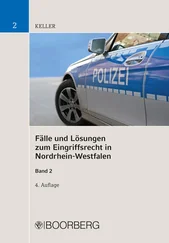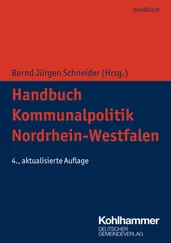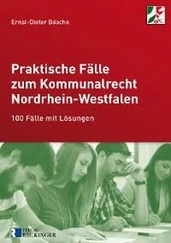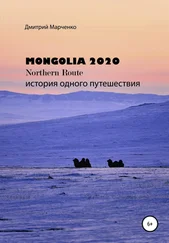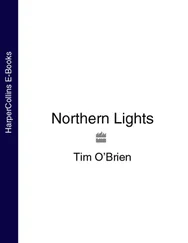Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
Здесь есть возможность читать онлайн «Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
7.Verwaltungsvorstand
Bürgermeister, Beigeordnete und Kämmerer bilden den Verwaltungsvorstand einer Gemeinde, § 70 GO. Im Interesse einer einheitlichen Verwaltungsführung hat das Gremium insbesondere ein Mitwirkungsrecht bei der Aufstellung von Grundsätzen der Organisation und Personalführung oder bei der Aufstellung des Haushalts.
Der Bürgermeister ist verpflichtet, den Verwaltungsvorstand regelmäßig einzuberufen. § 70 Abs. 3 GO bestimmt nunmehr ausdrücklich, dass sich Bürgermeister und Beigeordnete gegenseitig zu beraten und zu unterrichten haben. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Bürgermeister. Die Beigeordneten haben das Recht, abweichende Meinungen bezüglich ihres Geschäftsbereichs dem Hauptausschuss vorzutragen. Darüber haben sie den Bürgermeister vorab zu informieren.
8.Elemente direkter Bürgerbeteiligung
Die Gemeindeordnung enthält einige Elemente direkter Demokratie. Seit dem GO-Reformgesetz im Jahre 2007 kann der Rat mit einer 2/3 Mehrheit seiner gesetzlichen Mitglieder beschließen, dass über eine Gemeindeangelegenheit ein Ratsbürgerentscheid stattfindet, § 26 Abs. 1 GO. Die 2/3-Mehrheit soll, so der Gesetzgeber, verhindern, dass sich der Rat „seiner Verantwortung als Repräsentativorgan“ entziehen kann. Weitere Instrumente direkter Demokratie sind der Einwohnerantrag, § 25 GO, und das Bürgerbegehren mit anschließendem Bürgerentscheid, § 26 GO.
Mit dem Einwohnerantrag, § 25 GO, können alle Einwohner (also auch ausländische Mitbürger) beantragen, dass der Rat über eine Gemeindeangelegenheit berät und entscheidet. Eine bestimmte Entscheidung des Rates kann jedoch nicht vorgegeben werden.
Das Verfahren nach § 26 GO ist zweistufig: Die Bürger können beantragen (Bürgerbegehren), dass sie anstelle des Rates über eine Angelegenheit der Gemeinde selbst entscheiden (Bürgerentscheid). Gemäß § 26 Abs. 2 GO NRW muss ein Bürgerbegehren schriftlich eingereicht werden und die zur Entscheidung zu bringende Frage und eine Begründung enthalten. Des Weiteren ist nun nur noch zu Informationszwecken eine Kostenschätzung der Verwaltung aufzunehmen. § 26 Abs. 2 Satz 7 GO NRW wurde neu eingefügt und ermöglicht zukünftig eine optionale Vorprüfung der Zulässigkeit von Bürgerbegehren, wenn dies Wunsch der Vertretungsberechtigten eines Bürgerbegehrens ist. Allerdings ist für ein entsprechendes Vorprüfungsrecht notwendig, dass mindestens 25 Bürgerinnen und Bürger das Bürgerbegehren zuvor unterzeichnet haben (§ 26 Abs. 2 Satz 8 GO NRW). Über diesen Antrag muss der Rat dann innerhalb einer neuen Achtwochenfrist entscheiden (§ 26 Abs. 2 Satz 9 GO NRW). Allerdings kann der Rat auch eine Hauptsatzungsregelung treffen und dieses Prüfungsrecht dem Hauptausschuss übertragen (§ 26 Abs. 2 Satz 10 GO NRW).
Ein von der Einwohnerzahl der Gemeinde abhängiges Unterschriftsquorum ist einzuhalten. Unzulässig sind Bürgerbegehren, die sich auf Gebiete beziehen, die in § 26 Abs. 5 GO ausdrücklich aufgezählt sind – etwa die innere Organisation der Gemeindeverwaltung oder die Bauleitplanung. Allerdings sind auch Grundsatzentscheidungen im Zusammenhang mit der Bauleitplanung wie Aufstellungsbeschlüsse, die nicht die Abwägungsentscheidung des Rates einschränken, einem Bürgerbegehren zugänglich. So genannte „kassatorische Bürgerbegehren“ – ein Ratsbeschluss soll aufgehoben werden – haben darüber hinaus bestimmte Ausschlussfristen zu beachten.
Der Rat hat unverzüglich über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu entscheiden und kann ggf. selbst dem Begehren entsprechen. Tut er das nicht, so findet innerhalb von drei Monaten der Bürgerentscheid statt. Die dort gestellte Frage darf nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. Entschieden wird nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern diese Mehrheit mindestens – je nach Größe der Gemeinde – 20 %, 15 % bzw. 10 % der Bürger beträgt.
Zulässige Bürgerbegehren entfalten Sperrwirkung, § 26 Abs. 8 GO. Zwischen der Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens und der Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheids dürfen die Gemeindeorgane keine entgegenstehenden Entscheidungen mehr treffen oder vollziehen. Bei zwei sich inhaltlich überschneidenden Bürgerbegehren ist ein Stichentscheid durchzuführen.
9.Absenkung der Schwellenwerte/Interkommunale Zusammenarbeit
Mit dem GO-Reformgesetz vom 9.10.2007 (GV.NRW 2007, S. 373) wurden die Handlungsmöglichkeiten der Kommunen erweitert, damit, so die Begründung des Regierungsentwurfs, „Aufgaben so weit wie möglich vor Ort erfüllt werden können.“ Dazu wurden in § 4 GO die Einwohnerschwellenwerte abgesenkt. Eine kreisangehörige Gemeinde kann auf Antrag zur Mittleren bzw. Großen kreisangehörigen Stadt bestimmt werden, wenn sie mehr als 20 000 bzw. 50 000 Einwohner hat. Kreisangehörige Gemeinden von mehr als 25 000 bzw. 60 000 Einwohnern werden von Amts wegen zur Mittleren bzw. Großen kreisangehörigen Stadt bestimmt. Mit diesem Status einher geht die verpflichtende Übernahme zusätzlicher Aufgaben wie etwa die Bauaufsicht, § 60 Abs. 1 Nr. 3a) Landesbauordnung. Erreicht eine Kommune die genannten Einwohnerzahlen nicht mehr, kann bzw. muss sie ihren Status wieder aufgeben.
Eine „durchgreifende Öffnungsklausel“ (Gesetzesbegründung) für interkommunale Kooperationen schafft § 4 Abs. 8 GO. Benachbarte Kommunen können additiv – auch kreisübergreifend – die Schwellenwerte einer Mittleren bzw. Großen kreisangehörigen Stadt erreichen und auf Antrag einzelne Aufgaben vom Kreis übernehmen und selbst wahrnehmen. Über den Antrag entscheidet die Bezirksregierung; der Kreis ist zu beteiligen, kann den Aufgabenübergang aber nicht verhindern. Diese Regelung ist – soweit ersichtlich – einzigartig in der Bundesrepublik Deutschland und könnte das Verhältnis der kreisangehörigen Gemeinden und der Landkreise auf eine neue Grundlage stellen.
10.Wirtschaftliche Betätigung
Mit dem vom Landtag am 16.12.2010 beschlossenen Gesetz zur Revitalisierung des Gemeindewirtschaftsrechts (GV. NRW. S. 688) ist das Gemeindewirtschaftsrecht wieder in den Stand vor der Gesetzesänderung im Jahr 2007 gebracht worden. Im Wesentlichen bedeutet dies die Herausnahme des Erfordernisses eines „dringenden“ öffentlichen Zweckes. Die Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit der kommunalwirtschaftlichen Betätigung sind damit deutlich verbessert worden. Die Einfügung des § 107a in die Gemeindeordnung definiert den Ordnungsrahmen für die energiewirtschaftliche Betätigung neu, wobei für die Versorgung mit Strom, Gas und Wärme das Vorliegen eines öffentlichen Zwecks gesetzgeberisch fingiert wird. Einzige Zulässigkeitsvoraussetzung im Bereich der energiewirtschaftlichen Betätigung ist das Kriterium der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Die dritte wichtige Änderung betrifft § 108 Abs. 1 Nr. 2 GO. Für Gesellschaftsgründungen im nicht-wirtschaftlichen Bereich müssen die Voraussetzungen des § 8 Abs. 1 GO nicht mehr vorliegen. Der seinerzeitige Verweis auf § 8 GO hat dazu geführt, dass Einrichtungen zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinden nicht in privater Rechtsform bzw. in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts betrieben werden durften. Interkommunale Dienstleistungs- oder Beschaffungsgesellschaften waren also ausgeschlossen. Diese Einschränkung der kommunalen Organisationshoheit ist durch diese Änderung beseitigt worden. Zu einer vierten wichtigen Änderung ist es im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens gekommen. Mit dem neu eingeführten § 108a GO ist für die Unternehmen (§ 107 Abs. 1, § 107a Abs. 1 GO) und die Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO) in Privatrechtsform, in deren Gesellschaftsvertrag ein fakultativer Aufsichtsrat vorgesehen ist, die Möglichkeit einer Arbeitnehmermitbestimmung eingeführt worden. Zur Wahrung der verfassungsrechtlichen Grenzen, die sich aus der verfassungsrechtlich geforderten demokratischen Legitimation der Arbeitnehmervertreter in fakultativen Aufsichtsräten kommunal beherrschter Unternehmen ergeben, ist § 108a GO als „Kann-Vorschrift“ ausgestaltet. Mit Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 3.2.2015 (GV. NRW. S. 208) wurde das Wahlverfahren für die Wahl der Arbeitnehmervertreter durch die Beschäftigten neu geregelt. Die im Kontext mit dieser Änderung stehende Verordnung über das Verfahren für die Wahl der Vorschlagsliste der Beschäftigten für die Bestellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretern in fakultativen Aufsichtsräten (AvArWahlVO) vom 17.2.2015 (GV. NRW. S. 223) regelt das Wahlverfahren. Des Weiteren wurde die Option eröffnet, unter bestimmten Voraussetzungen Aufsichtsratsmandate für Arbeitnehmer mit externen Vertretern zu besetzen. Durch den neu eingefügten § 108b wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, für einen befristeten Zeitraum anstelle der Drittelparität eine vollparitätische Besetzung des fakultativen Aufsichtsrates bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beantragen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.