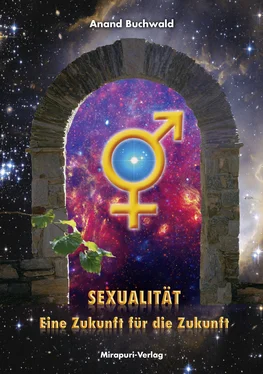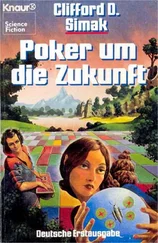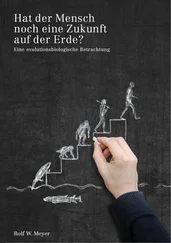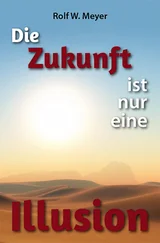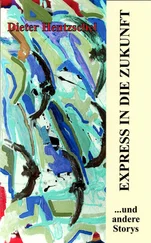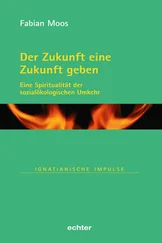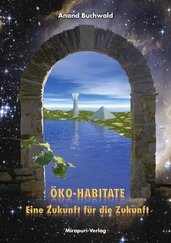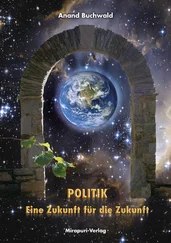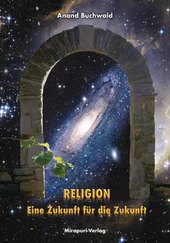Aber die Evolution blieb bei diesem Stadium nicht stehen. Zwar haben verschiedene Insekten wie Ameisen und Bienen bewundernswerte Gesellschaften geschaffen, die in sich sicherlich vollkommen sind, denen aber durch diese Vollkommenheit jeglicher Reiz für eine weitere Entwicklung fehlt. Solche Gebilde, die faktisch ausevolutioniert sind, weisen eine sozialmechanische Natur auf, das heißt, sie vermitteln den Eindruck eines gut funktionierenden Sozialwesens, doch wenn man genau hinsieht, sind alle Begegnungen der Vertreter solcher Völker extrem ritualisiert und beschränken sich auf starre Arbeitsabläufe, die starren und im Wesentlichen unveränderlichen Funktionen zugeordnet sind. Ihre Mitglieder sind, wie andere niedere Vertreter der Fauna, im Grunde genommen biologische Roboter, die ihren vorgegebenen Programmen folgen und zu sozialer Interaktion, die über diese Programme hinausreicht, genauso wenig fähig sind, wie zu Individualität.
Religionen, die sich auf das Naturrecht berufen und sexuelle Betätigung nur zum Zwecke der Zeugung von Nachkommen akzeptieren, bringen damit zum Ausdruck, dass der ideale Mensch wie solch ein Roboter sein soll, der fleißig Nachkommen zeugt und brav seinen – durch die Religion vorgegebenen – Regeln folgt und nicht nach links und rechts schaut.
Die Natur war mit diesem Konzept aber wohl nicht ganz so zufrieden, denn statt die Welt mit sozialmechanischen Völkern aller Art zu besiedeln, entwickelte sie neue Konzepte, die mit dem Aufkommen der Wirbeltiere in den Fischen, den Sauriern, in deren Nachkommen, den Reptilien und Vögeln, und schließlich in den Säugetieren, mit den Menschen als höchsten Vertretern, schrittweise entfaltet wurden. Zu diesen Konzepten gehörten soziale Interaktion und Beziehungsfähigkeit, die für ihre Entwicklung aber einer Art Abgrenzung in Form von Individualität und Bewusstsein bedurften, die parallel dazu eingeführt wurden.
Die erste Ausdrucksform davon ist der Egoismus, den es bis dahin vor allem in Form des Lebenswillens als grundlegender Komponente und nachfolgend des kollektiven Staatsegoismus gab. Dieser Staatsegoismus verhinderte sehr erfolgreich die Entwicklung der Individualität. Und auch heute noch, wo wir uns von der Stufe der Insektenstaaten evolutionär weit entfernt haben, ist dieser Staatsegoismus in der Politik, in der Wirtschaft und der Religion noch präsent und würde es lieber sehen, wenn wir ohne groß zu denken und ohne Abweichungen einfach die vorgegebenen Regeln befolgen und wie geölt funktionieren würden. Die Insektenstaaten sind im Grunde genommen totalitäre Regime, was durch die fehlende Individualität kein Problem darstellt, aber auch keinen gestalterischen und evolutionären Spielraum bietet. Auch unsere gegenwärtigen Machtsysteme haben offen oder versteckt einen Hang zum Totalitarismus und damit zu sozialer und mentaler Stagnation und Unterdrückung von Individualität.
Der Egoismus, also das Sich-Abgrenzen von Anderen, förderte in der sich höher entwickelnden Tierwelt die Auflockerung sozialer Verbände, eine Aufweichung des Gruppenegoismus, das Einzelgängertum, aber auch die Rivalität, sei es in Bezug auf Machtpositionen oder auf Paarungsmöglichkeiten. Die rituellen Aspekte der Sexualität gingen im Verlauf der weiteren Evolution etwas zurück, um mehr Individualität in den Beziehungen zu erlauben, wodurch allerdings auch mitunter blutige Beziehungskämpfe und später Balzrituale häufiger Teil der sozialen Dynamik wurden. Der Paarungstrieb war weiterhin vorhanden, aber er verlor in der evolutionären Entwicklung langsam ein wenig von seinem zwanghaften Charakter. Während es etwa in der Insektenwelt und anderen Bereichen Usus war, dass sich die Befruchtungspartner nur zum Zweck der Kopulation zusammenfanden und nach dieser wieder ihrer getrennten Wege gingen und bei Fischen und Amphibien die Befruchtung außerhalb des Körpers und ohne Sex stattfindet, was kaum zur Bildung von Paaren, Familien oder Verbänden führte, wurde die Paarung nun ein zunehmend persönlicher Akt mit Familien- und bisweilen Rudelbildung und gemeinsamer Brutpflege. Dabei wandelte sich auch die Rolle der Sexualität, beziehungsweise erweiterte sie sich. Bei Tieren, die in Verbänden leben, gibt es oft ein Alphatier, das alleinige oder überwiegende Kopulationsrechte besitzt und diese nicht nur durch Rangkämpfe verteidigt, sondern auch durch häufigen Sex mit seinem Harem. Hier dient die Sexualität nicht mehr nur der Fortpflanzung, sondern wird bereits durch eine deutliche soziale Komponente ergänzt.
Diese gewinnt bei individuelleren und sozialeren Gemeinschaften zunehmend an Bedeutung. Paradebeispiele dafür sind die Bonobos. Bei dieser Schimpansenart, die auch Oralverkehr und Masturbation kennt, dient sexuelle Interaktion, die dann alters-, geschlechts- und rangunabhängig stattfindet, auch dem Aggressionsabbau, der Festigung sozialer Beziehungen und auch schon mal dem Erbetteln von Nahrung und scheint eine ganz normale, fast beiläufige Tätigkeit zu sein, wenn sie nicht gerade der Zeugung dient.
Unterstützt wird diese Entwicklung auch durch entsprechende biologische Veränderungen im Verlauf der Evolution. So ist da, wo die sexuelle Betätigung einzig dem Zwecke der Zeugung von Nachkommenschaft dient, der Drang zur Kopulation eher von zwanghaftem Charakter und auch nur kurzzeitig oder saisonal wirksam. In diesen Fällen bedeutet Kopulation auch fast immer eine Befruchtung. Evolutionsbiologisch ist so ein Verfahren natürlich sinnvoll, weil man sich in der übrigen Zeit um das eigene Überleben kümmern und neue Energien tanken kann. Trotzdem hat die Evolution auch Verfahren entwickelt, bei denen die Empfängnisbereitschaft länger anhält und mehrere Befruchtungsversuche nötig sind, um Nachwuchs zu zeugen. Da dabei auch oft mehrere Männchen beteiligt sind, liegt der Grund dafür wahrscheinlich darin, eine Spermienkonkurrenz zu erzeugen, bei der sich die kompatibelsten oder stärksten durchsetzen.
Wenn sich die möglichen Kopulationsperioden aber ausdehnen, verliert dieser Punkt ein wenig an Gewicht und es kommt ein weiteres Element hinzu. Zumindest in der höher entwickelten Tierwelt bildet sich durch den Sex das auch beim Menschen gut bekannte Oxytocin. Dieses Hormon fördert – nicht nur bei Paaren – die Bindungsfähigkeit und auch die sexuelle Lust und ist damit auch am Zusammenhalt der Gruppe maßgeblich mitbeteiligt. Da die Oxytocin-Ausschüttung als angenehm empfunden wird, strebt man danach, die Produktion in Gang zu halten oder sie immer wieder anzustoßen, was auch durch Berührung möglich ist, also etwa durch Fellpflege und Kuscheln. Am stärksten scheint aber die sexuelle Betätigung zu wirken. Da aber dauernder Sex bei Tieren, die immer empfängnisbereit sind, schnell zu Überpopulationen führen würde, hat sich im Laufe der Evolution die Befruchtungswahrscheinlichkeit verringert, so dass für die Zeugung von Nachkommenschaft mehr Sex notwendig ist.
Natürlich folgt die Evolution im Einzelnen nicht einer durchgängigen, klaren Linie, sondern vielen Wegen, die einander vielleicht auch widersprechen, aber eine gewisse Tendenz, die im Entstehen des Menschen kulminiert, ist durchaus erkennbar. Die Natur hat sich von den sozialmechanischen Gesellschaften und biologischen Robotern im Verlauf der Evolution hin zu mehr Bewusstsein, mehr Individualität und mehr Freiheit entwickelt. Dabei wurde die Fähigkeit zu sozialer Interaktion gefördert und die Sexualität von ihrer zwanghaften Natur befreit, von ihrer Funktion für den Erhalt der Art entkoppelt und für neue Funktionen sozialer und emotionaler Art geöffnet.
Und am vorläufigen Ende dieser Entwicklung steht der Mensch, bei dem die Sexualität sehr vielfältige Funktionen erfüllt. Die Fortpflanzung, der Ausgangspunkt der Sexualität, erfolgt nicht mehr zwanghaft, sondern kann bewusst durchgeführt werden, wodurch der Mensch, zumindest theoretisch, über das Mittel verfügt, eine drohende Überbevölkerung zu regulieren, wenn er lernt, global zu denken und bewusst zu handeln. Und das Bewusstsein ist auch der Knackpunkt bei den ganzen Problemen, die uns die Sexualität zu bescheren scheint, denn für sich allein genommen, ist die Sexualität problem- und wertfrei.
Читать дальше