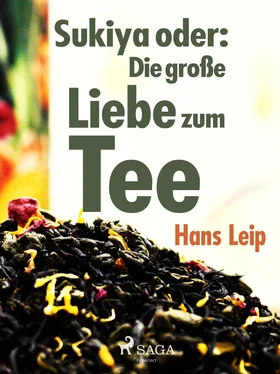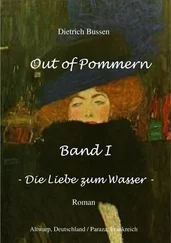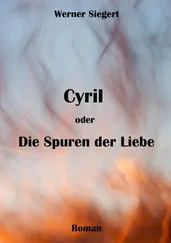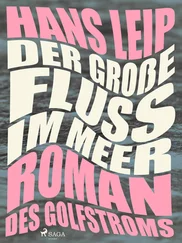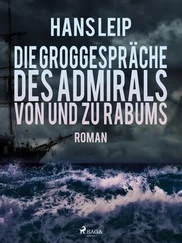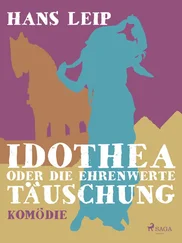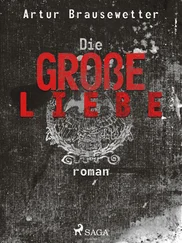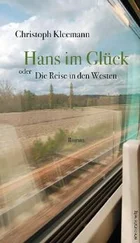Japan übernahm geschickt, wie heute manch anderes auswärtige Erzeugnis, auch die buddhistische Legende, doch war man begabt genug, sie sich abzuwandeln. Merkwürdig ist, daß die japanischen Schriftzeichen für Tee und Augenlid sich gleichen. Ist damit das Wachhalten symbolisiert und entstand die seltsam grausliche Fassung der Legende daraus wie die Handlung aus einem Stichwort? Der Franzose Edmond Goncourt schreibt in seinem berühmten Tagebuch an einem trüben Apriltag 1892 diese Teelegende auf, obwohl er selber – wie Balzac und Voltaire – dem gröberen Kaffeeverbrauch huldigte: Dharma, ein im Geruch der Heiligkeit stehender Büßer, hatte sich den Schlaf als ein allzu menschliches Bedürfnis untersagt. Trotzdem schlief er eines Nachts ein und erwachte erst am Morgen. Erbost über sein Versagen, schnitt er sich die Augenlider ab und warf sie von sich als die schuldigen Vertreter gemeiner Körperlichkeit, die ihn auf dem Wege zur Vollendung behindert hatten. Kaum hatten die blutigen Augendeckel den Boden berührt, faßten sie Wurzel. Ein Baum sproß daraus hervor. Nachbarn und Verehrer kamen, sammelten die Blätter und bereiteten einen Trank daraus, um der heiligen Schlafvertreibung ein wenig teilhaftig zu werden, und siehe da, das Mittel erwies sich als wirksam und war zudem von köstlichem Duft und Geschmack.
Hätte Goncourt die Teelegende mit den abgeschnittenen Augenlidern genau durchdacht, wäre darin nicht nur ein Baum aus den beiden blutigen Fetzen gewachsen, sondern zwei und sogar zwei verschiedene. Botanisch gibt es nämlich zwei Urteebäume, einen chinesischen und einen indischen. Der erstere soll wild wachsend bis vier Meter hoch werden, der andere, zu Assam erst im Jahre 1825 durch Oberst Bruce entdeckt, bis dreißig Meter. Aber man läßt auch diese Bäume nicht in den Himmel wachsen, man hält sie buschklein, so daß die pflückenden Hände überall hinreichen können und der Saft sich in den Zweigspitzen sammelt, von denen jeweils nur eine Knospe und die obersten zwei oder drei Blätter gepflückt werden. Die Blättchen sind völlig duftlos und anfangs seidig behaart, später kahl und ledrig. Auf die kirschartigen Blüten, weiß oder rosa, legt man keinen Wert, so jasminduftig sie auch sind. Der Teestrauch ist eine immergrüne Pflanze aus der Familie der Kamelien, eine Dschungelpflanze, die sandigen Lehmboden liebt und tief wurzelt, nicht unähnlich der Rose. Feuchte und Sonne sind ihr unentbehrlich, doch hält sie Frost bis zu fünf Grad aus. Sie wird aus Samen gezogen, ist nach drei bis sechs Jahren Kultivierung erntereif und vermag dann unter günstigen Bedingungen ein halbes Jahrhundert lang guten Tee zu liefern. Meine alte Teedose aber mit den hübschen Pflückerinnen ist nur noch ein vages Abbild der Tatsachen. Soviel schöne Mädchen, Frauen und Kinder, wie zur vorbildlichen Ernte nötig wären, gibt es bei dem ungeheuer angeschwollenen Anbau nicht mehr. Auf manchen Plantagen werden schon Pflückmaschinen eingesetzt. Ganz edle Sorten jedoch werden noch heute mit Handschuhen gepflückt, so im japanischen Orte Uji, wo nur für den Hof erzeugt wurde und wo auch das Teedenkmal im Tempel steht.
Die flink mit Daumen und Zeigefinger gepflückten Blättchen werden über die Schulter in eine Kiepe geworfen, die vollen Kiepen in die Trockenhäuser geschafft und dort auf Gestellen ausgebreitet, wo sie welken und dann weich genug sind, um in Maschinen gerollt zu werden, wobei sich der Saft leicht gärend mit dem Sauerstoff der Luft vermischt und die ätherischen Öle nebst wichtigen Bakterien sich entfalten. Dann werden sie gekühlt und danach geröstet, bis dieses bräunliche bis graue und schwarze, zierliche, brüchige, knistrige, mild duftende Gekrümel entsteht, das man als Tee kennt.
Indien ist heute der größte Teelieferant der Welt. Sein umfänglichstes Teegebiet liegt im Nordosten, in Assam. Darjeeling, ein stilles Städtchen, gab den Namen für die berühmten Ernten am Südhang des Himalaja in zweitausend Meter Höhe. Ceylon wurde zum zweitgrößten Teeproduzenten erst durch eine Tragödie. 1870 vernichtete eine Mehltauseuche seine großen Kaffeekulturen. Die verzweifelten Anbauer versuchten es dann mit Tee. Und siehe, es gelang über die Maßen.
Wie nun Dichter meistens recht haben, hat auch Goncourt eigentlich recht mit seinem einen Baum. Denn der heutige Teestrauch ist eine dienliche Mischung aus der chinesischen und der indischen Art, eine Hybride, deren Weiterzüchtung sich weithin bewährt. Namentlich auf Java erzielte man gute Erfolge mit ihr.
Daß die jungen Staaten Afrikas sich der lohnenden Teepflanzung widmen würden, war vorauszusehen. Das Klima und die Bodenverhältnisse sind in Kenia und Uganda günstig, Tanganjika, Njassaland und der Kongo werden nicht zurückstehen, in Mozambique gibt es seit 1920 portugiesische Teeplantagen und auf der Insel Mauritius schon für Eigenbedarf seit 1770. Ein zentraler Teemarkt mit zweiwöchentlicher Auktion befindet sich seit 1957 in Nairobi. Die Bedeutung des afrikanischen Teeanbaus für den Weltmarkt wird von Saison zu Saison größer, da Ernteergebnisse, Aufbereitung und Qualität laufend verbessert werden. Auch die Anbauflächen wachsen rapid. Sehr oft sind es Inder, seit Generationen in Ostafrika beheimatet, die sich mit dem Teeanbau befassen.
Auch Versuche, in Mittel- und Südamerika Tee zu pflanzen, blieben nicht ohne Erfolg. Argentinien und Brasilien weisen beachtliche Exportziffern auf, und in letzter Zeit sind es Peru und Ecuador, die sich darum bemühen, in die Familie der Teeproduzenten mit aufgenommen zu werden.
Hier soll aufgezählt werden, was auf den europäischen Hauptmärkten London, Hamburg, Amsterdam, Bremen, Marseille und Odessa als gängig angeboten wird.
Grüner Tee , in Japan beliebt und lange auch in den USA, wo er aber oft mit Berliner Blau aufgefärbt und gewürzt mit Iriswurzel und Gardeniablüten in den Handel kam. Die Blattfarbe wird durch Wasserdampf gefestigt, und er bleibt unfermentiert. Sein Jasminduft täuscht. Er schmeckt ziemlich bitter, auch bei schwachem Aufguß, hat in Europa nur wenige Liebhaber. Es gibt da z. B. die Marke Basket Fried aus Japan. Gunpowder (Schießpulver) wird ein grüner Tee genannt, dessen Blättchen wie Schrotkugeln gerollt sind und wie Patronenfüllungen aussehen. Diese Sorte wird sowohl in einigen indischen Faktoreien als auch auf Ceylon und Formosa erzeugt. Es ergibt ein blasses, von einigen Feinschmeckern geschätztes Getränk.
Schwarzer Tee ist viel lieblicher im Geschmack als der unfermentierte grüne Tee und wird heute fast ausschließlich getrunken. Jeder Tee kann zu schwarzem Tee verarbeitet werden, indem er nach dem Welken der Teeblätter und nach dem Rollen entsprechend lange fermentiert wird. Die Fermentierung erfolgt ohne jegliche Zusätze lediglich durch Einwirkung des Sauerstoffes. Und ein so hergestellter schwarzer Tee, speziell aus Indien und Ceylon – den Hauptanbaugebieten von Qualitätstees –, sollte grundsätzlich auch immer ohne Zusätze bleiben.
Als schwarze Tees mit Zusätzen sind heute eigentlich nur noch der Jasmintee, dem nachträglich Jasminblüten zugesetzt werden, sowie der Earl Grey, dem nachträglich Bergamotteöl hinzugefügt wird, bekannt. Solche Tees verlieren aber immer ihren wertvollen Charakter, da der eigentliche Teegeschmack durch jedweden Zusatz verlorengeht.
Der Tee wird in Ceylon fast das ganze Jahr hindurch geerntet, wohingegen sich die Erntezeiten in Indien auf gewisse besonders günstige Perioden konzentrieren. Die erste Ernte zu Beginn der jährlichen Pflückungsperiode ist der »first flush«, ein Tee, der von den Händlern sehr teuer verkauft wird. Interessanter aber ist noch die darauffolgende zweite Pflückung, der sogenannte »second flush«, der eigentlich die besten Teequalitäten liefert.
Читать дальше