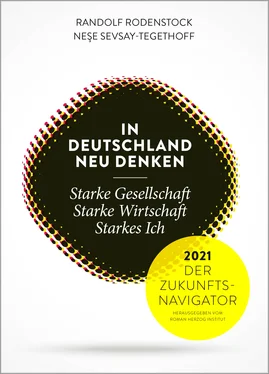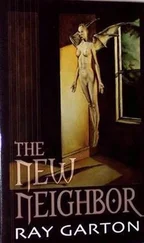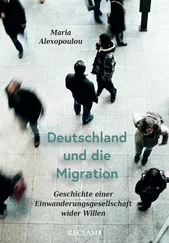Festzuhalten bleibt, dass die Kernindikatoren der Einkommens- und Vermögensungleichheit innerhalb der letzten Dekade eine bemerkenswert stabile Entwicklung aufweisen. Es lässt sich zwar mit Recht kritisch hinterfragen, warum die Ungleichheit trotz der positiven Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre nicht eindeutig sinkt. In diesem Zusammenhang lassen sich die weiterhin steigende Nachfrage nach hoch qualifizierten Arbeitskräften und dem damit einhergehende Druck auf gering qualifizierte Arbeitsverhältnisse, ein zunehmender Trend zum Alleinleben oder auch die Migrationsbewegungen der letzten Jahre als einordnende Faktoren nennen. Unabhängig von der Bewertung dieser Erklärungsfaktoren verbleibt aber der Befund, dass die Wahrnehmung bezüglich der Entwicklung der Verteilungsverhältnisse deutlich negativer ausfällt, als es die konventionellen Verteilungsindikatoren nahelegen.
Reich sind immer die anderen
Gemäß der bereits zitierten Civey-Erhebung im Auftrag von Spiegel Online halten 74,8 Prozent der Befragten die Verteilung der Einkommen respektive die Verteilung der Vermögen für eher oder auf jeden Fall für ungerecht.8 Auch hier stellt sich die Frage, wie die Verteilungssituation überhaupt von den Bürgern wahrgenommen wird. Aufschluss ergibt in diesem Zusammenhang eine Befragung zur subjektiven Wahrnehmung von Armut und Reichtum, deren Ergebnisse im Rahmen des zweiten Symposiums zur Vorbereitung des 6. Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung vorgestellt wurden.9 Bei der Frage, ab welchem persönlichen Nettomonatseinkommen eine Person in Deutschland als arm gilt, liegen die Befragten mit Werten in der Nähe von 1000 Euro nicht nur nahe beieinander, sondern auch in der Nähe der Schwelle, die am häufigsten im Kontext der Berichterstattung über Armut verwendet wird. Im Mikrozensus 2019 liegt die sogenannte Armutsgefährdungs- oder auch Niedrigeinkommensschwelle für einen Alleinstehenden beispielsweise bei 1074 Euro monatlich, in der aktuell verfügbaren Welle des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) bei 1168 Euro im Jahr 2017.10 Die Werte auf Basis des SOEP liegen trotz des früheren Bezugszeitraumes höher, da bei dem detaillierteren Einkommenskonzept ebenfalls unregelmäßige Einkommenskomponenten und Mietvorteile aus selbst genutztem Wohneigentum berücksichtigt werden. Je nach Datensatz und Befragungszeitpunkt lagen in den letzten Jahren zwischen 16 und 17 Prozent der Bevölkerung mit ihrem verfügbaren Einkommen unter diesem Schwellenwert. Die meisten Bundesbürger glauben jedoch, dass in Deutschland mehr als 30 Prozent der Menschen als arm gelten.
Bei den Einschätzungen zum Thema Reichtum gehen subjektive Wahrnehmungen und statistische Messungen noch weiter auseinander. Die Reichtumsschwelle der amtlichen Statistik liegt bei dem Doppelten des Medianeinkommens der Gesamtbevölkerung. Das Medianeinkommen ist genau das Einkommen, welches die Gesellschaft in eine Hälfte mit niedrigerem und eine Hälfte mit höherem Einkommen aufteilt. Auf Basis der höheren Einkommen des SOEP zählte demnach ein Alleinstehender im Jahr 2017 zu den relativ Reichen, wenn er über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als rund 3890 Euro verfügte. Bei einer Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren liegt der entsprechende Schwellenwert zum relativen Einkommensreichtum bei einem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen in Höhe von 8170 Euro. Mit mehrheitlichen Nennungen zwischen 7000 und 10 000 Euro liegen die Schwellenwerte, ab denen jemand in der subjektiven Vorstellung der Bundesbürger als reich gilt, deutlich höher.
Wegen der deutlich höheren subjektiven Reichtumsgrenzen ist es wenig überraschend, dass die (mediale) Kommunikation der statistischen Reichtumsschwellen regelmäßig zu Verwunderung führt. In den Reaktionen auf die Berichterstattung werden viele Gründe gefunden, warum man trotz eines Einkommens oberhalb des Schwellenwerts noch nicht als reich gilt. Sicherlich entspricht die amtliche Reichtumsschwelle nicht dem typischerweise kolportierten Bild eines Reichen, der Villen und Luxusyachten besitzt und völlig frei von materiellen Risiken lebt. Man sollte sich jedoch vor Augen führen, dass nur rund sieben Prozent der deutschen Bevölkerung über ein Einkommen oberhalb der zitierten Schwellenwerte verfügen – also bereits zum häufig zitierten oberen Zehntel der Gesellschaft zählen.
In der Wahrnehmung der Bevölkerung gibt es jedoch deutlich mehr Reiche. Die meisten Schätzungen zum vermuteten Anteil Reicher liegen oberhalb der 20-Prozent-Marke – und das, obwohl die Befragten gleichzeitig deutlich höhere subjektive Reichtumsgrenzen zugrunde legen. Zur Einordnung: Würde man beispielsweise nur diejenigen als »wirklich« reich definieren, die mit einem zu versteuernden Einkommen von 265 000 Euro der Reichensteuer unterliegen (bei einem Alleinstehenden entspricht dies monatlich knapp 12 000 Euro netto), dann zählten hierzu im Jahr 2018 nach Schätzungen der Bundesregierung rund 163 000 Personen 11 und somit weniger als 0,2 Prozent der Bevölkerung.
Die meisten Bundesbürger vermuten somit höhere Anteile armer und reicher Menschen, als es die Daten zu der Thematik nahelegen. Auch Abfragen zur vermuteten gesellschaftlichen Form – ohne konkreten Einkommensbezug – deuten darauf hin, dass die Wahrnehmung der Gesellschaft von den konventionellen statistischen Auswertungen abweicht. In unterschiedlichen Erhebungsformaten ist die Mehrheit der Deutschen der Auffassung, dass die deutsche Gesellschaft am ehesten der Form einer Pyramide ähnele.12 Auch wenn es unterschiedliche Bewertungen darüber gibt, ob die Mittelschicht einer stabilen oder schrumpfenden Entwicklung folgt, sind sich Schichtanalysen einig in dem Befund, dass die Mittelschicht die größte Gruppe der Bevölkerung darstellt. Ähnlich wie bei der Entwicklung der Ungleichheit wird somit auch die gesellschaftliche Struktur wesentlich pessimistischer wahrgenommen, als es Indikatoren zur Schichtabgrenzung für Deutschland nahelegen.
Positive Wahrnehmung der eigenen Situation
Neben der tatsächlichen Entwicklung der Verteilungsindikatoren steht häufig die Vermutung im Raum, dass sich bereits vor der Corona-Krise viele Menschen von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt fühlten und Abstiegsängste weit verbreitet seien. Befragungsdaten können dieses Bild jedoch nicht bestätigen. Im Gegenteil: In der aktuell verfügbaren SOEP-Erhebung des Jahres 2018 machen sich anteilig so wenige Menschen Sorgen um ihre eigene wirtschaftliche Situation wie zu keinem Zeitpunkt seit Beginn der Befragung im Jahr 1984. Die positiven Einschätzungen decken sich mit Beobachtungen aus der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften. Der Anteil derjenigen, die das Gefühl haben, dass sie weniger als den gerechten Anteil am Lebensstandard erhalten, ist in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Bei der subjektiven Selbsteinordnung sortieren sich immer mehr Menschen in höhere Schichten. Auf einer zehnstufigen Oben-Unten-Skala sortierten sich im Jahr 2018 rund 50 Prozent der Bevölkerung bei einer Sieben oder höher ein. Im Jahr 2006 lag der entsprechende Anteil bei 25 Prozent. Zum damaligen Zeitpunkt fühlten sich deutlich mehr Befragte der Mitte und unteren Mitte der Skala zugehörig. Einhergehend mit der positiven Beschäftigungsentwicklung vor der Corona-Krise zeigt sich auch bei der Entwicklung der Sorgen um den Arbeitsplatz ein überaus positives Bild. Im Jahr 2018 gaben beinahe drei Viertel der Erwerbstätigen an, dass sie sich überhaupt keine Sorgen machen, weniger als fünf Prozent machten sich große Sorgen um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes.
Es ist wichtig zu betonen, dass diese Befunde keinesfalls implizieren, dass es vor der Corona-Krise keine finanziellen Sorgen gab. Hinter den verbleibenden knapp zehn Prozent der befragten erwachsenen Bevölkerung, die sich im Jahr 2018 große Sorgen um ihre finanzielle Situation machten, steht die substanzielle Zahl von knapp sieben Millionen Erwachsenen, die ihre finanzielle Lage mit großer Besorgnis beurteilen. Im Jahr 2005 teilten jedoch noch knapp 19 Millionen Erwachsene im SOEP diese Einschätzung.
Читать дальше