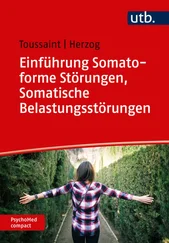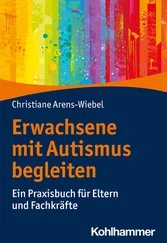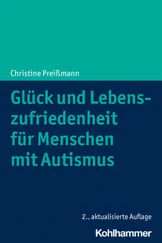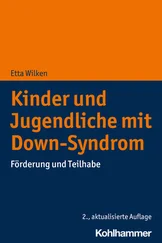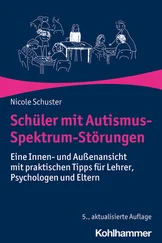Das KOMPASS-Training, das auf prozess- und ressourcenorientierte Aspekte fokussiert, entstand aus der Auseinandersetzung mit den Autismus-spezifischen Bedürfnissen und dem Versuch zu verstehen, wie autistische Menschen die Welt wahrnehmen und erleben. Mitterhuber und Wolschlager (2001) betonen, dass erst ausreichendes Wissen um eine Störung und deren Entstehungsbedingungen empathisches Mitvollziehen, eine Zugangsweise zu fremden und zunächst unverständlichen Erlebensformen und entsprechend ein Beziehungsangebot ermöglicht (»wissendes Verstehen«, S. 149). Auch bei autistischen Menschen muss das therapeutische Angebot im Sinne der Grundhaltungen »in Entsprechung zu den Wahrnehmungsmöglichkeiten und zum Kontaktverhalten der Klienten umgesetzt werden« (Mitterhuber und Wolschlager 2001, S. 149). Der Therapeut muss sich immer die Frage stellen, worauf sich die Empathie zu richten hat, was ein Verständnis für die autistische Wahrnehmungswelt bedingt.
Langjährige eigene klinische Erfahrung der Autoren wie auch die Literatur (z. B. von Zülow 2009) zeigen, dass eine hilfreiche psychologische Haltung bei autistischen Menschen klarer strukturiert, weniger gesprächsorientiert und konkreter erfolgen muss, als dies bei anderen Klientengruppen notwendig ist. Eine auf die autistische Person zentrierte Therapie muss auch deren Anliegen ernst nehmen, ihre Entwicklungsdefizite kompensieren zu wollen. Eine nachhaltige Möglichkeit, die den Klienten auch bald befähigt, neue soziale Erfahrungen zu machen, besteht zum Beispiel darin, ihm – angeleitet durch Fragen oder Beobachtungsübungen – dabei zu helfen, die impliziten Informationen über die nicht-autistische soziale Welt, in welcher er leben muss und oft auch leben möchte, zu entdecken, und ihm diese dann zur Verfügung zu stellen (  Kap. 2.1). Aufgrund der störungsspezifischen Voraussetzungen und dem Verständnis der spezifischen Bedürfnisse autistischer Menschen ergänzt die therapeutische Vorgehensweise eine konkrete Informationsvermittlung und handlungsorientierte Übungen (Jenny und Schär 2010). Auf dieser Basis wurden im KOMPASS-Training auch auf der Ebene der therapeutischen Techniken vielfältige Mittel eingesetzt.
Kap. 2.1). Aufgrund der störungsspezifischen Voraussetzungen und dem Verständnis der spezifischen Bedürfnisse autistischer Menschen ergänzt die therapeutische Vorgehensweise eine konkrete Informationsvermittlung und handlungsorientierte Übungen (Jenny und Schär 2010). Auf dieser Basis wurden im KOMPASS-Training auch auf der Ebene der therapeutischen Techniken vielfältige Mittel eingesetzt.
Auf der Ebene der therapeutischen Methoden werden auch viele verhaltenstherapeutische Techniken wie Prompting, Shaping und Chaining eingesetzt (  Kap. 2.1). Es erfolgt aber weder eine Verhaltensanalyse noch werden Techniken wie zum Beispiel Entspannungsübungen, Selbstinstruktionen oder systematische Verstärkersysteme für Verhaltensweisen eingesetzt. Auch methodische Überlegungen des TEACCH-Ansatzes wurden aufgegriffen (
Kap. 2.1). Es erfolgt aber weder eine Verhaltensanalyse noch werden Techniken wie zum Beispiel Entspannungsübungen, Selbstinstruktionen oder systematische Verstärkersysteme für Verhaltensweisen eingesetzt. Auch methodische Überlegungen des TEACCH-Ansatzes wurden aufgegriffen (  Kap. 2.1).
Kap. 2.1).
Sich auf die Person und die Gruppe als Ganzes zu konzentrieren bedeutet, dass jede Sitzung je nach Persönlichkeit und intellektuellem, sozialem und emotionalem Entwicklungsstand der Teilnehmer, je nach Gruppenprozess, aktueller Gruppendynamik und Verlauf der vorhergehenden Sitzungen neu geplant werden muss. Der aktuelle Gruppenprozess oder wichtige Anliegen einzelner Gruppenmitglieder sind immer wichtiger als die geplanten Lektionen. Vorrang vor pädagogischen Zielen haben stets die Beziehungsklärung und -verbesserung (Behr 1989). Wann immer im Gruppenverlauf Fragen auftauchen, die die Beziehungsgestaltung der Teilnehmer untereinander oder zu den Therapeuten betreffen, werden diese angesprochen. Meistens erfolgt dies im Plenum, manchmal aber auch nur unter den Betroffenen. Die Übungen und Informationen über das implizite soziale Wissen sind nur dann hilfreich und der sozialen und kommunikativen Entwicklung des Betroffenen nachhaltig förderlich, wenn sie in die therapeutische Beziehung und das reale Gruppengeschehen eingebettet sind. Entsprechend werden die Ziele in den Bereichen Emotionen, Small Talk und Nonverbale Kommunikation in jeder Gruppe auf etwas anderen Wegen erreicht. Das KOMPASS-Praxishandbuch ist daher eine thematisch geordnete Sammlung von Materialien, die sich bewährt haben, und kein Manual mit fertig geplanten Gruppenstunden.
Das KOMPASS-Gruppentraining umfasst mit dem psychotherapeutischen auch einen pädagogischen Anteil, der für die Strukturierung von Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten (Specht 1993) verantwortlich ist. Die Forderung von Rogers (1988), wonach Kompetenzen gelehrt werden sollen, die ein flexibles Reagieren auf eine sich verändernde Umwelt erlauben, wird erfüllt. Dies ist für autistische Menschen existentiell wichtig: Die soziale Umwelt besteht nur aus Veränderung.
Eine ausführliche Diskussion der personzentrierten Basis des Vorgehens bei KOMPASS findet sich in Jenny und Schär (2010).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
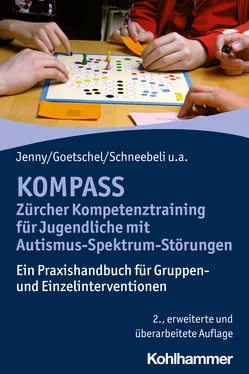
 Kap. 2.1). Aufgrund der störungsspezifischen Voraussetzungen und dem Verständnis der spezifischen Bedürfnisse autistischer Menschen ergänzt die therapeutische Vorgehensweise eine konkrete Informationsvermittlung und handlungsorientierte Übungen (Jenny und Schär 2010). Auf dieser Basis wurden im KOMPASS-Training auch auf der Ebene der therapeutischen Techniken vielfältige Mittel eingesetzt.
Kap. 2.1). Aufgrund der störungsspezifischen Voraussetzungen und dem Verständnis der spezifischen Bedürfnisse autistischer Menschen ergänzt die therapeutische Vorgehensweise eine konkrete Informationsvermittlung und handlungsorientierte Übungen (Jenny und Schär 2010). Auf dieser Basis wurden im KOMPASS-Training auch auf der Ebene der therapeutischen Techniken vielfältige Mittel eingesetzt.