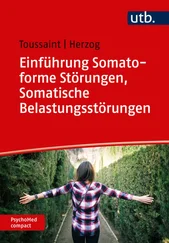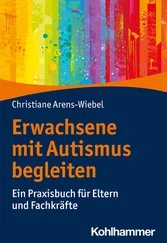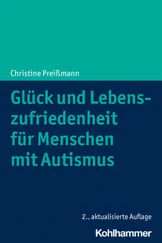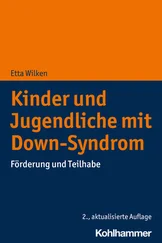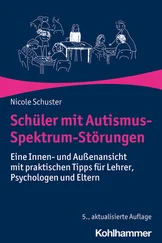• Vermeulen (2002) hat das psychoedukative Programm Ich bin was Besonderes für Eltern, Lehrpersonen und Therapeuten zusammengestellt, die anhand praktischer Arbeitsmaterialien einem Kind oder Jugendlichen (ab einem Entwicklungsalter von vier Jahren) im Einzelsetting oder in einer Gruppe die Diagnose erklären möchten.
• The »I LAUGH« Approach wurde als sozial-kognitives Trainingsprogramm für Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung von Winner (2002, 2003) im Rahmen ihrer Arbeit als Logopädin und Therapeutin an einer amerikanischen High-School zusammengestellt.
• Csoti (2003) hat einen manualisierten Kurs Social Awareness Skills for Children für Kinder im Alter von sieben bis 16 Jahren mit Autismus-Spektrum-Störungen und anderen Verhaltensauffälligkeiten zusammengestellt, der ursprünglich von Fachpersonen (z. B. Therapeuten, Lehrpersonen) oder Eltern im Einzelsetting durchgeführt wird, dessen Materialien aber auch in einem Gruppensetting bearbeitet werden können.
• Cornish und Ross (2004) haben ein manualisiertes Gruppentraining für Jugendliche mit Asperger-Syndrom und anderen Verhaltensauffälligkeiten im Alter von 13–17 Jahren für Schulen entwickelt, das Social Skills Training for Adoles-cents with General Moderate Learning Difficulties.
• Kiker Painter (2006) hat das Gruppenprogramm für Kinder und Jugendliche Step-by-Step Program für Social Skills Groups for Children and Adolescents with Asperger’s Syndrome ausgearbeitet, das sich an Kliniker, Lehrpersonen und weitere Fachpersonen richtet.
• Schließlich finden sich vor allem auf dem amerikanischen Markt noch viele nicht evaluierte Manuale, mithilfe derer vor allem Lehrpersonen und Eltern mit Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung gezielt an grundlegenden sozialen Fertigkeiten arbeiten können. Die Social Stories von Gray (1994a, 1998) und das Konzept der Comic Strip Conversations von Gray (1994a, 1998), aber auch das Hidden Curriculum und die Technik der Social Autopsies von Bieber (1994) sind gerade auch im Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen von Kindern mit Autismus ein bewährtes Mittel.
1.7 Entwicklung des Zürcher KOMPASS-Trainings
Für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung kann nicht auf bereits vorhandene Interventionsprogramme zurückgegriffen werden, da diese bestimmte grundlegende sozio-kognitive Fähigkeiten (z. B. das Erfassen von emotionalen und mentalen Zuständen des Gegenübers) und Fertigkeiten (z. B. den kommunikativen Austausch) voraussetzen, die den Kindern fehlen (Ozonoff und Miller 1995; Rao et al. 2008). Rao et al. (2008) fordern die Entwicklung einfach handhabbarer Manuale, die in der natürlichen Umwelt der Kinder wie etwa der Schule oder dezentralen Versorgungseinrichtungen implementiert werden können. Seit 2004 wird daher das Gruppentraining KOMPASS am Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich von den beiden Psychologen und personzentrierten Psychotherapeuten Bettina Jenny und Philippe Goetschel entwickelt und durchgeführt.
Das Vorgehen, das von Jenny (2010; Jenny und Schär 2010) beschrieben wird, entspricht in etwa den Vorschlägen von Smith et al. (2006), wie die Forschung zu psychosozialen Behandlungsprogrammen für Menschen mit einer autistischen Störung aufgebaut werden soll. Bereits früher wurde ein Gruppenkonzept für nicht-autistische Kinder mit einem Mangel an sozialen und emotionalen Kompetenzen entwickelt, erprobt und evaluiert (Jenny et al. 2006; Jenny und Käppler 2008). Die Therapeuten blicken auf eine langjährige einzeltherapeutische Erfahrung mit nicht-autistischen und autistischen Kindern und Jugendlichen und weisen ein breites Erfahrungsspektrum in der Diagnostik und Beratung von Kindern mit einer autistischen Störung auf. Schließlich wurde 2004 ein Gruppentraining als Pilotprojekt durchgeführt, das Konzept wurde verbessert, erweitert und im Praxishandbuch niedergeschrieben. Als letzter Schritt erfolgte die 2018 abgeschlossene Evaluation zur Wirksamkeit des Sozialtrainings im Vergleich zu einer Warte-Kontrollgruppe (  Kap. 7). Unterdessen wurde auch das KOMPASS-F-Training für Fortgeschrittene publiziert (Jenny et al. 2019). Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung im hochfunktionalen Bereich richtet, die bereits das hier beschriebene KOMPASS-Basistraining erfolgreich besucht haben.
Kap. 7). Unterdessen wurde auch das KOMPASS-F-Training für Fortgeschrittene publiziert (Jenny et al. 2019). Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung im hochfunktionalen Bereich richtet, die bereits das hier beschriebene KOMPASS-Basistraining erfolgreich besucht haben.
Entsprechend anderen aktuellen Ansätzen wurde mit KOMPASS bewusst keine Gruppentherapie, sondern ein Gruppentraining entwickelt. In der Gruppentherapie wird das Gruppengeschehen mit den wechselseitigen Beziehungen als therapeutischer Prozess genutzt und die Gruppe als Medium für zu korrigierende emotionale Erfahrungen verstanden (Haar et al. 1979). Ziel ist eine intrapsychische Veränderung. Im Gruppentraining hingegen werden bei definierten Verhaltensauffälligkeiten und -defiziten spezifische Interventionen eingesetzt. Die Gruppe stellt hierfür einen Übungsraum dar, und psychodynamische Prozesse stehen im Hintergrund, was aber keineswegs bedeutet, dass die Interaktionen innerhalb der Gruppe nicht von Bedeutung sind. Das Gruppentraining ist stärker strukturiert, und die zu bearbeitenden Themen werden nicht laufend von den Teilnehmenden vorgegeben. Das Gruppentraining stellt eine besonders geeignete Interventionsform für Kinder mit einer autistischen Störung dar, da die soziale Interaktion gefördert wird und die erlernten Fertigkeiten in einer recht realistischen Umgebung mit Gleichaltrigen geübt werden können, was die Generalisierung in den Alltag erleichtert (Barry et al. 2003).
Bei Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigt sich ein weiterer Vorteil des Gruppentrainings statt einer Therapie, der bei anderen Diagnosegruppen nicht bedeutsam ist. Diese Menschen tun sich mit Einzeltherapie oft schwer, da diese zu einem wesentlichen Teil auf der Beziehung zwischen Klient und Therapeut aufbaut und diese Beziehung für das Verständnis und die Veränderungen der real gelebten Beziehungen nutzt. In den Gruppentrainings steht der Beziehungsaspekt zu den Therapeuten und unten den Mitgliedern nicht im Vordergrund.
Nach Remschmidt et al. (2006) soll eine therapeutische Intervention, die Kindern mit einer autistischen Störung gerecht wird, entwicklungsorientiert ausgerichtet sein, störungsspezifisch vorgehen, multimodal die Bandbreite der sich als wirksam erwiesenen Methoden unterschiedlicher Therapietraditionen nutzen sowie auf einem vertieften Verständnis und umfangreicher Erfahrung im klinischen Umgang mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen beruhen.
1.7.1 Psychotherapeutischer Hintergrund
Die KOMPASS-Gruppenbehandlung wurde aus einem humanistischen Menschenbild und einer personzentrierten Haltung heraus entwickelt und aus personzentrierten Grundlagen hergeleitet. Der personzentrierte Ansatz stellt aufgrund der zentralen Stellung von Beziehung und Kommunikation ein in hohem Maße geeignetes Behandlungskonzept für Menschen mit autistischen Interaktions- und Kommunikationsproblemen dar. »Die personzentrierte Haltung ist primär eine Art und Weise des Seins, die ihren Ausdruck findet in Einstellungen und Verhaltensweisen, die wachstumsförderndes Klima schaffen. Sie ist mehr eine basale Philosophie als nur eine Technik oder eine Methode« (Rogers 1982, zit. nach Korunka 1992, S. 71).
Das KOMPASS-Training steht auf der Basis des personzentrierten Therapieansatzes, wie er für die Kindertherapie (Weinberger 2001; Boeck-Singelmann et al. 2002; Behr et al. 2008) weiterentwickelt und auf das Gruppensetting übertragen (Jenny et al. 2006; Jenny und Käppler 2008) wurde. Die personzentrierte Therapie hat sich in vielen Studien bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen (Casey und Berman 1985; Weisz et al. 1987; Weisz et al. 1995; Heekerens 1996; Schmidtchen et al. 1995; Schmidtchen 1996; Beelmann und Schneider 2003; Bratton et al. 2005) im Einzel- wie auch Gruppensetting (Hoag und Burlingame 1997; McRoberts et al. 1998) als wirksam erwiesen, wie in der Übersichtsarbeit von Hölldampf und Behr (2008) detailliert diskutiert wird.
Читать дальше
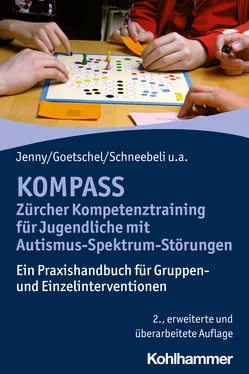
 Kap. 7). Unterdessen wurde auch das KOMPASS-F-Training für Fortgeschrittene publiziert (Jenny et al. 2019). Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung im hochfunktionalen Bereich richtet, die bereits das hier beschriebene KOMPASS-Basistraining erfolgreich besucht haben.
Kap. 7). Unterdessen wurde auch das KOMPASS-F-Training für Fortgeschrittene publiziert (Jenny et al. 2019). Es richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit einer Autismus-Spektrum-Störung im hochfunktionalen Bereich richtet, die bereits das hier beschriebene KOMPASS-Basistraining erfolgreich besucht haben.