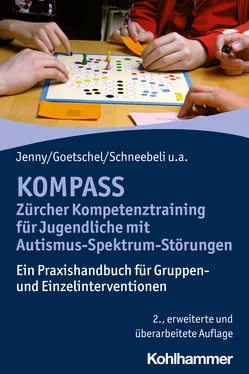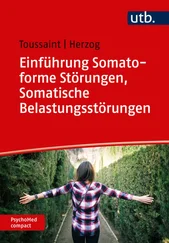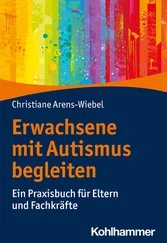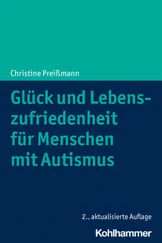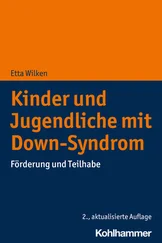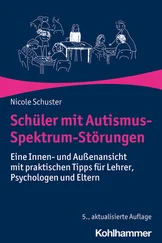Der Ablauf der Sitzungen ist immer gleich und umfasst nach einer Einführung, einer Wiederholung der Gruppenregeln und der Eingangsrunde den Themenblock und Gruppenspiele. Dann folgt der Wochenauftrag, wie die Hausaufgaben genannt werden. Schließlich folgt die Abschlussrunde, in der die Teilnehmer benennen, was ihnen gefallen und was ihnen nicht gefallen hat, und jeder Teilnehmer von den Therapeuten ein ausschließlich positives Feedback erhält. In jeder Sitzung werden sogenannte Wochenaufträge zur Vertiefung der besprochenen Themen verteilt. Alle Arbeits- und Informationsblätter sowie weitere Übungsmaterialien können von der Verlags-Homepage ( https://dl.kohlhammer.de/978-3-17-037134-7) heruntergeladen werden.
SOSTA ist ein verhaltenstherapeutisches Training mit einer operanten und kognitiven Vorgehensweise. Es arbeitet mit einem Verstärkerplan, um gemeinsam festgelegte Verhaltensweisen (»Verhaltensregeln«) zu trainieren. Durch die positive Verstärkung soll die Auftretenswahrscheinlichkeit des Zielverhaltens erhöht werden. Negative Verstärkung wird kaum eingesetzt. Bei mangelnder Kooperation, störendem und oppositionellem Verhalten, aggressivem Verhalten und Konflikten kommt Verstärkerentzug oder eine verhaltenstherapeutische Auszeit zum Tragen. Pro Stunde können die Teilnehmer gesamthaft vier Punkte für das Einhalten von festen und variabeln Gruppenregeln wie auch individuelle Ziele und Wochenaufträge erhalten. Am Ende jeder Sitzung wird der Verstärkerplan abgerechnet und die Teilnehmer können ihre Punkte gegen etwas aus einer »Belohnungskiste« eintauschen. Rollen- und Gruppenspiele, die nicht ausschließlich spezifisch eine soziale Fertigkeit üben, sondern übliche Kinderspiele für Interaktion, Bewegung und Spaß sind, sind ein wichtiger Teil bei SOSTA.
Die Ziele umfassen den Aufbau sozialer Kompetenzen, die Verbesserung der sozialen Motivation, des Perspektivenwechsels und der Anpassungsfähigkeit sowie das Erlernen von Selbststeuerungsfähigkeiten.
SOSTA ist neben dem mit der schwedischen Stichprobe untersuchten KONTAKT-Programm das einzige manualisierte Gruppentraining im deutschsprachigen Raum, das in Deutschland mit einer kontrolliert randomisierten Stichprobe an sechs verschiedenen Universitätskliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie mit einer Spezialisierung auf die Diagnostik und Behandlung von Patienten mit einer Autismus-Spektrum-Störung (SOSTA-net) evaluiert wurde (Freitag et al. 2016). Es ist eine Prä-Post-Untersuchung (IG-N = 101) mit einer Kontrollgruppe (KG-N = 108), welche die normale zur Verfügung stehende Behandlung für die Patienten und das Elterntraining (drei Termine) erhalten hat, und einer Katamnese nach drei Monaten. Die manualgetreue Umsetzung wurde durch Videoaufnahmen und nachfolgender Kodierung von mindestens einer der Therapiestunden überprüft. Die Evaluationsstudie bezieht sich auf Daten aus 14 Gruppen, die jeweils wöchentlich für zwölf Sitzungen für Kinder und Jugendliche, die in altershomogene Gruppen (Umfang 4–5 Jahre) zusammengefasst waren, durchgeführt worden sind und zusätzlich drei Elterngruppentermine umfassten. Die Stichprobe (N = 209, IG-N = 101 bzw. KG-N = 108) umfasst 194 Jungen (IG = 96 bzw. KG = 98) und 15 Mädchen (IG = 5 bzw. KG = 10) mit einem Durchschnittsalter von 12,7 bzw. 12,9 mit einem IQ > 70 (IG-Durchschnitts-IQ = 102,5 bzw. KG-Durchschnitts-IQ = 101,4), die im Zeitraum von sechs Monaten vor Trainingsbeginn keine weitere gravierende psychiatrische Erkrankung oder schwere aggressive Verhaltensstörungen aufwiesen. Der Prä-Post-Vergleich des Fragebogens zur sozialen Reaktivität (SRS, Bölte et al. 2008) zeigt gemäß Elternangaben eine Symptomabnahme des Gesamtwertes in der Interventions- wie auch der Kontrollgruppe, wobei diese in der Interventionsgruppe signifikant höher ist als in der Kontrollgruppe (p = .01, ES = .35). In der Katamnese nach drei Monaten bleiben die Werte der Interventionsgruppe signifikant tiefer als in der Kontrollgruppe (p = .02, ES = .34). Die Angaben der Lehrer im SRS zeigen deskriptiv eine größere Symptomabnahme in der Interventionsgruppe, doch der Vergleich zur Kontrollgruppe ist wie auch beim SDQ nicht signifikant. Nach drei Monaten unterschieden sich die Gruppen nicht mehr. Im Weiteren wurden bei der Katamnese in der Interventionsgruppe signifikant weniger allgemeine Verhaltensprobleme gemessen am Gesamtwert des Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ, Rothenberger et al. 2008) als in der Kontrollgruppe gefunden. Im Bereich der ängstlich-depressiven Symptomatik des CBCLs (Achenbach 1991a) und ›Probleme mit Gleichaltrigen‹ des SDQ wurde gemäß Elternangaben keine Verbesserungen bei Gruppenende oder nach drei Monaten gefunden. Auch in der Selbstbeurteilung mittels des Depressionsinventars für Kinder und Jugendliche (DIKJ, Stiensmeier-Pelster et al. 2000) zeigte sich keine signifikante Veränderung. Ein höherer SRS-Wert in den Eltern- oder Lehrerangaben, also eine höhere Symptombelastung im Bereich der sozialen Reaktivität, wie auch ein höherer IQ korrelierten mit einem besseren Erfolg bei Therapieende und der Katamnese-Messung. Alter und Geschlecht hatten keinen Einfluss.
1.6.5 Übersicht über nicht evaluierte Trainingsprogramme
Einige Trainingsprogramme sind bisher offensichtlich nicht evaluiert worden, bieten aber eine Fülle von Ideen für den Einsatz in der Einzel- und Gruppentherapie.
• Die Social Skills Groups nach dem TEACCH-Ansatz (Treatment and Education of Autistic and other Communication disabled Children) von Schopler et al. (1995) sind seit den 1980er-Jahren in den USA verbreitet und werden in abgewandelter Form als gruppenpädagogisches Angebot in Deutschland unter dem Begriff SOKO-Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus von Häußsler et al. (2003) durchgeführt. Ein ähnliches Angebot, das sich auch auf den TEACCH-Ansatz beruft, ist in der Schweiz das Sozialtraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus von sieben bis 15 Jahren, das die Stiftung Kind & Autismus anbietet.
• Das Manual zum Training der Theory of Mind von Steernemann et al. (1996) wurde für Kinder mit sozialen Beeinträchtigungen inklusive einer Autismus-Spektrum-Störung zusammengestellt und in der Studie von Gevers et al. (2006) eingesetzt.
• Das Programm Skillstreaming von Goldstein et al. (2000; McGinnis und Goldstein 1997) wurde nicht spezifisch für autistische Kinder und Jugendliche entwickelt, hat sich aber gemäß den Studien von Tse et al. (2007) und Lopata et al. (2008) gerade auch bei diesen Kindern bewährt.
• Das Trainingsprogramm Relationship Development Intervention (RDI) von Gutstein und Sheeley (2002) ist modular dem Entwicklungsverlauf folgend aufgebaut und richtet sich an Kinder und Jugendliche aus dem ganzen autistischen Spektrum (inkl. Frühkindlicher Autismus), mit unterschiedlichen intellektuellen und verbalen Funktionsniveaus (inkl. nicht-verbale, geistig behinderte Kinder). Die Übungen werden in erster Linie im Zweierkontakt zwischen Therapeut und Kind beziehungsweise betroffenem Kind und Eltern durchgeführt. Auf den fortgeschrittenen Stufen werden auch Kleingruppen Betroffener gebildet. Die Übungen eignen sich sehr gut als Ausgangspunkt, um eigene Übungen zu entwickeln und einen entwicklungsorientierten Aufbau bestimmter sozialer Fertigkeiten zusammenzustellen. Das Programm ist nur für das Einzeltraining evaluiert, nicht für das Gruppensetting. Es zeigen sich deutliche Fortschritte bei der wechselseitigen Interaktion und Kommunikation sowie eine Zunahme an Flexibilität bei einer Abnahme von problematischen Verhaltensweisen (z. B. Gutstein et al. 2007).
• Das Social Skills Training for Children and Adolescents with Asperger Syndrome and Social-Communication Problems von Baker (2003) wurde zwar aufgrund jahrelanger Erfahrung mit Gruppentrainings mit Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Baker, o.J.) entwickelt, das entsprechende Manual richtet sich aber an Eltern und Lehrpersonen, die im Einzelsetting mit dem Kind oder Jugendlichen arbeiten. Baker (o.J.) nimmt dabei Bezug auf das Skillstreaming-Trainingskonzept von McGinnis et al. (1997). Einfache soziale Fertigkeiten werden in strukturierten Lektionen instruiert und dann in den freieren Gruppenzeiten eingeübt. Die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und den Schulen ist sehr eng, um die Generalisierung zu unterstützen. Die Gruppentreffen werden über 12 Wochen durchgeführt, danach können die Kinder austreten und neue zur Gruppe stoßen.
Читать дальше