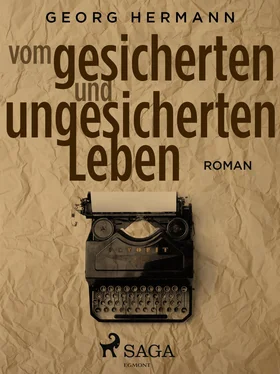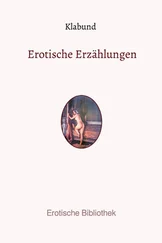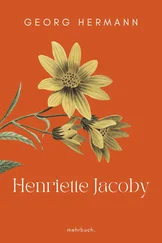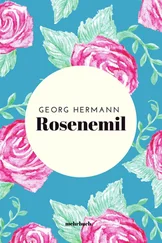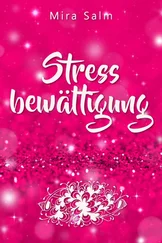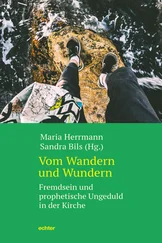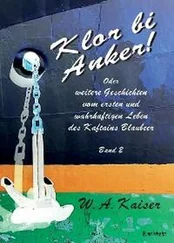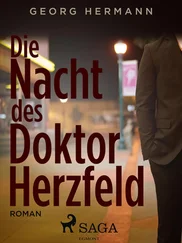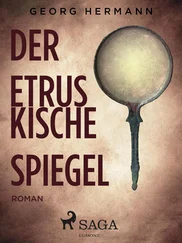Grade in dem Lande jedoch, in dem der Staat am härtesten und niederdrückendsten die Form des gesicherten Lebens aufzeigt — ein Staat, der es fertig bekam, innerhalb eines Jahrzehnts zweimal seinen Völkern die wahnsinnigsten Blutopfer aufzuerlegen (eine Sache die einzig in der Weltgeschichte ist!) — grade in dem Land ist in der Literatur am reinsten die Kunst des un gesicherten Lebens zu finden. Ich kenne keinen russischen Schriftsteller, der auf der Seite des gesicherten Lebens stände und wohl keinen Staat, der sich so bemühte (im Bild- und Wortsinn) seine Literatur zu strangulieren wie Russland es tut. Ich bewundere es, dass in Russland die Kunst so rückhaltslos und fast ohne Ausnahme eine Kunst des ungesicherten Lebens ist. Es spricht das nichts Schlechtes für ein Land, von dem wir ja so wenig wissen. Wenn auch die Rückschlüsse von ein paar Männern auf ein Volk, dem ja zu wohl neunzig Prozent aus Mangel an Schulbildung die Werke eben dieser paar Männer nicht zugänglich sind, kaum allzu viel Beweiskraft haben mögen.
Man könnte eine Skala aufstellen: Gogol, Turgenjew, Tschechow, Tolstoi, Gorki, Dostojewski. Turgenjew wäre da zum Beispiel der Aristokrat, der das ungesicherte Leben sieht, Kunstaristokrat dabei bleibt, und dem doch aus seinem Mitleiden Wundervolles erblüht. Tschechow ist der schwindsüchtige Arzt (die beiden Worte sind stärker als alle Erklärungen). Tolstoi ist der Gesicherte, der das ungesicherte Leben spielt und noch mit seinem Tode ein seltsames Schauspiel von angstvoller Flucht vor dem gesicherten Leben gibt, an das Tier gemahnend, das sich ins Gebüsch verkriechen will, um zu verrecken. Gorki ist der Landstreicher aus der Hefe, und endlich Dostojewski ist der Spieler, Epileptiker, Anrüchige, kleinhirnige Fanatiker, der Sträfling aus dem Totenhaus — er, dem alle die Palme reichen, und den man sich mit seinem seelischen Neuland aus der Literatur keines Landes mehr fortdenken kann, nicht wie Turgenjew ein Mensch des Mitleids, sondern ein Dichter des Mitfühlens.
Ich will die Beispiele nicht häufen, nicht von Verlaine sprechen, dem deutschen Lyriker, der sich nach Frankreich verirrte. Von Charles Louis Philippe, den das jüngste Frankreich abgöttisch verehrt, und der ohne Dostojewski undenkbar wäre. Ich will nur noch Richard Dehmel erwähnen und Thomas Mann. Bei Thomas Mann pendelt die Dichtung stets um das eine Problem, im gesicherten Leben das ungesicherte aufzuweisen, von ‚Lobgott Piepsam‘ an, an dem ‚das Leben‘ (sic!) vorüberradelt, bis zum ‚Tod in Venedig‘. Und Richard Dehmel bekam plötzlich (wohl unter dem Einfluss äusserer Lebensumstände: ‚Mispeln und Autoren müssen auf Stroh liegen‘ meint Heine irgendwo — ‚Es wird Ihnen nie wieder so gut gehen als damals, da es Ihnen schlecht ging‘ — hörte ich letzthin einen klugen Kopf sagen) — Richard Dehmel bekam ja wohl so irgendwie einen Knax, schwenkte vom ungesicherten Leben zum gesicherten in der Grundtendenz über, und verlor literarisch den seltsam-faszinierenden Glanz des ungesicherten Lebens aus seinen Augen. Eine Tatsache, der selbst seine besten Verehrer auf die Dauer sich nicht verschliessen konnten.
Aber keine Beispiele mehr. Man kann — ich meine trotz Herrn Blei — sagen, dass alles, was wirklich grosse Kunst und grosse Literatur ist, — Literatur, nicht jene Erzählungen des gesicherten Lebens, von denen vorher gesprochen wurde — — aus dem ungesicherten Leben emporblüht. Es ist eben doch zum Schluss ein Schiff mit grösserem Tiefgang als das gesicherte. Und selbst wenn einmal so wundervolle Gebilde wie Hofmannsthal, in glücklicher Mischung von Romanentum, Judentum und Germanentum, aus dem gesicherten Leben sich erschliessen — ist es dann doch zum Schluss traurig, zu sehen, wie sie, ohne neue Kräfte einsaugen zu können, fast in Angst vor ihrer eigenen Schönheit dahinwelken.
Die einen sind Walderdbeeren, den allerletzten vergleichbar, die hoch oben am Rand der Vegetation, unterm Knieholz, zur Reife kommen, langgestreckt, grazil, mit zierlichen Tupfen der Samen, — feurig, süss und säuerlich zugleich, und in deren Aroma alle Sonnenglut des Hochgebirges, die Kälte der Nächte, die Bitterkeit der Schneestürme, alle verfliegende Klarheit der metallisch-dünnen Luft, alle Fernblicke über die Hügel fort und alle Tiefblicke in die Täler hinab wiederklingen. Und die andern sind Gartenerdbeeren, fleischig, versüsst, hochgetrieben, gewiss gut im Geschmack, aber auf die Dauer fade, ohne neue Segnungen und Überraschungen.
Man lasse mich nicht den gleichen Gedanken durch irgendwelche wissenschaftlichen Disziplinen weiterverfolgen. Jedes Buch der Erfindungen brächte tausendfaches Illustrationsmaterial dazu. Immer wieder sind es die Aussenseiter gewesen, jene, die von unten, von draussen kommen, die die Welt vorwärtsbrachten. Und da selbst, wo man den andern — wie in der Philosophie — breite Betten an den Universitäten bereitete, wurden die lebensfähigen Kinder meist abseits hinter irgend einem Zaun geboren. Man führe mir nicht Kant an. Der Staat wusste wohl, warum er ihn beliess und nur ab und zu ein wenig rüffelte und die Kandare fester anzog, wenn er etwas sagte, was er nicht für seine Zwecke — wer denkt da nicht an Nietzsches lustige philosophisch-kantische Examensfragen für preussische Beamte?! — nicht für seine Staatszwecke benutzen konnte.
Der Staat — nicht unser Staat, nein, rein kantisch: der Staat an sich! ... Lucia Dora Frost, sicherlich eine der überragenden unter den heute schreibenden Frauen in Deutschland, hat in ihrem Essay ‚Preussische Prägung‘ ein paar feine Worte über den Staat gesagt, wie er sich gegen das Einzelleben stellt, gegen seine Begabung, mit tiefem Misstrauen jedes natürliche Können betrachtet, und stets ein Bild des Kampfes bietet, den die Macht mit dem undisziplinierten Genie führt, um sich doch nachher — ein Klein Zaches, genannt Zinnober — dessen Erfolge gutzuschreiben.
Ich weiss nicht, was der Staat ist; ich weiss aber, dass er von je ein retardierendes Moment war, dass er überall und immer das Unglück der Völker war, —
Armes Volk! Wie Pferd und Farren
Bleibst du angeschirrt im Karren
Und der Nacken wird gebrochen,
Der sich nicht bequemt in Jochen.
— das Unglück der Völker war, weil er stets auf der Seite des gesicherten Lebens stand, — eins Macht, der jeder Zollbreit Weiterentwicklung abgerungen werden musste und die stets, wenn sie sich notgezwungen darauf verstand, die Leine hier mal ein Stückchen lockerer zu lassen, sie auf der anderen Seite dafür wieder gehörig anzog, so dass sie immer das blieb, was sie war: eine Einschnürung für alle geistige, seelische, kulturelle Expansion. Eine Sache war sie, diese Macht, die in jeder Neuerung, jeder Fortentwicklung, die aus dem ungesicherten Leben emporstieg, ihren natürlichen Feind roch, den sie so lange wie irgend angängig niederhalten musste. Stellt sich doch sogar der Staat eigentlich von jeher auch gegen Dinge, die scheinbar mit der Staatsräson — — ein Wort, das Bände spricht! — — gar nichts, nicht das geringste, zu tun haben, wie, ein Beispiel, die Weiterentwicklung der bildenden Künste. Nirgends war der Staat ein Kleid, das mit dem Körper wuchs, ihn umhüllend, wärmend, schützend; nicht einmal in Athen, das einen Sokrates — der heutige Philosoph des gesicherten Lebens frohlockt darüber; er hasst diesen Plebejer, diesen Mann vom ungesicherten Leben — — einen Sokrates gegen die Einsicht aller zum Giftbecher verurteilen konnte — sondern stets und immer war er nur allzu enge Eisenfessel, die solange unerträglich ins Fleisch schnürte, jede Bewegung des ungesicherten Lebens hemmend, bis sie gesprengt wurde. Und die sich in kurzem immer wieder von neuem herumlegte um den Körper der Völker; vielleicht ein wenig weiter als vorher, jedoch nie ein Kleid, sondern immer nur wieder eine Eisenfessel.
Читать дальше