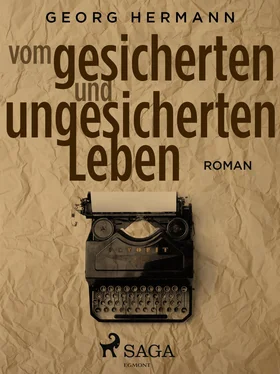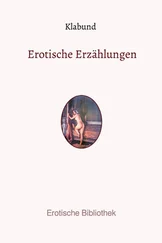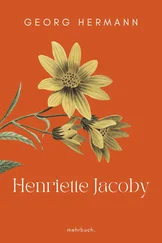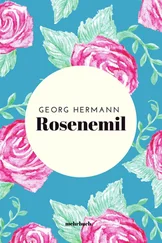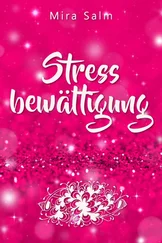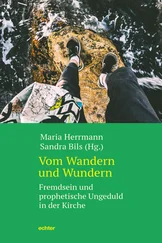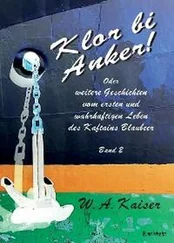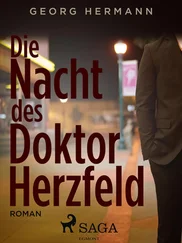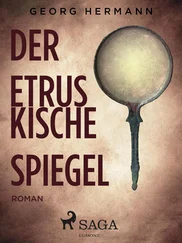In diesem Augenblick, da alles Bestehende wankt, wird auch die Sozialdemokratie von schweren Fieberschauern geschüttelt; und sie vielleicht von noch schwereren als irgend etwas sonst. Denn sie steht vor der Frage, ob sie Ja und Amen zu Dingen sagen soll, die auf die Dauer selbsttätig ihren Lebensnerv durchschneiden müssen. Es wäre vielleicht (?) tief zu bedauern, wenn die deutsche Sozialdemokratie eine nationale Partei würde, denn das würde beweisen, dass sie für ihre eigenen Grundgedanken noch nicht reif wäre. Oder es wäre vielleicht (?) für Deutschland eine sehr glückliche Lösung.
Das sind augenblickliche politische Erwägungen. Die Gedanken, die Mächte selbst aber werden von diesen nicht tangiert. Die Partei des ungesicherten Lebens hat nämlich unerschöpflichtiefe Brunnen, — die versiegen nicht. Das Seil kann brüchig werden, der Eimer kann in Stücke gehen. Nun — dann wird eine spätere Generation ein neues Seil einziehen und neue Eimer heranhängen, die das silberne, quellklare Kristallwasser aus der Tiefe schöpfen.
Ich meinte, es gäbe Kunst und Literatur des gesicherten und des ungesicherten Lebens. Ich will noch weitergehen: man kann Kunst und Literatur fast wie durch einen Schwerthieb in diese beiden Hälften zerteilen, und es wird nur wenige geben, die man damit nicht trifft, und deren letzter Zauber darin beruht, dass sie eben beide Hälften untrennbar in sich vereinen, wie zum Beispiel ein Oskar Wilde es tut. Die tiefe — und meist unbegründete — Verachtung, die auch der Kunstfremde gegen Ästhetentum hat, bedeutet ja nichts weiter als eine Absage an die Kunst des gesicherten Lebens. Sie erscheint uns so wurzellos und überflüssig, eine Sache, die sich an sich selbst berauscht, eine Spielerei, die uns letzten Grundes nichts hilft und nur leer zurücklässt.
Man könnte eine Skala aufstellen. Beispiel und Gegenbeispiel ausbalanzieren. Schopenhauer und Nietzsche. Schopenhauer, der seine ganze Philosophie auf dem ungesicherten Leben aufbaut mit den Marmorquadern seiner Sätze, und der seine Feder dazu tief in jede brennende Wunde des ungesicherten Lebens hinabtaucht, und aus dem doch letzten Endes schon — wenn er es auch nicht Wahrheit haben will! — die Worte des Fr. Th. Vischerschen Glaubensbekenntnisses hervorbrechen:
In Seelen, die das Leben aushalten /
Und Mitleid üben / und menschlich walten /
Mit vereinten Waffen / wirken und schaffen
Trotz Hohn und Spott / da ist Gott!
Schopenhauer, der reinste Bekenner des ungesicherten Lebens auf der einen Seite. Und Nietzsche dagegen, der zum Schluss doch weiter nichts tut, als denen Recht zu geben, die schon so Recht behalten; der meint, dass das Gesindel den Born des Lebens vergiftet, von der blonden Bestie, dem Übermenschen und seiner Herrenmoral träumt. Die intellektuellen Franzosen beschäftigen sich gerade viel mit ihm, als mit dem deutschen Philosophen der Gegenwart und der heutigen Generation, und sie schmieden aus seiner Lehre Pfeile gegen uns. Wir lachen darüber. Es sollte uns zu denken geben. Nietzsche hat keine Achtung vor dem Leben; er nimmt es als eine gleichgültige Tatsache hin, die erst sich Berechtigung erwirbt dadurch, dass sie sich als Kraft manifestiert. Schopenhauer ist das Leben an sich viel zu sehr Problem, um es nicht in jeder, auch der gebrechlichsten Form als geheimnisvoll und heilig zu achten.
Ich weiss natürlich: ein Proteus, wie Nietzsche, ist nicht in ein Schema zu klemmen, und ich schätze ihn viel zu sehr, um das zu tun. Man verstehe mich darum nicht falsch: das ist eine Feststellung hier und kein Werturteil.
Ich habe viel Nietzsche in den letzten Jahren gelesen, nicht der Sprache, nicht des Baues wegen — sondern der Späne wegen, einzig der köstlichen Späne wegen, die nebenher abfallen, wenn er die Balken zu seinen Gerüsten schlägt. Und doch nur zwei Seiten Schopenhauer mal wieder, und da plötzlich aus all diesem doktrinären Ernst heraus irgend ein Wort von der wehen Kreatur, von der tiefen Ungesichertheit des Lebens, hart, verknurrt und doch schwellend von Mitfühlen, zitternd vor Durchfühlung — eine einzige Zeile nur, die einen im Innersten trifft — Und wo war der ganze Nietzsche hingeschwunden, wo all sein griechisches feuertrunkenes Tänzertum und seine dünne, eisigklare, champagnerprickelnde Gletscherluft des Geistes, der Rasse, der Kultur des Herrentums?! Wenn nicht Nietzsche zuerst und zuletzt die Philosophie des gesicherten Lebens verträte — wie hätte er dann auch durch den ‚Antichrist‘ gegen das ungesicherte Leben den flammendsten Bannstrahl schleudern können, den dieser Zeus in seinem Mantel verborgen hatte! Auch das nehme man etwa nicht als mein Werturteil über den Antichrist, und als mein Für oder Gegen, denn man würde sonst zu sehr falschen Schlüssen kommen! — sondern nehme es nur als Eideshelfer für meine Argumentationen vom gesicherten und ungesicherten Leben.
Schade, dass Nietzsche nicht das Wort Walt Witmans gekannt hat: „Hast du gehört, es sei gut, den Sieg zu gewinnen. Ich sage, es ist gut, zu fallen. Schlachten können verloren werden in demselben Geiste wie gewonnen. Ein Hoch allen, denen es fehlschlug. Für die, deren Kriegsschiffe in der See versanken. Und den zahllosen unbekannten Helden, gleich den grössten Helden, die man kennt.“ Ich glaube, das hätte ihm zu denken gegeben.
Rembrandt und Raphael. Man hat gerade viel darüber geschrieben: hat sie als germanisch und romanisch gegenübergestellt. Als Protestantismus und Katholizismus, als Gefühlskunst und Formkunst. Kaum ein Einsichtiger ist heute im Zweifel, wessen Schale tiefer sinkt. Und es bedarf ja wohl keiner Kommentare, wenn ich sie die Kunst des ungesicherten und des gesicherten Lebens nenne.
Als Langbehn seinen ‚Rembrandt als Erzieher‘ schrieb, jenes Buch, das sich las, — ein witziger Philosoph sagte es — wie ein ‚toll gewordenes Konversationslexikon‘, und von dem doch jetzt mit einem Mal wieder soviel gesprochen wird, da waren es sicherlich ähnliche Ideenkreise, die ihn instinktiv dazu trieben. Nur dass er weiter ging und in Rembrandts Wesen die Essenz des Germanentums sah — und aus ihm soziale und Menschheitsaufgaben ableitete, die zu lösen dem Germanentum vorbehalten sein sollten.
Beethoven und Wagner. Es ist seltsam, wie stark sich jetzt mit einem Mal eine Ablösung von Wagner vollzieht. Nietzsche, der aus dem gleichen Ideenkreis kam (den er in einer Hinsicht wohl nie überwand), aber einen untrüglichen Gradmesser für alle Kunst trotzdem in seinen feinen, kranken Nerven hatte, war hierin seiner Gegenwart um dreissig Jahre voraus. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das ich in den neunziger Jahren — ich verkehrte damals viel mit Musikern — mit einem Komponisten hatte. „Wagner,“ sagte ich, „ist nur etwas für Glückliche, Beethoven ist auch etwas für Unglückliche, weil sich aus urgründlichen Schmerzenstiefen sein jubelndes Dennoch emporringt.“
„Ja,“ sagte der Komponist und wurde nachdenklich — „da scheint im Kern etwas Wahres daran zu sein, weil wohl Beethoven absolute Musik macht, und der andere eigentlich nur im höchsten Sinne musikalischdekorativ ist.“
Sprach ich nicht schon da unbewusst aus, was mir heute zur Gewissheit geworden ist, dass alle Kunst in die Kunst des gesicherten und des ungesicherten Lebens sich scheidet, — und dass die grössten bleibenden Werte aus dem ungesicherten Leben hervorblühn mit ihrer endlichen Bejahung aus der Verneinung? Nicht nur alles was weh und wund, Nerv, Zittern und Mitfühlen ist: Die letzten Verse Günthers, Verlaines, Heines Romancero und Lazarus?!
Die gesicherte und ungesicherte Kunst braucht nicht immer einem gesicherten oder ungesicherten Leben seines Schöpfers konform zu gehen, zuletzt steckt in dem Patriziersohn Goethe, dem nie das Wasser bis zum Halse stand, unendlich viel mehr von der Kunst des ungesicherten Lebens, als in dem Sohne des Feldscheers aus Marbach, der es leider sehr früh lernte, von sich selbst zu abstrahieren, um auf kaltem Wege die Wesensmöglichkeiten auszunützen, die in ihm waren. Man hat ihn immer als das Urbild des deutschen Idealisten hingestellt, weil er in einsamer Dachstube mit den Gekrönten dieser Welt Zwiesprache hielt. Ein Unsinn — ganz abgesehen davon, dass das doch nur eine schöne Mythe ist. Ich höre immer noch den alten famosen Hermann Grimm, wie er im Kolleg so in seiner freundlich-drastischen Art vor sich hinmeckerte: ‚ich versichere Sie, meine Herren, bei Schiller im Hause ging der Champagner nie aus.‘ Aber hat denn noch niemand darauf aufmerksam gemacht, dass Schiller eigentlich viel romanisches Pathos hat, das dekorativ um seiner selbst willen da ist, Beweislosigkeit, Kritiklosigkeit eines durch kein Nachdenken getrübten Temperamentes, dass er durchaus unlyrisch ist — (alle Kunst des ungesicherten Lebens ist im letzten Sinne lyrisch) und mit seinem Sinn für Rhetorik, Versprunk, Hinrollen jenem romanischen Geist, der sich in Racine und Corneille verkörpert, verwandt ist? Immerhin auch diese Kunst des gesicherten Lebens stieg aus dem ungesicherten Leben empor. Und das steht ja eigentlich hier nur zur Diskussion.
Читать дальше