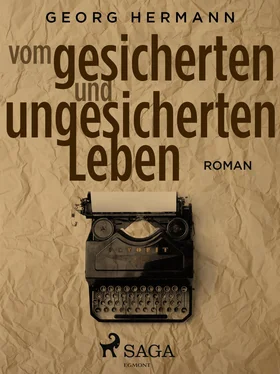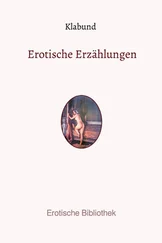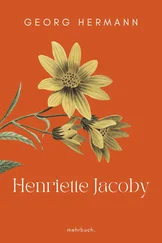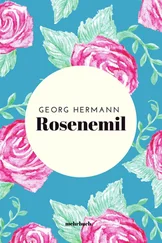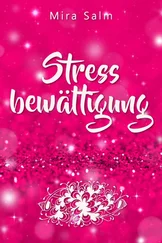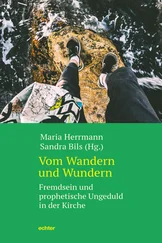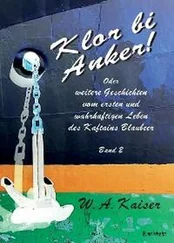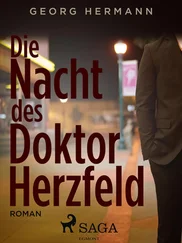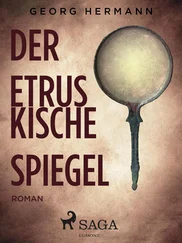Die meisten unserer schönen, sentimentalen oberbayrischen Stücke beruhen, um es prosaisch zu umschreiben, auf dem dort landesüblichen Herkommen, dass der Dienstknecht zuerst einmal mit allen — auch den am wenigsten einwandsfreien — Mitteln versucht, die Tochter seines Dienstherrn zu schwängern. Und was ist das anderes, als eine etwas rigorose Art, um in das gesicherte Leben hinüberzuvoltigieren?
Man spricht ja ganz offen davon: die oder der haben ihr ‚Glück‘ gemacht. Das heisst, sie haben sich durch die Ehe in das gesicherte Leben hinübergeflüchtet. Kein Mensch wird unter dieser Redewendung etwas anderes verstehen, als eitel materielle Dinge. Und wenn zum Schluss doch nicht alle Ehen — weder die der Gesicherten noch die der Ungesicherten — unter dem Gesichtswinkel zustande kommen, so liegt das daran, dass die unerklärlichen Mächte der Anziehung vielfach noch stärker als die Hemmungen bewusster oder unbewusster Überlegungen sind; und dass die Zahl derer vom gesicherten Leben auf beiden Seiten so klein ist, dass notgedrungen, selbst bei niedriger Summe der zu schliessenden Ehen, in dieser auf so ungünstiger Grundlage sich aufbauenden Lotterie die Mengen der Nieten ganz ungeheuerlich überwiegen muss.
Und da diese Zahl der Lebensnieten so überwiegt, so ist man daran gegangen, irreale Ausgleiche zu schaffen. Die landläufige Romanliteratur, die Erzählungen aller Länder, wie sie Leihbibliotheken, Tageszeitungen, Zeitschriften mit grosser Verbreitung beherrschen, trägt diesen Wünschen nach dem gesicherten Leben Rechnung. Von Leuten, die auf der Nordhälfte des Daseins stehen, wollen auch die Ungesicherten nichts hören — es sei denn, sie machen sich als Aussenseiter des Lebens selbstherrlich und verbrecherisch beachtenswert! — Warum lesen die vom ungesicherten Leben denn? Doch nur, um eine irreale Wunscherfüllung zu erfahren, sich zu illusionieren, gesichert zu fühlen. Ergänzungsphilosophie! Sie wollen reich, edel, begabt, kleinlichen Sorgen enthoben, mit Inbrunst geliebt in ihren Buchträumen sein. Deshalb ziehen jährlich mehr Fürsten, Grafen, Barone, Prinzen durch die Blätter unserer Romane, als der Gotha sich in einem Jahrzehnt leistet. Und nebenher wimmelt es noch von berühmten Künstlern, die in Frauengunst, Ruhm, Erfolg, Geld nur so plantschen, aber es (man merke!) auch einmal anders gekannt haben.
Zu ihnen gesellt sich weiter in Heuschreckenschwärmen der Grubenbesitzer, der mit eiserner Energie Millionenpläne wälzt. (Früher war er selbst noch Arbeiter gewesen; jetzt begnügt man sich damit, wenigstens den Vater zum einfachen Arbeiter zu degradieren.) Ich habe noch nie einen Grubenbesitzer gesehen. Ich glaube, es gibt gar keine. Denn wie eine Wolke von unfassbaren Nebeln wallt über den Gruben eine unqualifizierbare Menge von steigenden oder sinkenden Aktien, Papieren, Obligationen, um den ganzen Erdkreis verflatternd. Aber man kann kaum einen ‚Roman‘ in die Finger kriegen, ohne dem Grubenbesitzer in die Arme zu laufen, (während man Besitzern von Leimsiedereien, Engros-Rossschlächtern, Fabrikanten von Kanalisationsröhren, die doch weit häufiger sind, und die gewiss auch zum gesicherten Leben gezählt werden müssen, in Romanen nur selten begegnet und sie auch nur ungern dort antrifft).
Ein stets wiederkehrender Vorwurf dieser Erzählungen ist es auch, dass Menschen vom ungesicherten Leben in das gesicherte sich hinein kämpfen, sich dort nicht halten können, und wieder in das ungesicherte zurückfallen. Sie finden dann dort ihr eigentliches Glück — wie im ‚Fallissement‘; — oder sie vermögen (und das ist häufiger) den Wechsel nicht mehr zu ertragen. Beides, glaube ich, soll letzten Endes bedeuten, dass die Weltordnung, so wie sie ist, gut ist, sich nichts erzwingen lässt, und dass der ‚Gotha des gesicherten Lebens‘ besser unter sich bleibt.
So die vom ungesicherten! Aber auch die vom gesicherten hören nicht gern vom ungesicherten Leben etwas. Vor zwanzig Jahren liebte man das noch, (schon weil das die anderen Rinnsteinkunst nannten), heute nicht mehr. Ich, der ich einmal ein solches Buch der Hintertreppe schrieb, keineswegs bitter, eher lachend und leichtsinnig und skrupellos — (man griff mich deswegen von sozialistischer Seite genug an!) machte hier eine seltsame Erfahrung: Frauen besserer Stände, eifrige Romanleserinnen sonst, sagten mir, sie mochten es nicht, wollten es nicht lesen. Nicht etwa, dass sie kritische Ausstände machten, — nein: sie hätten einfach keine Lust, noch in ihren Mussestunden von Dienstmädchen zu hören. Sie hätten schon so genug von ihnen. An ihren persönlichen Sorgen wollten sie nicht teilnehmen.
Das bedeutete: sie lehnten das Buch ab, einzig, weil es ihnen keine Wunscherfüllung bot. Nicht einmal eine Spiegelung; auch keine Lebenssicherheit; noch weniger Helden, auf die sie ihre Scheingefühle übertragen konnten; und erst recht keine Heldinnen, mit denen sie sich gleichsetzen wollten. Die tiefe Lebensunsicherheit des Urgrunds berührte sie doppelt peinlich, weil er doch ihrer eigenen Lebenssicherheit räumlich so unerhört nahe war, und deshalb für sie auch nichts von dem geheimen Reiz einer fernab liegenden und asiatischen Lebensunsicherheit (wie bei ‚Nachtasyl‘!) haben konnte, nach der man — schlichtweg bis ins letzte Mark durchrüttelt und erschüttert — bei Kempinski gedankenvoll und sanft schmatzend, seine Hummermayonnaise in sich einverleiben kann.
Ähnlich wie unser Schrifttum weiss der Staat genau, was er tut, wenn er, — was dieses doch nur in der Suggestion kann — das gesicherte Leben als Köder auswirft, es zur Grundlage für fast jede Anstellung, für Militär und Beamtenhierarchie macht. Er bietet wenig — der Staat; aber er bietet in dem Wenigen das gesicherte Leben; was private Unternehmungen, die oft mehr bieten, weil sie gezwungen sind, intensiveres Menschenmaterial an sich zu fesseln, nur selten tun! Er stellt aber an, der Staat, lebenslänglich, zahlt bei Alter, Invalidität, erleichtert die Ehen dadurch, garantiert noch Witwen und Waisen eine, sei es auch kümmerliche, Lebenshaltung. Und wenn man auch tausenderlei dabei in Kauf nehmen muss, bei dem man oft sein Ich, seine Meinung, die Logik seines Denkens aufzugeben genötigt ist, der schmackhafte Wurm, der so verlockend am Köder sich ringelt, macht immer wieder, dass die Fische sich um die Angel drängen. (Rückwirkend macht es sich zum Beispiel auch so bemerkbar, dass für die Ehe ein kleiner Beamter höher bewertet wird, als ein gut verdienender Agent oder Verkäufer, der als Mann des ungesicherten Lebens doch — wie günstig seine Lage auch im Augenblick sein mag, — vorerst in zweiter Linie kommt.)
Man kann den Staat, das gesicherte Leben und das Gesetz fast identifizieren. Und da der Staat wieder in Militär und Beamtentum seinen Ausdruck findet, in denen nur der Mann bisher Platz hat, so weiss eigentlich das Gesetz noch nichts von der Existenz der Frau und vergewaltigt ihre Existenz in tausend Paragraphen, ohne überhaupt sich dieser Einschränkung bewusst zu werden. Zudem sind die Gesetze vom Besitz gemacht, vom gesicherten Leben, sind von einem Tausendstel der Menschheit ersonnen und der Empfindung eines Zwanzigstels angepasst; und deshalb verstehen es auch die übrigen neunzehn Zwanzigstel — die vom ungesicherten Leben — nicht. Sie sehen im Gesetz stets nur eine ihnen feindliche, ewig unheimlich-arbeitende Sortiermaschine, die sie weder nach Zweck, noch nach Mechanismus begreifen — eine Maschine von der Art derer, die die grossen Konservenfabriken aufstellen, um die grünen Erbsen nach der Grösse zu sondern. Die kleinen Erbsen fallen eben durch die Löcher der Siebe, und die grossen Erbsen nicht. Mögen sich die kleinen Erbsen immerhin eine Weile halten, angstvoll hin und her kullern, sich in die Ecken klemmen, mal purzeln sie eben doch durch. Was können sie dafür, dass sie zu klein sind!
Читать дальше