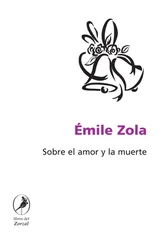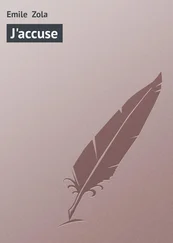1 ...7 8 9 11 12 13 ...22 Der Klumpen zerbröckelte an ihrem Haarknoten, rieselte in ihren Halsausschnitt und bedeckte sie mit Staub. Bestürzt sprang sie mit einem Satz auf, machte sich davon, hielt den Kopf zwischen den Händen, um sich zu schützen. Doch Bambousse hatte die Zeit, sie noch mit zwei weiteren Klumpen zu treffen: der eine streifte nur ihre linke Schulter; der andere traf sie mitten ins Kreuz, so heftig, daß sie auf die Knie fiel.
„Bambousse!“ schrie der Priester und entriß ihm eine Handvoll Steine, die er aufgehoben hatte.
„Lassen Sie doch, Herr Pfarrer“, sagte der Bauer. „Das war weiche Erde. Ich hätte mit diesen Steinen hier nach ihr schmeißen sollen . . . Man merkt, daß Sie die Mädchen nicht kennen. Sie sind verdammt zäh. Die da könnte ich tief in unserem Brunnen versenken, der könnte ich die Knochen mit Knüppelhieben zerbrechen, die würde deshalb genauso ihre Schweinereien treiben! Aber ich belauere sie, und wenn ich sie überrasche! – So sind sie nun mal alle.“ Um sich zu trösten, trank er einen Schluck Wein aus einer großen flachen, mit Bast umflochtenen Flasche, die auf der glutheißen Erde warm wurde. Dann lachte er wieder breit und sagte: „Wenn ich ein Glas hätte, Herr Pfarrer, würde ich Ihnen von Herzen gern eins anbieten.“
„Nun“, fragte der Priester wieder, „und diese Heirat?“
„Nein, daraus kann nichts werden, man würde mich ja auslachen . . . Rosalie ist tüchtig. Sie ist soviel wert wie ein Mann, sehen Sie. Wenn sie aus dem Haus geht, muß ich einen Knecht nehmen . . . Nach der Weinlese kann man weiter über die Sache sprechen. Und außerdem, ich will nicht bestohlen werden. Gibst du mir, so geb ich dir, nicht wahr?“
Der Priester blieb noch eine gute halbe Stunde da und nahm Bambousse ins Gebet, sprach zu ihm von Gott, zählte ihm alle Vernunftgründe auf, die die Lage erheischte.
Der Alte hatte sich wieder an die Arbeit gemacht; er zuckte die Achseln, scherzte und wurde immer eigensinniger. Schließlich schrie er:
„Kurz und gut, wenn Sie einen Sack Korn von mir verlangten, würden Sie mir Geld dafür geben . . . Warum soll ich meine Tochter für nichts davongehen lassen!“
Entmutigt ging Abbé Mouret fort. Als er den Pfad hinabstieg, erblickte er Rosalie, wie sie unter einem Olivenbaum mit Voriau umherrollte, der ihr das Gesicht leckte, was sie zum Lachen brachte. Während ihre Röcke hochflogen und sie mit den Armen auf die Erde schlug, sagte sie zu dem Hund:
„Du kitzelst mich, du dummes Vieh. Hör schon auf!“
Als sie den Priester sah, tat sie, als schäme sie sich, brachte ihre Kleider wieder in Ordnung, preßte wiederum die Fäuste in die Augen.
Er versuchte sie zu trösten, indem er ihr versprach, erneute Anstrengungen bei ihrem Vater zu unternehmen. Und er fügte hinzu, vorläufig müsse sie gehorchen, alle Beziehungen zu Fortuné einstellen und dürfe ihre Sünde nicht noch mehr verschlimmern.
„Oh, jetzt“, murmelte sie und lachelte dabei in ihrer frechen Art, „jetzt ist keine Gefahr mehr, wo es nun mal passiert ist.“ Er begriff nicht, er malte ihr die Hölle aus, in der die verworfenen Frauen brennen. Dann verließ er sie, nachdem er seine Pflicht getan hatte, war wieder erfaßt von jener Abgeklärtheit, die es ihm erlaubte, ohne eine Verwirrung mitten im Unflat des Fleisches zu wandeln.
Der Vormittag wurde glühend heiß. In diesem weiten Felsenrund entzündete die Sonne gleich in den ersten schönen Tagen die Weißglut eines Schmelzofens. Abbé Mouret erkannte am hohen Stand des Gestirns, daß er gerade noch Zeit hatte, zum Pfarrhaus zurückzukehren, wenn er um elf Uhr dasein wollte, damit ihn die Teuse nicht ausschalt. Nachdem er sein Brevier gelesen und bei Bambousse vorgesprochen hatte, ging er eiligen Schrittes zurück und schaute dabei in die Ferne auf den grauen Fleck seiner Kirche mit dem hohen schwarzen Balken, den die große Zypresse, die Einsiedlerin, auf das Blau des Horizontes zeichnete. In der einschläfernden Hitze dachte er daran, wie er am Abend möglichst üppig die Marienkapelle für die Maiandachten ausschmücken könnte. Der Weg entrollte vor ihm einen für die Füße weichen Staubteppich, eine Reinheit von strahlendem Weiß.
Als der Abbé bei dem Feld La Croix-Verte die Straße überqueren wollte, die von Plassans nach La Palud führt, zwang ihn ein zweirädriges Wägelchen, das den Abhang herabkam, hinter einen Steinhaufen auszuweichen. Er ging quer über die Kreuzung, als ihn eine Stimme anrief:
„He, Serge! He, mein Junge!“
Das Wägelchen hatte angehalten, ein Mann beugte sich heraus. Da erkannte der junge Priester einen seiner Onkel, Doktor Pascal Rougon, den das Volk von Plassans, wo er die armen Leute umsonst behandelte, kurzweg „Herr Pascal“ nannte. Obgleich er kaum die Fünfzig überschritten hatte, war er schon schneeweiß, mit seinem großen Bart und seinem vollen Haar, von dem umrahmt sein schönes regelmäßiges Gesicht einen gütigen, durchgeistigten Ausdruck annahm.
„Um diese Zeit tapst du hier im Staub herum, du!“ sagte er fröhlich und beugte sich dabei noch weiter vor, um dem Abbé beide Hände zu drücken. „Hast du denn keine Angst vor einem Sonnenstich?“
„Nicht mehr als Ihr, Onkel“, erwiderte der Priester lachend.
„Oh, ich! Ich habe das Verdeck meines Wagens. Außerdem können die Kranken nicht warten. Gestorben wird bei jedem Wetter, mein Junge.“ Und er erzählte ihm, daß er zum alten Jeanbernat fahre, dem Verwalter vom Paradou, den in der Nacht der Schlag getroffen habe. Ein Nachbar, ein Bauer, der nach Plassans zum Markt fuhr, habe ihn geholt. „Zur Stunde wird er wohl schon tot sein“, fuhr er fort. „Na ja, man muß schon mal nachsehen . . . Diese alten Teufelskerle haben ein mächtig zähes Leben.“
Er hob schon die Peitsche, als Abbé Mouret ihn zurückhielt. „Wartet . . . Wie spät habt Ihr es, Onkel?“
„Drei Viertel elf.“
Der Abbé zögerte. Er hörte die schreckliche Stimme der Teuse an seine Ohren klingen, die ihm zuschrie, das Mittagessen würde kalt. Aber tapfer sagte er rasch:
„Ich fahre mit Euch, Onkel . . . Dieser Unglückliche möchte sich vielleicht in seiner letzten Stunde mit Gott versöhnen.“
Doktor Pascal konnte ein schallendes Gelächter nicht unterdrücken.
„Der! Der Jeanbernat!“ sagte er. „Das ist gut! Wenn du den jemals bekehrst! – Das macht nichts, komm nur immer mit. Allein dein Anblick ist imstande, ihm auf die Beine zu helfen.“
Der Priester stieg ein. Der Doktor, der seinen Scherz zu bedauern schien, zeigte sich sehr herzlich, während er das Pferd durch leichtes Zungenschnalzen antrieb. Aus dem Augenwinkel betrachtete er neugierig seinen Neffen mit jenem scharfen Blick von Gelehrten, die sich etwas einprägen. Gutmütig stellte er ihm kurze Fragen über sein Leben, über seine Gewohnheiten, über das ruhige Glück, das er in Les Artaud genoß. Und bei jeder befriedigenden Antwort murmelte er in beruhigtem Ton, als spräche er zu sich selber:
„Na, um so besser, das ist vortrefflich.“
Er fragte besonders eindringlich nach dem gesundheitlichen Befinden des jungen Pfarrers.
Erstaunt versicherte ihm dieser, es ginge ihm ausgezeichnet, er habe weder Schwindelanfälle noch Übelkeit noch Kopfschmerzen.
„Vortrefflich, vortrefflich“, wiederholte Onkel Pascal. „Im Frühling, weißt du, arbeitet das Blut. Aber du, du bist kräftig . . . Dabei fällt mir ein, ich habe deinen Bruder Octave im vergangenen Monat in Marseille gesehen. Er geht nach Paris, er soll dort unten eine schöne Stellung in der besseren Geschäftswelt bekleiden. Ach, der fidele Kerl! Er führt ein hübsches Leben.“
„Was für ein Leben?“ fragte unbefangen der Priester.
Um eine Antwort zu vermeiden, schnalzte der Doktor mit der Zunge. Dann begann er von neuem:
Читать дальше