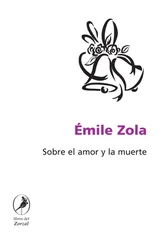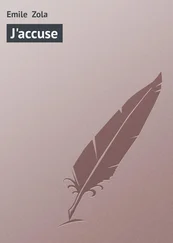Emile Zola - Die Sünde des Abbé Mouret
Здесь есть возможность читать онлайн «Emile Zola - Die Sünde des Abbé Mouret» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Die Sünde des Abbé Mouret
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Die Sünde des Abbé Mouret: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Die Sünde des Abbé Mouret»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Die Sünde des Abbé Mouret — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Die Sünde des Abbé Mouret», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
„Wie, es gibt keinen Gott?“ rief Abbé Mouret, aus seiner Schweigsamkeit auffahrend.
„Oh, wie Sie wollen!“ begann Jeanbernat spöttisch von neuem. „Wir fangen gemeinsam wieder von vorne an, wenn Ihnen das Freude macht . . . Nur, ich sage Ihnen vorher, daß ich sehr gut Bescheid weiß. Da oben in einer Stube habe ich einige tausend Bände, die bei der Feuersbrunst aus dem Paradou gerettet wurden, alle Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts, ein Haufen Schwarten über die Religion. Ich habe schöne Sachen daraus gelernt. Seit zwanzig Jahren lese ich das . . . Ach ja doch, Sie würden schon einen schlagfertigen Gesprächspartner finden, Herr Pfarrer.“ Er war aufgestanden. Mit einer weit ausholenden Gebärde wies er auf den ganzen Horizont, die Erde, den Himmel, wobei er feierlich mehrmals wiederholte: „Es gibt nichts, nichts, nichts . . . Wenn man die Sonne ausbläst, ist es aus.“
Doktor Pascal hatte Abbé Mouret leicht mit dem Ellbogen angestoßen. Er kniff die Augen zusammen, während er den Greis neugierig beobachtete, und nickte beifällig mit dem Kopf, um ihn zum Sprechen zu ermuntern.
„Dann sind Sie wohl ein Materialist, Vater Jeanbernat?“ fragte er.
„I wo, ich bin nur ein armer Mann“, erwiderte der Alte und zündete seine Pfeife wieder an. „Als der Graf de Corbière, dessen Milchbruder ich war, durch einen Sturz vom Pferd ums Leben kam, schickten mich die Kinder, diesen Dornröschenpark zu hüten, um mich los zu sein. Ich war sechzig Jahre alt, ich glaubte mich am Ende meiner Tage. Doch der Tod hat mich vergessen. Und ich habe mich in diesem Winkel einrichten müssen . . . Sehen Sie, wenn man ganz allein lebt, sieht man die Dinge schließlich auf eine seltsame Art. Die Bäume sind keine Bäume mehr, die Erde nimmt das Gehabe eines lebenden Wesens an, die Steine erzählen einem Geschichten. Kurzum, Dummheiten. Ich kenne Geheimnisse, die Sie umwerfen würden. Was soll man denn auch tun in dieser verteufelten Einöde? Ich habe die Schwarten gelesen, das hat mir mehr Spaß gemacht als das Jagen . . . Der Graf, der wie ein Heide fluchte, hat immer zu mir gesagt: ,Jeanbernat, mein Junge, ich rechne fest darauf, dich in der Hölle wiederzufinden, damit du mir da unten dienst, so wie du mir dort oben gedient hast.ʼ “ Er machte wiederum seine weit ausholende Gebärde über den Horizont hin und begann von neuem: „Hören Sie, nichts, es gibt nichts . . . All das ist ein Possenspiel.“
Doktor Pascal fing an zu lachen.
„Ein schönes Possenspiel auf jeden Fall“, sagte er. „Vater Jeanbernat, Sie sind ein Geheimniskrämer. Ich habe Sie im Verdacht, daß Sie trotz Ihres blasierten Getues verliebt sind. Sie sprachen vorhin recht zärtlich von den Bäumen und Steinen.“
„Nein, ich versichere Ihnen“, murmelte der Greis, „damit ist es bei mir vorbei. Früher, das stimmt, als ich Sie kennenlernte und wir zusammen botanisieren gingen, war ich dumm genug, allerlei zu lieben auf dieser großen verlogenen Flur. Zum Glück haben die Bücher das alles abgetötet . . . Ich wünschte, mein Garten wäre kleiner; keine zweimal im Jahr gehe ich auf die Straße. Sehen Sie diese Bank. Hier verbringe ich meine Tage und sehe zu, wie meine Salatköpfe wachsen.“
„Und Ihre Rundgänge im Park?“ unterbrach der Doktor.
„Im Park!“ wiederholte Jeanbernat mit dem Ausdruck tiefsten Erstaunens. „Aber seit mehr als zwölf Jahren habe ich den Park nicht betreten! Was sollte ich wohl mitten auf diesem Friedhof tun? Er ist zu groß. Das ist ja stumpfsinnig, diese Bäume, die kein Ende nehmen, mit Moos überall, zerbrochene Statuen, Löcher, in denen man sich bei jedem Schritt den Hals brechen kann. Als ich das letzte Mal dorthin ging, war es so dunkel unter den Blättern, die wilden Blumen rochen so giftig, es wehte so seltsam durch die Alleen, daß ich irgendwie Angst bekam. Und ich habe mich verrammelt, damit der Park nicht hier hereinkommt. Ein Sonnenplätzchen, drei Fußbreit Salat vor mir, eine große Hecke, die mir den ganzen Horizont versperrt, das ist schon zuviel, um glücklich zu sein. Nichts möchte ich haben, gar nichts, etwas so Enges, daß die Außenwelt mich dort nicht stören kann. Zwei Meter Erde, wenn Sie wollen, um auf dem Rücken liegend zu verrecken.“ Er schlug mit der Faust auf den Tisch, und jäh die Stimme hebend, schrie er Abbé Mouret an: „Los, noch einen Schluck, Herr Pfarrer. Der Teufel sitzt nicht auf dem Flaschenboden, vorwärts!“
Dem Priester wurde unbehaglich. Er fühlte, daß er nicht die Kraft hatte, diesen seltsamen Greis, dessen Verstand ihm so eigentümlich verworren vorkam, zu Gott zurückzuführen. Jetzt erinnerte er sich an manches Geschwätz der Teuse über den Philosophen, wie die Bauern von Les Artaud Jeanbernat nannten. Fetzen ärgerniserregender Geschichten zogen undeutlich durch sein Gedächtnis. Er stand auf, machte dem Doktor ein Zeichen, wollte dieses Haus verlassen, in dem er Geruch nach Verdammnis zu atmen glaubte. Doch in seiner dumpfen Furcht hielt ihn eine sonderbare Neugier zurück. Er blieb da und ging ans Ende des kleinen Gartens, durchsuchte den Hausflur mit dem Blick, wie um darüber hinaus, hinter die Wände zu schauen. Durch die weitgeöffnete Tür gewahrte er nur das finstere Treppenhaus. Und er kam zurück, suchte irgendein Loch, irgendeinen Ausblick auf dieses Blättermeer, dessen Nähe er an einem gewaltigen Rauschen spürte, das wie Meeresbrausen gegen das Haus zu branden schien.
„Und der Kleinen geht es gut?“ fragte der Doktor und nahm seinen Hut.
„Nicht schlecht“, entgegnete Jeanbernat. „Sie ist nie da. Den ganzen Vormittag ist sie oft weg . . . Es kann jedoch sein, daß sie in den Zimmern oben ist.“ Er hob den Kopf und rief: „Albine! Albine!“ Dann sagte er achselzuckend: „Ach ja, das ist eine Rumtreiberin . . . Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Ganz zu Ihrer Verfügung.“
Doch der Abbé hatte nicht die Zeit, diese Herausforderung des Philosophen anzunehmen. Eine Tür war soeben hinten im Hausflur jäh aufgegangen; eine blendendhelle Öffnung war im Schwarz der Mauer entstanden. Es war gleichsam die Vision eines Urwalds, ein unermeßlicher, sonnenübersprühter Hochwald als Hintergrund dieses Gemäldes. In diesem Aufleuchten erfaßte der Priester deutlich in der Ferne genaue Einzelheiten: eine große gelbe Blume mitten auf einem Rasenplatz, einen breiten Wasserfall, der von einem hohen Felsen niederstürzte, einen riesigen Baum, in dem ein Schwarm Vögel sich niedergelassen hatte; das Ganze ertränkt, verloren, flammend inmitten eines solchen Wirrwarrs von Grün, einer solchen Orgie wuchernder Pflanzen, daß der ganze Horizont nur ein einziges Aufblühen war.
Die Tür schlug zu, alles verschwand.
„Aha, das liederliche Weibsbild!“ rief Jeanbernat. „Sie war schon wieder im Paradou!“
Albine stand lachend auf der Schwelle des Hausflures. Sie trug einen orangefarbenen Rock und ein auf dem Rücken befestigtes, großes rotes Schultertuch, was ihr das Aussehen einer Zigeunerin im Sonntagsstaat verlieh. Und sie fuhr fort zu lachen, den Kopf zurückgeworfen, die Brust ganz geschwellt von Fröhlichkeit, glücklich über ihre Blumen, wilde Blumen, die in ihre blonden Haare geflochten, um ihren Hals, ihr Mieder, ihre schlanken nackten und goldbraunen Arme gewunden waren. Sie glich einem großen, stark duftenden Strauß.
„Na, du siehst ja schön aus!“ schimpfte der Alte. „Du riechst nach Gras wie die Pest . . . Würde man denken, daß sie schon sechzehn Jahre alt ist, diese Puppe!“
Übermütig lachte Albine noch lauter. Doktor Pascal, der ihr großer Freund war, gab sie einen Kuß.
„Hast du denn keine Angst im Paradou?“ fragte er sie.
„Angst? Wovor denn?“ fragte sie zurück und machte erstaunte Augen. „Die Mauern sind zu hoch, niemand kann herein . . . Da bin nur ich. Das ist mein Garten, er gehört mir ganz allein. Er ist unheimlich groß. Ich habe sein Ende noch nicht gefunden.“
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Die Sünde des Abbé Mouret»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Die Sünde des Abbé Mouret» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Die Sünde des Abbé Mouret» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.