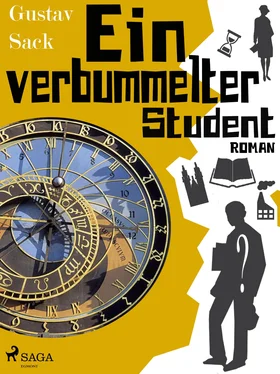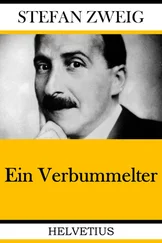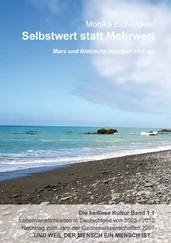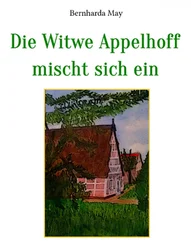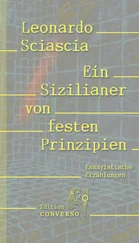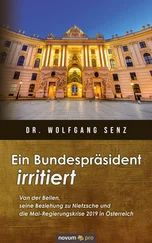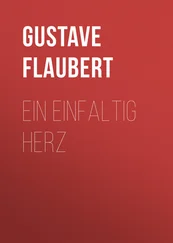Aber je tiefer ich mich in diese Gestalten flüchtete, je vertrauter mir das Rauschen eines einsamen Wacholders wurde und je bedeutsamer die schwüle Stille des Mittags, wo die Kornweibchen über den wogenden Roggenfeldern geistern, desto tiefsinniger zugleich, rätselhafter und einem innigen Erfassen widerstrebender wurde das, was mich da umgab. Und da kam es, daß ich eines Tages neugierig in einen Garten trat voll hoher Pappeln: doch was Spinoza mir zu Einem Großen einte, zerschlug Schopenhauer mit einem Hieb: ich und das Ding da draußen, das ich doch erraten wollte, ich und das Ding in mir, das ich doch fassen wollte: und da bekam ich ein Wort, ein wüstes wildes drängendes Wort – und so war es denn wieder nichts weiter als der in ein Wort verkleidete hinterweltliche Finstergott und der Junge, der mit seinen schwachen Kräften gegen ihn loszieht.
So warf ich das Große Eine, das ich ersehnte und wofür ich nun die Formel gefunden, und die ewige Zweiheit, die ich fürchtete, deren Formel ich aber nicht widerlegen konnte, zusammen und begnügte mich mit Schlagworten, die ich nur zum Teil verstand.
Aber was mir so an Verständnis abging, ersetzte sich reichlich durch Gefühl. Ich wußte und fühlte mich glücklich darüber, daß ich mit meinem amor dei , meiner substantia cogitans et extensa oder meiner Erlösung des Willens durch den Intellekt, meiner interesselosen Anschauung, meiner Welt als moralisches Problem irgend etwas Tiefes aussagte und jedenfalls den Dingen näher stand als meine Mitschüler und Lehrer, wenn sie mit donnerndem Pathos »die Worte des Glaubens« hinwarfen und nicht ahnten, was sie sagten und, wußten sie es, zu feige waren, aus ihrem Wissen die Konsequenzen zu ziehen. Sie fühlten, wie ich sie kannte und verachtete, und dankten mir mit Spott und gemeinem Hohn.
Und dann war ich eines Morgens Student, war Fuchs und stand unter der kalten Ernüchterungsdousche: Schau, Leibfuchs, jetzt kommt das Leben, Mädel, Schläger- und Gläserklang! Und in den Ferien: bald nächtlicher Wanderer im Wald, bald Sternengucker; bald Mikroskopiker, bald trübsinniger Träumer am Bach – – semester-, jahrelang. – Da tauchte das Wort Sehnsucht auf – es hing so in der Luft, da holte ich es herunter. Und dann? Wo vorher die Sehnsucht gehangen, hing nun das Examensgespenst, wurde größer und größer und hüllte sich in die absonderlichsten Masken. –
Und jetzt liege ich hier und bin ein verbummelter Student. Und suche mir zu helfen, indem ich mich mit klarer Absicht und hellstem Bewußtsein auf dieser Bummelbahn des flüchtigen Naschens fortrollen lasse. Soll denn das Unergründliche, das mich in das bewußte Dasein geworfen, nur sein Spielzeug an mir haben wollen? Ein interessantes Experiment mit mir anstellen wollen, was aus solchem Konglomerat aus haltlosem Willen und überwacher Anschauung, hineingestoßen in das rastlos und erbarmungslos rollende Rad des Lebens, wird – um es dann, wenn es zerschellt, in die Rumpelkammer der mißratenen Existenzen zu werfen? Hm, auch mich interessiert’s.
Ja, lieber Strom, das ist derselbe Knirps, den du vor zwanzig Jahren das Schwimmen gelehrt – ein wenig größer geworden, ein wenig dummer, ein wenig klüger, ein wenig braun gebrannt, ein wenig zerhauen – – Wie die Sonne brennt! Als ich am Lubminer Strand oben in Pommern lag, zog sie mir die Haut in Fetzen vom Leibe – ah! da war Leben.
Sollte vielleicht das, was ich meine blaue Sehnsucht, nenne, die versteckte Wut nach lautem Leben sein? Soll erst dann meine Willenskraft aufwachen, wenn ihm etwas Gewaltiges entgegentritt, nicht dieser elende Mikrokrimskrams von Bücherstaub und Tiftelei – Kampf und Krieg, ein lohendes Glück, ein mich niederschmetterndes, buchstäblich mich mit Füßen tretendes Leid – brausendes riesenfäustiges Leben?
Sehnsucht nach dem Leben? Eine vermaledeite Sehnsucht – schmeiß sie fort! –
Es war spät am Nachmittag, als Erich müde und wie betäubt von der brennenden Sonne zu Hause ankam.
Als es Abend ward, blätterte er in seinem verehrten Byron und las das süße Märchen von dem griechischen Inselkind Haidie. –
Und als er am nächsten Tag vom Bade heimkehrte, ging er auf sein Zimmer und schrieb:
Die Kieselkristalle blinzeln und glitzern mich an – bald fern und still wie ein Stern, bald wie neckische Geister. Über ihnen breitet ein Sauerklee, die hohe, ästige, an Gartenhecken häufige Form, seine Blätter; flach ausgebreitet am Tage, dicht zusammengefaltet in der Nacht – wie liegt in diesen bescheidenen Bewegungen das ganze Rätsel des Lebens!
Man nennt und gruppiert sie unter dem Namen Schlafbewegungen, nyktitropische, und reiht sie unter die durch äußere Reize hervorgerufenen Variationsbewegungen. Das sagt, mir nichts: so habe ich Schnitte durch die Blattpolster gemacht und sie unter dem Mikroskop betrachtet. Das sagte mir noch weniger.
Gewiß, wie diese Bewegungen möglich sind und zustande kommen, kann ein Schuljunge verstehn. Aber hiermit begnügen wir uns nicht, wir glauben mit diesen Bewegungen einen augenscheinlichen Nutzen für die Pflanze verbunden und kommen so immer wieder auf die verrufene Zwecktätigkeit zurück. Nun können wir aber nicht ins Blaue hinein den Pflanzen Empfindungen der Außenwelt und ein zweckmäßiges Reagieren auf deren Veränderungen zuschreiben, doch nicht das Bedürfnis als Grund der Handlung, es zu befriedigen, hinstellen. Sie müßten das Bedürfnis nicht nur deutlich empfunden, sondern klar erkannt haben und darnach unter den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten die zweckmäßigste aussuchen und zielbewußt anwenden, um das so erkannte Bedürfnis zu stillen. Und wissen wir überhaupt so bestimmt, ob ein solches Bedürfnis, wie wir es meinen, vorlag? Ob mit der erreichten Handlung überhaupt irgend ein Nutzen, und wenn – ob gerade dieser damit verknüpft war?
Und dem Plasma, als der lebenden Kohlenstoffverbindung, allgemein die Fähigkeit der Empfindung und des zweckmäßigen Handelns zuzuschreiben, sagt garnichts; das ist nur eine Phrase mehr.
Und schalte ich die Zweckmäßigkeit und auch einen unbeabsichtigt erreichten Nutzen aus und betrachte allein den nackten Zusammenhang von Ursache und Wirkung, so haben sich vielleicht unzählige Ursachen von irgendwo her an diesem Punkt getroffen und ihr Zusammenstoß war eben die »zufällige« Ursache zu dieser ungewußten und ungewollten Wirkung.
Und diese Wirkung, diese Erscheinung hat sich nun vererbt – und zwar ohne daß in allen Fällen die zufälligen Ursachen, wie sie die erste Erscheinung bewirkt haben, weiter wirkten –, nun komme ich schon ohne Empfindung, Nutzen und Zweckmäßigkeit nicht weiter. Ich muß sagen: Die Pflanze hat den Nutzen der einmaligen Abänderung empfunden, er hat ihr im bekannten Kampf ums Dasein geholfen, und sie hat ihn deshalb ihren Kindern vererbt – denn die Erklärung: Das ist eine spezifische Eigenschaft des Plasmas, die durch äußere oder innere Eindrücke in ihm bewirkten Veränderungen zu vererben, ist keine Erklärung, ist nur eine sehr wohlfeile Beschreibung.
Aber auch schädliche Abänderungen vererben sich – ? –
Und nun steckt einmal in dieses Durcheinanderwirken von Ursachen und Wirkungen, Vererbungen und Anpassungen, unbewußten und bewußten Empfindungen, zweckmäßigen bewußten und unbewußten Handlungen, Tropismen, Nastien und Instinkten eure Molekulartheorie hinein, beseelten Stoff und stoffliche Seele, Kräfte von irgendwo her, die irgendwo angreifen – wundert ihr euch dann noch über euer hilfloses Gesicht? – Aber euer Gesicht ist glatt und eure Brillen sind ganz vergnügt – –?
Oder liegt die Erklärung wieder darin, daß wir alle Erscheinungen als in Wirklichkeit auch so seiend aber auch nur so seiend auffassen, wie sie uns scheinen, und sofort sie nach Zeit, Raum und Ursächlichkeit ordnen, schematisieren und erklären wollen, wo unser Intellekt vielleicht garnicht geschaffen ist, die Dinge adäquat zu erkennen? Aber weswegen ist er denn fähig, seine Unfähigkeit zur absoluten Erkenntnis einzusehen? Weswegen muß ich denn wissen, daß ich nichts wissen kann?
Читать дальше