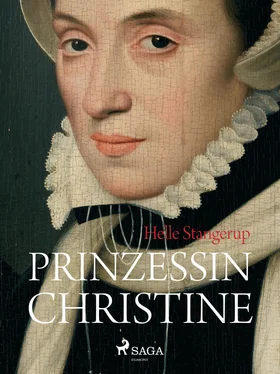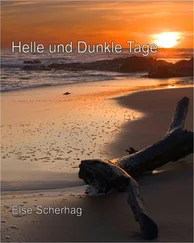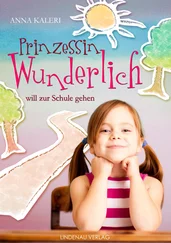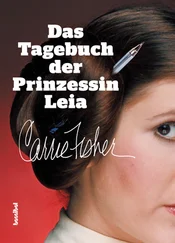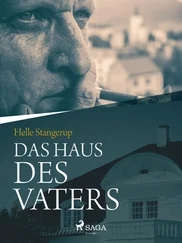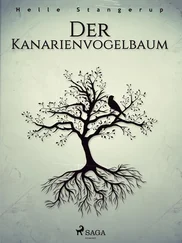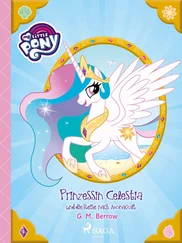Es begann an dem Tag, an dem Dorothea über den Arkaden Spatzen fütterte. Sie lehnte sich immer weiter hinaus, unvorsichtig wie sie war, und Christine stieß einen Schrei aus, als sie ihre Schwester aus dem offenen Fenster verschwinden sah.
Doch unten auf dem Hof mußte eine von den Weibsleuten vorausgesehen haben, was geschehen würde, denn sie ließ den Korb mit der Bettwäsche fallen, breitete ihre dicken Arme aus, fing Dorothea und setzte sie zwischen zwei Säulen ab, indem sie ausrief: »Die Dummen haben das Glück.«
Die Regentin ritt gerade mit ihrem Gefolge auf den Hof, ohne jedoch etwas von Dorotheas Vergehen zu bemerken, denn ebenso schnell, wie die Frau zugriff, glättete sie Dorotheas Schnürleibchen und schob die Haube zurecht.
Diese Frau war Johanne, und die Mädchen vergaßen ihr nie, wie sie geholfen hatte. Johanne war für die Wäsche verantwortlich, gehörte aber, obwohl sie einige Mägde unter sich hatte, zu den Weibsleuten und nicht zu den Damen, und daran ließ sich nichts ändern.
Beim ersten Mal kamen sie heimlich zu ihr und gaben ihr zwei Apfelsinen, doch später wurden sie mutiger und redeten mit ihr, und im Gegensatz zu all den anderen antwortete Johanne auf ihre Fragen. Sie erhielten die Erlaubnis, daß Johanne sich um ihre Zimmer und die Kleidung kümmerte, und auf diese Weise zog Johanne aus dem Unterstock herauf zu den Fräuleins, und in der Gesindestube bekam sie einen feineren Platz und aß mit der Beschließerin an einem Tisch, auch wenn sie natürlich am untersten Ende saß.
Johanne kümmerte sich nicht nur um die Kleidung, sie konnte auch erzählen, und durch sie eignete sich Christine ein Wissen an, das sie nicht in der Schulstube erwarb. Johanne erzählte von »damals«, und das waren die Jahre, als sie auf einem kleinen Bauernhof im nordwestlichen Brabant gelebt hatte. Sie hatte fünf Kinder zur Welt gebracht, zuerst drei Knaben, und dann hatte Gott sie mit den Mädchen gesegnet, alles gesunde und wohlgestaltete Bälger. »Damals« handelte von Kirchweihfesten und Hochzeiten, bei denen auf dem Dudelsack gespielt wurde, handelte davon, wie man eine Kuh molk, wie eine Mühle von innen aussah und wie man auf dem Viehmarkt feilschte, »damals« war aber auch, »daß Gott gab. Und Gott nahm.«
Im Jahre des Herrn 1520 kam die Pest. Das erste Mädchen erkrankte am St. Valentinstag. Binnen einer Woche war sie tot, und ehe der Monat vorbei war, hatte die Pest auch den Vater und die vier anderen Kinder genommen. Der Totengräber starb und auch die Leute auf den anderen Höfen. Doch die Mutter schaffte es, ihre Familie in geweihter Erde zu begraben. Sie zog sie mit einem kleinen Schlitten dorthin, erst die eine kleine Leiche, dann die übrigen.
Christine und Dorothea waren entsetzt, und Johanne tröstete sie, denn wenn die Pest nach Mechelen kommen sollte, würde der Hof sofort an einen Ort verlegt, wo keine Seuche war. Der Kaiser hatte andere Schlösser, doch die Leute hatten keine anderen Häuser, wohin sie gehen konnten.
Johanne trieb sie nun zur Eile an, »Madame Dorothée« und »Madame Chrétienne«, wie sie immer sagte, obwohl sie kein Wort Französisch konnte. Es war keine Zeit mehr zum Erzählen, denn sie mußten sich für das Abendessen zurechtmachen.
Wenn die Tante mit ihnen speiste, passierte immer etwas Spannendes. Eine Truppe mit zahmen Bären oder Chorsänger und Musikanten aus England traten auf. Johanne wußte zu berichten, daß sie zuerst gewaschen wurden, denn sie stanken, und die Regentin wollte sie nicht in der Nähe ihres Tisches haben. Johanne meinte außerdem, daß die Regentin die Sonette des Königs von England mehr schätzte als den König selbst, aber das dürften sie niemandem sagen. Sie sahen Marionettentheater und Jongleure, und manchmal wünschte sich Christine, ihrem Vater einen Brief schreiben zu können. Wenn er zurückkommen und bei ihnen wohnen würde, wäre die Welt wunderbar und sie würde das glücklichste Kind der Welt sein, was sie schon beinahe war. Dann könnten sie auch wieder Dänisch reden, wie er es wollte, und er hätte teil an ihrem Leben in Mechelen.
Zwischen den Vorstellungen der Artisten und Musikanten gab es stets etwas Interessantes für sie. Florentinische Kaufleute kamen oft mit ihren erlesenen Seidenstoffen. Dann wurde eingekauft, und ihre Tante wußte genau, was kleidsam war, wie viele Alen man benötigte und wie viel man zugeben mußte, wenn sie wuchsen. Das war wichtig, und sie wurden ihrem königlichen Rang entsprechend ausgestattet, aber es gab auch keinen Grund, zu verschwenden.
Alle waren freundlich zu den Geschwistern. Die Adeligen redeten mit ihnen, das Gesinde und die Soldaten lächelten nur, zeigten aber, daß sie Christine und ihre Schwester Dorothea und ihren Bruder Hans mochten. Alle außer einer.
Das war Kiki.
Kiki war eine Zwergin. Aber Kiki war auch ein Wechselbalg. Jedenfalls bestand unter den Dienern und dem Gesinde am Hof Einigkeit, daß Kiki sicher einige Zoll größer geworden wäre, wenn sie nicht so viele Prügel bekommen hätte, die ihr den Rücken zertrümmerten.
Die Prügel waren entschuldbar, denn sie sollten die Unholde dazu veranlassen, Balg und Menschenkind noch einmal auszuwechseln. Aber das Gör mit seinen abstehenden roten Haaren war so häßlich anzusehen, daß die erlittenen Prügel kein Mitleid bei den Unholden erregten und die beiden Kinder blieben, wo sie waren. So wuchs Kiki bei den Menschen auf, obwohl sie in den Untergrund gehörte, während das richtige Kind ein kümmerliches Schicksal unter Unholden und anderem Pack fristen mußte und niemals wiedergesehen wurde.
Wo immer sie auch hergekommen sein mag, sie war früh von zu Hause fortgelaufen. Sie streunte einige Jahre herum und kam nach Antwerpen, als die Regierung anfing, sich um elternlose Kinder in den Straßen zu kümmern. Sie sollten in Asyle geschickt werden, wo sie die Möglichkeit hatten, lesen und schreiben zu lernen und anständige Bürger zu werden – bis zu dem Tag, an dem sie ihr Ende unter dem Beil des Henkers fanden.
Im Schutz der Dunkelheit wurde Kiki mitgeschleppt, als man sie aber näher betrachtete und merkte, daß sie weitaus älter als sechs, sieben Jahre war, meinte ein kluger Kopf, sie könnte der Regentin nützlich sein. Kiki wurde also an den Hof geschickt, als Geschenk der Stadt Antwerpen.
Das war Kikis Glück. Zum ersten Mal in ihrem Leben traf sie einen Menschen, der sie brauchen konnte, und das war die Regentin persönlich.
Kiki wurde zu der kleinen Fürstin gerufen, die sie bat, von ihrem Leben zu erzählen. Und obwohl Kiki vor Angst zitterte, erzählte sie alles, was sie gehört und gesehen hatte, wenn sie sich hinter Heuhaufen und Scheunentoren oder in Mühlen und Ställen versteckt hatte. In ihrem ganzen Leben hatte Kiki nur das eine gelernt: sich vor Prügel zu verstecken. Sie hatte sich angewöhnt, sich lauschend und beobachtend die Zeit zu vertreiben.
Die Regentin lachte, der schwere Kopf bebte unter dem Schleier, und je mutiger Kiki bei ihrem Erzählen wurde, um so mehr lachte die mächtige Herrin. Aber dann hielt die Regentin inne, sie faltete die Hände im Schoß und fragte diskret: »Was meinen die Bauern zu den Steuern?«
Sie hob den Blick, schaute prüfend in Kikis kleines, faltiges Gesicht, und Kiki lächelte glücklich. Endlich brauchte jemand ihre besonderen Fähigkeiten.
Von da an verließ Kiki den Mechelner Palast täglich bei Sonnenaufgang und kehrte erst zurück, wenn die Dunkelheit über die Stadt hereinbrach, und oft wurde wie hereingerufen, um der Regentin Bericht zu erstatten. Manchmal war es nur wenig, aber wenn Schauspieltruppen die Leute auf den Markt lockten und das Bier in Strömen floß, daß sich die Zungen lösten, konnte sie eine ganze Stunde oder länger über Hurereien, Diebstähle, Erbitterung wegen der Steuern und Getratsche englischer Kaufleute von Ereignissen am Hof in London berichten.
Читать дальше