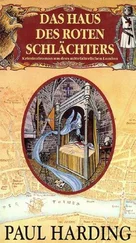Helle Stangerup
Stiefvater zog vor zwanzig Jahren, im Winter 1974, in Hvidager ein. Das Haus lag am Ende einer kleinen Nebenstraße zum Øresund, und er kaufte das Haus zu einer Zeit, als die Wohlhabenden vor Seenebeln, autofreien Sonntagen und überhöhten Ölpreisen flohen und den schönen Küstenstreifen zurückließen, der mit Schildern »Zu verkaufen« übersät war wie von einer ansteckenden Hautkrankheit.
Damals hatte das Anwesen Strandly geheißen. Doch die acht schwarzen Eisenbuchstaben wurden umgehend von einem Mann auf einer Leiter und mit einer Zange aus der Mauer gerissen. Die Fenster zum Sund verdeckten Rolläden und später dreifache Vorhänge. Es war ein Haus ohne Morgensonne.
Stiefvater verabscheute das Meer oder jede Art von Wasser, es sei denn, es kam aus Leitungen ins Badezimmer, wo es von einem Hahn unter Kontrolle gehalten wurde. Wasser in größeren Mengen führte ihn geradewegs zurück in eine demütigende Kindheit in einem Fischernest an der Westküste Jütlands.
Der Name Hvidager wurde in aller Eile erfunden, ohne daß sich später jemand erinnern konnte von wem, und über die Eingangstür genagelt. Man verband damit etwas Ländliches, etwas wie eine weite Ebene oder ein Tal.
Von außen war Hvidager unscheinbar. Doch im Innern lebten Stiefvaters Geist und seine Unternehmungen. Auch die von früher. Sie zogen ein, als er einzog, buchstäblich mit dem Umzugsgut, und sie knüpften sich zu einem Knoten, der sich immer fester zusammenzog, so fest, daß er zu versteinern schien.
Das Haus war für Stiefvater, wie alle anderen Anschaffungen in seinem Leben, eine Investition. Obwohl er jede Religion mit derselben Inbrunst haßte wie das Meer, hingen unzählige russische Ikonen an der Wand über der Treppe. Die vielen bemalten Holztafeln waren durch ein diskretes Geschäftsessen mit einem Karriereanwalt hierhergekommen, der berechtigte Angst vor der Presse hatte. Stiefvater verfügte nämlich über die Boulevardpresse. Der Anwalt über eine interessante Konkursmasse. Auf diese Weise wurde Stiefvater für einen symbolischen Betrag Eigentümer einer einzigartigen Sammlung von Maria-mit-Kind-Darstellungen aus dem 15. Jahrhundert, Großfürstentum Moskau.
Die Ortmann-Kommoden, das mit Möbeln vollgestopfte Eßzimmer und das Gewimmel von Staffordshire-Figuren, die er selbst abscheulich fand, waren ein Reibach aus dem Nachlaß eines Antiquitätenhändlers. Er hatte sie mit dem Einverständnis der Erben und eines korrupten Testamentsvollstreckers ergattert. Die gelben Rassehunde, Retriever, stammten aus einem Zwinger, dessen Besitzer durch eine anonyme Anzeige der Verwahrlosung bezichtigt worden war. Als sich herausstellte, daß die Anzeige jeder Grundlage entbehrte, war der Besitzer längst bankrott. Die Münzsammlung war die eines Altphilologen von der Trabrennbahn, eines reichen Erben und ewigen Verlierers. Die kostbaren Münzen reichten gerade aus, um, verpackt in eine Schachtel, zwischen zwei Rennen gegen einen mageren Scheck den Besitzer zu wechseln. Sogar die Kinder, Claus und Ulrik aus erster Ehe und Alex und Tatjana aus zweiter, beruhten auf Verlustkonten. Zwei Ehefrauen und Mütter wurden mit fingierten Nachweisen über abnormales sexuelles Verhalten in das gesellschaftliche und finanzielle Dunkel befördert.
Die Abschiedszeremonien waren kurz und billig. Ehre und Lauterkeit, Vertrauenswürdigkeit, Anständigkeit, Untadeligkeit und Rechtschaffenheit lagen allein auf seiner Seite, dokumentiert durch das Sorgerecht für die Kinder aus beiden Ehen, die er getrennt von ihren Müttern und ohne ein lobendes Wort aufzog. Hinter allem steckte Berechnung. Außer bei der grauen Katze und bei Nanna.
Die Katze hatte im vorigen Herbst mehrere kühle Nächte hintereinander vor der Eingangstür miaut, bis sie aus unbegreiflichen Gründen hereingeholt wurde.
Von Läusen und Flöhen befreit und auf alle denkbaren Krankheiten untersucht, nistete sich das Tier bei Stiefvater ein, indem es das Haus ganz in Besitz nahm und seine Person systematisch ignorierte. Als man sie zum erstenmal auf seinem Schoß bemerkte und seine alte, sehnige Hand eine zärtliche Bewegung machte, erregte das ebensoviel Aufsehen wie damals vor dreißig Jahren, als Nanna sich im Alter von acht Jahren durchgesetzt hatte und ein Weihnachtsbaum in seinem Haus aufgestellt worden war. Weder für die Katze noch für den Weihnachtsbaum gab es eine vernünftige Erklärung.
Auch Nanna war auf ihre Weise zugelaufen. »Jetzt brauchst du nicht mehr mit dem Schlüssel um den Hals in die Schule zu gehen«, hatte Nannas Mutter gesagt und ihr über das hübsche, blonde Haar gestrichen, als bestünde ein Zusammenhang zwischen beidem. Nanna und ihre Mutter hatten Kuchen mit grünen Mandeln auf einer karierten Tischdecke im Vergnügungspark Dyrehaven gegessen. Sie waren mit dem Zug dorthin gefahren. Sie würden nun in einem großen, schönen Haus wohnen. Und Nanna würde einen Vater bekommen. »Eine Art Vater«, sagte die Mutter und biß sich auf die Lippe statt in den Kuchen.
Nanna hatte nie einen Vater gehabt. Solange sie denken konnte, hatte es nur sie und die Mutter gegeben. Nanna war jeden Tag nach der Schule in die leere Wohnung mit dem Balkon zum Hinterhof gekommen. Bei warmem Wetter saß sie in der Sonne und machte ihre Schularbeiten auf dem grünen Balkon mit Knoblauch-, Dill- und Petersilientöpfen.
Am späten Nachmittag, noch ehe die Mutter den Schlüssel ins Schloß steckte, hörte Nanna ihr Summen im grau getupften Treppenhaus. Die Mutter summte immer, außer wenn ein böser Fremder anrief. Dann weinte sie: »Es war ein Unfall ... ein Unfall ...« Manchmal schrie sie es. Nanna wußte nicht, wer da anrief. Eines Tages ließ die Mutter das Telefon klingeln und klingeln, starrte nur auf den schwarzen Apparat.
Die Mutter sollte einen Mann heiraten, der sie vor dem bösen Fremden beschützen würde. Das hatte sich Nanna gewünscht. Doch an jenem Tag in Dyrehaven summte die Mutter nicht. Deshalb wollte Nanna auch nicht Papa sagen, wie es die Mutter vorgeschlagen hatte, als sie vor dem großen Mann stand. Er glich einer hohen, grauen Säule, die sie einmal gesehen hatte, einer alten Säule, die längst hätte umstürzen sollen. Sie streckte eine Hand hin und sagte: »Guten Tag, Stiefvater.« Er sagte: »Guten Tag, Nanna.«
Dann sagte sie nichts mehr zu ihm. Er sagte auch nichts mehr zu ihr. Das war in dem Haus Hvidager. Das Haus, das verkauft und später abgerissen wurde, weil es rentabler war, das große Grundstück in acht kleine Parzellen für acht gleiche Backsteinhäuser aufzuteilen.
Stiefvater konnte Feiertage nicht ausstehen, bis auf die, die er selbst festlegte, viermal im Jahr. Deshalb durften sie kein Weihnachten feiern.
Nanna war wütend. Nicht so sehr wegen der Sache mit dem Weihnachtsbaum. Sie war wütend, weil sie das Gefühl hatte, daß ihre Mutter die hohe, alte, graue Säule nur geheiratet hatte, damit sie, Nanna, vornehm gekleidet in eine vornehme Schule gehen und in einem vornehmen Haus wohnen und weite Reisen machen konnte. So empfand sie es jedenfalls, ebenso wie es aus irgendeinem Grund ihre Schuld war, daß die Mutter nie ihre Familie sah. Nicht einmal ihre Eltern.
Nanna sparte ihr Taschengeld, und am Heiligabend, während ihre Mutter beim Zahnarzt war, kaufte sie den größten Baum, den sie vom Markt am Hafen heimtragen konnte. Sie stellte ihn mitten in die Wohnstube mit den Glastüren zum Garten. Für Nanna gab es nichts Schöneres als Christbaumschmuck. Er wurde in einem Spankorb in einer Küchenschublade verwahrt. Der Schmuck war aus Glas. Kugeln, Vögel mit Schwänzen, die weich wie Seide waren, und kleine Trompeten, die einen Ton von sich gaben. Aber am meisten liebte sie eine Kugel, in die man hineinschauen konnte. Sie war sehr alt, stammte aus der Zeit, als Nannas Mutter klein war. Sie schimmerte in allen Farben. Manchmal holte Nanna die Kugel aus dem Korb und setzte sich damit auf den Balkon in die Sonne. Als Nanna von Aladins Höhle hörte, wußte sie sofort, wie sie aussah. Sie war schon dort gewesen.
Читать дальше