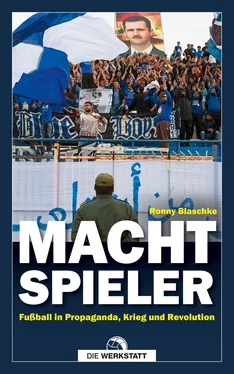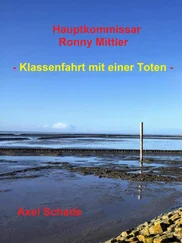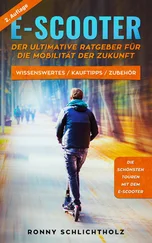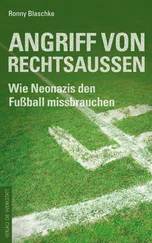Ronny Blaschke - Machtspieler
Здесь есть возможность читать онлайн «Ronny Blaschke - Machtspieler» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Machtspieler
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Machtspieler: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Machtspieler»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Der Journalist Ronny Blaschke hat auf vier Kontinenten recherchiert, durch das Vergrößerungsglas Fußball blickt er auf Gesellschaft, Kultur und Religion. Das beliebteste Spiel zwischen Propaganda und Protest.
Machtspieler — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Machtspieler», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Das Wahrzeichen, die Stari Most, wurde erneuert und 2004 wiedereröffnet, seitdem wachsen die Tourismuszahlen stetig. „Für unsere Gäste ist die Segregation in der Stadt nicht wirklich sichtbar, es gibt keine Mauern, alle können sich frei bewegen“, sagt Esmer Meškić, aufgewachsen im östlichen Teil. Während des Krieges gehörte sein Vater einer bosniakischen Einheit an. Mit seiner Mutter und seinen Großeltern wurde er als Kleinkind für einige Wochen in einem kroatischen Lager interniert. Nach dem Krieg ging er in eine Klasse mit ausschließlich muslimischen Schülern. Mit 16 schloss er sich den Ultras von Velež Mostar an. Der 1922 gegründete Arbeiterklub, benannt nach einem Hügel, war über Jahrzehnte ein Sinnbild der multiethnischen Stadtgesellschaft gewesen und wurde vom jugoslawischen Präsidenten Tito gewürdigt, noch heute gehört der Rote Stern zum Vereinswappen. „Vor dem Krieg lebten die Fans von Velež im gesamten Stadtgebiet, das ist jetzt nicht mehr so“, erzählt Esmer Meškić. „Als junger Ultra habe ich genau überlegt, wann ich in die westliche Stadthälfte gehe. Einige Straßen und Bars habe ich gemieden.“ Es werde langsam besser, fügt er hinzu, aber von einem entspannten Zusammenleben könne noch keine Rede sein.
Fast zwanzig Jahre hatte Velež Mostar seine Heimspiele auf der Westseite im Stadion Bijeli Brijeg ausgetragen, übersetzt Weißer Hügel. Doch mit der Auflösung Jugoslawiens verlor Velež seine Heimstätte 1992 an HŠK Zrinjski Mostar. Der Klub mit kroatischen Wurzeln war 1905 gegründet und 1945 von den Kommunisten verboten worden, wegen seiner nationalen Symbolik und seinen Verbindungen zur faschistischen Ustascha. Nach der Neugründung gewann Zrinjski sechsmal die Meisterschaft in Bosnien und Herzegowina. Viele Ultras würden ihren Verein jedoch lieber in einer vergrößerten kroatischen Liga anfeuern. Die Straßen rund um Bijeli Brijeg im Westteil Mostars sind mit ihren Graffitis markiert, darunter martialische Motive, Hakenkreuze und Symbole der Ustascha. „Fans von Zrinjski haben die Zerstörung unserer historischen Brücke gefeiert“, sagt Esmer Meškić. „Für uns ist das eine große Provokation.“
Klub der Katholiken
Doch die Feindseligkeiten können noch schlimmere Folgen haben, wie Alexander Mennicke in seiner Bachelorarbeit über nationale Identität im bosnischen Fußball herausgearbeitet hat. Der Politikwissenschaftler rückt darin die Kleinstadt Široki Brijeg in den Fokus, zwanzig Kilometer westlich von Mostar gelegen und fast ausschließlich von Kroaten bewohnt. „Man fühlt sich der kroatischen Nation zugehörig und propagiert die kroatische Republik auf bosnischem Boden – Herceg-Bosna, ein Begriff, der seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer wieder auftauchte“, schreibt Mennicke und meint damit auch den lokalen Fußball-Erstligisten NK Široki Brijeg. „Das Besondere ist, dass es nur Katholiken erlaubt ist, im Verein Fußball zu spielen.“ In einer Choreografie erinnerten die Ultras aus Široki Brijeg an die „Operation Sturm“, in der kroatische Einheiten 1995 serbische Truppen vertrieben hatten. In einer anderen präsentierten sie dem Europapokalgegner Beşiktaş Istanbul einen Kreuzritter mit dem Schriftzug: „Bollwerk der Christenheit.“
Häufig eskalierte die Lage, wenn Široki Brijeg auf Klubs mit überwiegend muslimischen Anhängern traf, so auch am 4. Oktober 2009 beim Heimspiel gegen den FK Sarajevo. Ultras warfen Steine und prügelten sich. Im Chaos ergriff ein Kroate mutmaßlich die Waffe eines Polizisten und erschoss Vedran Puljić , einen Fan des FK Sarajevo. Der Täter wurde festgenommen, konnte aber Stunden später fliehen und sich nach Zagreb absetzen, wo er keine Auslieferung zu fürchten hat. „Die verwundeten Fans aus Sarajevo sind zu uns nach Mostar gekommen“, sagt Esmer Meškić, Anhänger von Velež Mostar. „Wir haben ihnen Schlafplätze und Essen angeboten, das hat unsere Verbindungen gestärkt.“ Bis heute ist der Tod von Vedran Puljić nicht genau aufgeklärt.
Esmer Meškić schildert seine Erinnerungen in Mostar in einem Café nahe der erneuerten Bogenbrücke, als Tourismusmanager führt er oft Gruppen durch die Gassen der Altstadt. Er schaut hinüber zum „Museum of War and Genocide“, einem Erinnerungsort mit erschütternden Bildern und Videos über den Völkermord in Srebrenica. „Jedes Land auf dem Balkan hat eine eigene Geschichtsschreibung“, so Meskić. „Wir müssen unseren Kindern aber die objektive Wahrheit nahebringen. Und die findet man beim Internationalen Strafgerichtshof.“ Viele seiner Freunde und Bekannten sind für bessere Jobs nach Westeuropa gezogen, er aber will bleiben. „Ich kann nicht jeden Kroaten hassen. Verbrechen werden von Individuen begangen, nicht von ganzen Bevölkerungen.“
Kosovarische Spieler im Untergrund
Auf der Recherchereise durch den westlichen Balkan stechen immer wieder Optimisten heraus, Entscheidungsträger mit konstruktiven, fortschrittlichen Ideen, so ist es auch in Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. „Wir wünschen uns Normalität ohne Hass. Wir möchten nach vorn schauen“, sagt Eroll Salihu, seit 2006 Generalsekretär des kosovarischen Fußballverbandes. „Aber es wird uns sehr schwer gemacht.“
Der Kosovo hatte im sozialistischen Jugoslawien eine Sonderrolle gespielt: mit einer Bevölkerungsmehrheit ethnischer Albaner und einer serbischen Minderheit. Diktator Tito verweigerte dem Kosovo den Status einer Teilrepublik, gewährte aber 1974 mehr Autonomie. Die mehrheitlich muslimischen Kosovo-Albaner blieben in Führungspositionen unterrepräsentiert. Gemischte Ehen zwischen albanischen und serbischen Kosovaren gab es kaum. In den 1970er Jahren erreichte das Pro-Kopf-Einkommen im Kosovo nur 38 Prozent des jugoslawischen Durchschnitts. In Bildung, Medizin und Industrie bestand ein Gefälle zu Teilrepubliken wie Slowenien, Kroatien und Serbien. Viele Kosovaren fühlten sich kulturell ohnehin mit dem westlichen Nachbarstaat Albanien verbunden.
„Wir wollten keine Bürger zweiter Klasse sein. Im Fußball konnten wir zeigen, wer wir sind“, sagt Eroll Salihu. In der Geschäftsstelle des Fußballverbandes führt ein enger Gang zum Büro von Salihu, an den Wänden hängen historische Bilder, auch ein Teamfoto des FC Pristina. Salihu war ein talentierter Jugendspieler, als die Unterdrückung der Kosovo-Albaner Anfang der 1980er Jahre nach dem Tod Titos zunahm. Die serbisch dominierte Polizei ging streng gegen Kosovaren vor, in der jugoslawischen Armee fielen ethnische Albaner einer Mordserie zum Opfer. Allmählich wuchs bei Kosovaren Proteststimmung. Bei einem Spiel des FC Pristina 1983 in Belgrad skandierten Gästefans „E-Ho! E-Ho!”, eine Respektsbekundung für Enver Hoxha, den Diktator Albaniens. Die Polizei schritt im Stadion ein, die jugoslawische Führung forderte eine offizielle Entschuldigung.
Eroll Salihu gerät ins Schwärmen, wenn er an die Heimspiele des FC Pristina denkt, zwischen 1982 und 1988 in der ersten jugoslawischen Liga, häufig vor mehr als 30.000 Zuschauern. „Durch Siege gegen die Belgrader Vereine haben wir unsere Sorgen für eine Weile vergessen“, sagt Salihu. Das jugoslawische Parlament nahm die Autonomie des Kosovo 1990 zurück, der serbische Präsident Slobodan Milošević ließ Albaner aus staatlichen Ämtern drängen. Ihr Schulwesen wurde stark eingeschränkt, viele ihrer Parteien und Vereine wurden verboten.
Zahlreiche Albaner bauten im Untergrund Strukturen in Bildung und Gesundheitsversorgung auf. Eroll Salihu war damals Mitte zwanzig und auf dem Höhepunkt seiner sportlichen Leistungsfähigkeit. Als einer der ersten Spieler forderte er die Abspaltung der kosovarischen Klubs vom jugoslawischen Spielbetrieb. In der neuen kosovarischen Liga schoss Salihu am 13. September 1991 das erste Tor, 300 Zuschauer verfolgten das 2:3 Pristinas gegen Flamurtari. Doch Eigenständigkeit wurde von der serbischen Polizei streng beäugt, immer wieder erhielt Salihu Drohungen und wurde verhört. In seinem Buch „Kosovo Football: From Slavery to Freedom“ beschreibt der Sportjournalist Xhavit Kajtazi die Parallelstrukturen im kosovarischen Fußball in den 1990er Jahren, darunter geheim organisierte Turniere mit geschmuggelten Bällen aus dem Ausland. Ein Foto im Buch zeigt Spieler, die sich in einem Fluss waschen müssen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Machtspieler»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Machtspieler» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Machtspieler» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.