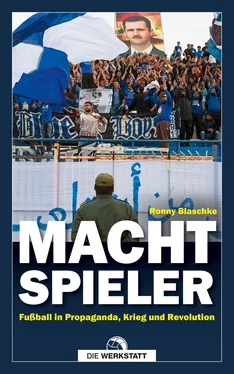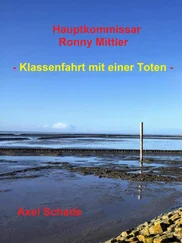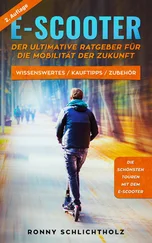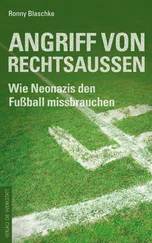1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Bald darauf trat die UÇK, die „Befreiungsarmee des Kosovo“, mit Anschlägen gegen serbische Ziele in Erscheinung. Hunderttausende Kosovaren verließen ihre Heimat. Eroll Salihu zog nach Deutschland, spielte für den Regionalligisten Wilhelmshaven und erlangte seinen Trainerschein. In den Nachrichten musste er verfolgen, wie die Spannungen 1998 in den Kosovokrieg mündeten, zwischen der serbisch dominierten jugoslawischen Armee und der UÇK. Der erste Nato-Kampfeinsatz überhaupt führte im Juni 1999 zum Rückzug der jugoslawischen Truppen. Mehr als 13.000 Menschen starben.
Innerhalb weniger Wochen nach dem Krieg kehrten achtzig Prozent der kosovarischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat. Auch Eroll Salihu, dessen Haus in Pristina zerstört worden war, wollte beim Wiederaufbau helfen. „Am Anfang war es sehr schwer, Strukturen im Fußball aufzubauen“, sagt er. „Wir waren international isoliert.“ Der kosovarischen Liga fehlten Sponsoren und Zuschauer. Das bereits 1993 gegründete Nationalteam fand selten Gegner für Testspiele. Und das sollte sich auch nach der Unabhängigkeitserklärung des Kosovo 2008 so bald nicht ändern. Bis heute erkennen 114 der 193 UN-Mitgliedsstaaten die Republik Kosovo an – für die serbische Regierung bleibt sie allerdings eine abtrünnige Provinz des eigenen Territoriums.
Mit einer Handvoll Mitarbeitern warb Eroll Salihu bei FIFA und UEFA für die Anerkennung des kosovarischen Fußballverbandes. Mit Unterstützung von westeuropäischen Nationalverbänden wie dem DFB ließ er Trainer und Schiedsrichter schulen. Ab 2014 gestattete die FIFA der kosovarischen Nationalmannschaft offizielle Freundschaftsspiele, jedoch ohne Landesflagge und Hymne. Die Premiere feierte das Team mit einem Heimspiel gegen Haiti in Mitrovica, im Norden des Landes. Viele Serben empfanden das als Provokation, denn die Stadt ist geteilt: Nördlich des Ibar-Flusses leben fast ausschließlich Serben. Das Stadion in Mitrovica war das landesweit einzige, das einen Minimalstandard erfüllte, benannt übrigens nach Adem Jashari, einem Mitgründer der UÇK. Für das Spiel wurde in der albanisch geprägten Südhälfte Mitrovicas der Unterricht ausgesetzt. Einige Fans verbrannten eine serbische Flagge. Noch heute sind in Mitrovica Nato-Soldaten stationiert, um Zusammenstöße der Volksgruppen zu verhindern.
Kosovo ist seit 2008 unabhängig, aber noch immer nicht Mitglied der Vereinten Nationen. Für eine Verankerung in der internationalen Gemeinschaft bemüht sich die Regierung um die Aufnahme in globale Organisationen. Kosovo ist Mitglied im Internationalen Währungsfonds, in der Weltbankgruppe oder in der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, nicht aber im Kulturverbund Unesco oder im polizeilichen Netzwerk Interpol. Als Durchbruch feierten die Kosovaren 2014 ihre Aufnahme in das Internationale Olympische Komitee IOC. Ihr Jubel war groß, als die Judoka Majlinda Kelmendi 2016 in Rio die erste Goldmedaille für den jungen Staat gewann. Noch größer war die Begeisterung im Mai 2016: Ihr Fußballverband trat als 55. Mitglied der UEFA und als 210. Mitglied der FIFA bei. Stolz zeigt Eroll Salihu in seinem Büro die gerahmten Aufnahmeurkunden, seine Briefwechsel mit den Verbänden füllen ganze Ordner: „Es gab kein Argument, uns so lange draußen zu halten. Aber jetzt wollen wir aus unserer Chance das Beste machen.“ Kerzengerade sitzt er auf seinem Stuhl.
Lange waren Salihu und seine Kollegen für den Aufbau ihres Nationalteams in europäischen Ligen unterwegs. Sie sprachen bei Spielern vor, deren Eltern den Kosovo während des Krieges verlassen hatten. Salihu erinnert an ein Länderspiel zwischen der Schweiz und Albanien 2012, neun der 22 Spieler hatten kosovarische Wurzeln, auf Schweizer Seite etwa Xherdan Shaqiri, inzwischen beim FC Liverpool unter Vertrag, und Granit Xhaka, FC Arsenal. Salihu wollte verhindern, dass sich weitere Spieler für die Auswahlteams ihrer zweiten Staatsbürgerschaft entscheiden. So wuchs der kosovarische Kreis potenzieller Nationalspieler auf 180 Profis an. Und die kosovarische Nationalmannschaft erarbeitete sich schnell einen guten Ruf: In der neuen Nations League der UEFA gewann sie ihre Gruppe in der Liga D ungeschlagen. Auch in der Qualifikation für die EM 2020 begeisterte sie gegen Bulgarien, Tschechien oder England. Auf den langen Auswärtsreisen waren manchmal mehr als 1500 Kosovaren dabei, trotz der hohen Hürden für ein Visum innerhalb Europas.
Fast zwei Jahre hatte die kosovarische Mannschaft Heimspiele in Shkodra bestreiten müssen, im Norden Albaniens. 2018 wurde in Pristina die Sanierung der neuen Heimstätte abgeschlossen, wenige Gehminuten von der Fußgängerzone entfernt. Ein funktionales Stadion, umgeben von einem wuchtigen Theaterbau und hippen Bars. Der kosovarische Fußballverband erhält pro Spiel mitunter 100.000 Ticketanfragen, vergeben kann er weniger als 14.000. Namensgeber des Stadions ist Fadil Vokrri, der langjährige Präsident des Fußballverbandes starb 2018. Vokrri hatte als einziger ethnischer Albaner für das jugoslawische Nationalteam gespielt. „Wir hatten viele gute Spieler“, sagt Eroll Salihu. „Aber auf der großen jugoslawischen Bühne hatten wir keine Chance. Eine klare Diskriminierung.“ Fadil Vokrri gehört durch seine frühere Zeit bei Partizan Belgrad zu den wenigen Kosovaren, die in Serbien hoch anerkannt sind.
Feindliche Drohne über dem Rasen
„Der Fußball schafft im Kosovo das, was die Politik nicht schafft: er gibt der Jugend ein bisschen Hoffnung“, sagt der Journalist Eraldin Fazliu von Birn. Das Balkan Investigative Reporting Network mit seinen 400 Mitarbeitern gehört zu den wenigen unabhängigen und kritischen Mediennetzwerken auf dem westlichen Balkan. Eraldin Fazliu erzählt, dass der sportliche Aufschwung der kosovarischen Auswahl viele Landsleute in ein Identitätsdilemma gestürzt habe. Er selbst war als Jugendlicher mit seiner Familie vor dem Krieg nach Dänemark geflohen. Fazliu liebte Fußball, doch mit dem jugoslawischen Nationalteam konnte er wenig anfangen: „In meiner Jugend hatte Kosovo keine Flagge und keine Hymne. Das Land war in einem traurigen Zustand. Aber wir sehnten uns nach Zugehörigkeit. Also unterstützten viele Freunde und ich das albanische Nationalteam. Die Zeit können wir heute nicht einfach wegwischen.“
Neunzig Prozent der Kosovaren sind ethnische Albaner. Für viele von ihnen zählt nur eine Nation, die albanische. Nach ihrem Verständnis dehnt sich diese Nation auch auf jene Staaten aus, in denen albanische Minderheiten leben: in Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Griechenland. Viele Ultras der kosovarischen Klubs hielten lange zum albanischen Nationalteam, doch mit dem Erfolg der kosovarischen Auswahl ist die Zahl albanischer Flaggen in ihren Fankurven zurückgegangen. Es gibt aber auch Ärger: Spieler wie Milot Rashica, Herolind Shala oder Alban Meha hatten bereits einige Spiele für Albanien bestritten, ehe sie zum neu geschaffenen Nationalteam des Kosovo wechselten. In albanischen Medien wurden sie auch als Verräter bezeichnet.
Lange interessierte man sich in Westeuropa wenig für albanisches Identitätsdenken, das änderte sich am 14. Oktober 2014 in der Qualifikation für die EM 2016 zwischen Serbien und Albanien. Vor dem Spiel warfen serbische Zuschauer Steine auf den Bus der albanischen Mannschaft, Proteste und Pfiffe übertönten ihre Nationalhymne. „Tötet die Albaner“, riefen serbische Fans, als in der 42. Minute eine Drohne mit einer Flagge über den Rasen flog. Darauf zu sehen: der Umriss von „Großalbanien“, wie es sich Nationalisten wünschen. Daneben die Abbilder der einstigen Führer Ismail Qemali und Isa Boletini, die 1912 die Unabhängigkeit Albaniens vom Osmanischen Reich durchgesetzt hatten. Auf dem Spielfeld griff sich der serbische Verteidiger Stefan Mitrović die Flagge, albanische Spieler stürmten auf ihn zu. Es kam zu Handgreiflichkeiten auf und neben dem Rasen, die Partie wurde abgebrochen.
Читать дальше