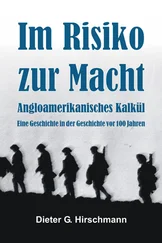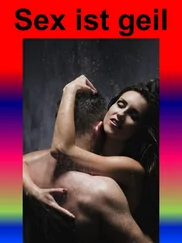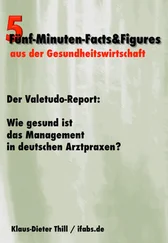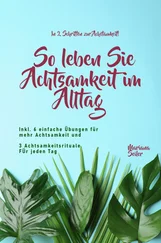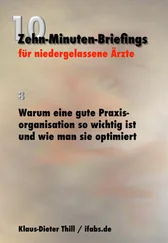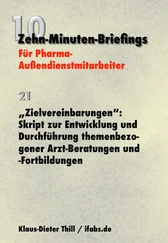Das Kennzeichnen von Waren mit einem Siegelzeichen war schon in der Jungsteinzeit üblich. Gesiegelt wurde auf feuchtem Ton. Damit hatte man auf Gefäßen oder Keilschrifttafeln sein Eigentum belegt. Damit war die eigentliche Idee, Ware mit einem Zeichen zu versehen, geboren. «Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt», heißt es schließlich im Philipperbrief des Apostels Paulus im Jahr 62/63 n. Chr. Damit spielte er auf die Echtheitsprüfung von Töpferqualitätsware an, die mit einem Siegel gekennzeichnet wurde.
In Chinas Song-Zeit (960–1368) war es üblich, Gemälde in roter Farbe mit einem Künstlersiegel zu signieren. Sammler drückten ihren Stücken Sammlungssiegel auf, die als Identifikation und Nachweis der Echtheit eines Werkes dienten.
Vom alten China zurück nach Deutschland: In Nürnberg – meiner Wahlheimat – agierte Albrecht Dürer in einer Zeit, als das Land noch an die Habsburger und anderweitig vergeben war. Dank seines Vermögens und der Erfindung Gutenbergs konnte er es sich leisten, seine Stiche in hohen Druckauflagen reproduzieren zu lassen.
Doch wie gegenwärtig galt auch früher: Gute Ideen werden gern imitiert. In Italien wurden Dürer-Drucke hemmungslos kopiert. Man kennt annähernd tausend gefälschte Platten und Druckstöcke und schätzt, dass eine halbe Million falscher Drucke in den Handel kamen. Damit hatte Dürer ein echtes Problem. Mit Einvernehmen des Kaisers wurden seine Initialen «AD» als erstes deutsches Markenzeichen geschützt, ein Modelabel seiner Zeit, das ab 1476 nicht mehr gefälscht werden durfte. Alle Originaldrucke wurden damit gekennzeichnet und die Italiener schließlich verklagt. Das ist Markenrecht in seiner ursprünglichen Form.
Die industrielle Revolution löste die Geburt des «modernen» Markenartikels aus. Bis dahin fertigten Manufakturen ihre Produkte per Hand in schwankender Qualität. Erst durch die maschinelle Serienproduktion konnte gleich bleibende Qualität verbürgt werden. Gleiche Güte über mehr als einhundert Jahre – denken Sie an Maggi, Lindt, Nivea. Die Dampfmaschine gab 1712 den Startschuss!
Durch die serielle, industrielle Massenfertigung war es auch nicht mehr möglich, wie vom Handwerk her gewohnt auf individuelle Wünsche einzugehen. Man war gezwungen, ein und dasselbe Produkt an eine große Anzahl von Kunden zu verkaufen. Damit bekamen die neu aufkommenden Marken die Aufgabe zugewiesen, die benötigte Anzahl an Kunden anzuziehen.
Zwei schwarze Schwerter mit geschwungenem Griff kreuzen sich: die älteste Bildmarke Deutschlands. Die Porzellanmanufaktur Meißen meldete sie am 20. Mai 1875 als Bildmarke an. Genau in dem Jahr trat das erste Markenschutzgesetz in Deutschland in Kraft. Zwanzig Jahre später (!) – da soll heute noch einer über langsame Behörden klagen – wurde die Schutzmarke für Porzellanprodukte aller Art in das Register aufgenommen.
Ende der Dreißigerjahre hatte Hans Domizlaff in seinem Lehrbuch «Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens» das Wesentliche über Markentechnik zusammengefasst. Alle seriösen Markenbücher bauen auf diesen Grundgesetzen auf. Das gilt für Autoren wie Aaker, Deichsel, Esch, Olins oder Schmidt. Raritäten.
Trendmärchen, Designhöhenrausch oder Zielgruppenfabeln mit Wow-Wow-Effekt sind die Kehrseite. «Mythos Marke», «Das Geheimnis der Marke», «Before Branding», «Beyond Branding» ... – Thesenhaufen ohne praktische Anleitung.
Wissen ist nur von Nutzen, wenn es weitergegeben wird, und ist nur wertvoll, wenn es angewendet, weiterentwickelt und verfeinert werden kann.
Wem nützen Träume zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Die Marke ist ein betriebswirtschaftliches Gut. Kein Spielfeld für Kreativität. Als Unternehmer hat man konkrete Bedürfnisse: Man fühlt sich dem Ertrag und dem Wachstum seines Unternehmens verpflichtet und ist auf dessen Entwicklung fokussiert. Man will Spitzenleistung auch spitzenmäßig verkaufen und gutes Geld damit verdienen. Kein ruinöser Kampf über den Preis, sondern Erfolg durch die Anziehungskraft hervorragender Leistungen, die auch so vermittelt werden. Haribo macht Kinder froh; Bauknecht weiß, was Frauen wünschen; Beck’s Bier löscht Männerdurst; Ricola – wer hats erfunden?; Red Bull verleiht Flügel. Menschen lieben starke Marken. Menschen brauchen starke Marken.
Meine Überzeugung:
Anziehungskräftige Marken sind die beste Waffe, um im Zeitalter von Globalisierung und gesättigten Märkten zu bestehen.
Zu welcher Erkenntnis gelangen Sie?
1. Stufe zur attraktiven Marke:
Je höher die Dichte, desto stärker die Massenanziehung
In seiner fünften Arbeit «Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energiegehalt abhängig?» schrieb Albert Einstein seine berühmte Formel E = mc2 nieder.
Einsteins Frage verführt uns zu unserer Marketingfrage: Ist die Trägheit einer Marke von ihren Leistungen abhängig? Um das herauszufinden, fragte ich mich zunächst: Was genau tun eigentlich Physiker? Sie machen das, was alle Naturwissenschaftler machen: sie messen: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kraft ... Meist lässt sich alles auf Länge, Zeit, Masse und Dichte zurückführen.
Einstein hat die Begriffe verändert. Das widersprach den bisherigen Auffassungen. Vorher klang alles nachvollziehbar, zum Beispiel Newtons drittes Bewegungsgesetz: Für jede Kraft gibt es eine gleich große und entgegengesetzte Kraft. Das kennen wir vom Billardtisch oder von Impulskugeln.
Einstein drang tiefer ins Universum vor. Er hat mit den strengen Regeln der Logik und Mathematik Dinge nachgewiesen, die man weder sehen noch sich leicht vorstellen kann.
Auch meine Art der Markenbildung baut auf Logik jenseits aller Mythen auf. Markenstrategen sind verpflichtet, ihrem Denken strikte Disziplin aufzuerlegen.
Wie Länge und Zeit unterliegt Masse einer Veränderung. Ein Meteor fliegt so lange mit gleich bleibender Geschwindigkeit durch das luftleere Weltall, bis er auf einen Gegenstand oder eine Kraft trifft. Das gilt für den Fußball ebenso wie für den Tischtennisball. Es scheint, dass für die Kraft des Meteors mehr Widerstand aufgebracht werden muss als für einen Ball. Der Himmelskörper wird größeren Widerstand leisten.
Auf der Erde gilt die gleiche Situation: Ein Rennboot ist leichter in Bewegung zu setzen und kann seinen Kurs schneller ändern als ein Ozeandampfer. Ein kleiner, flexibler Unternehmer kann schneller reagieren als die träge Organisation eines Multikonzerns.
Allgemein bezeichnet man den Widerstand eines Objekts gegen eine Kraft mit Trägheit. Je mehr Atome in einem Gegenstand sind, desto größer die Masse. Je mehr Organisationseinheiten ein Unternehmen bilden, desto massiger ist es. Doch Vorsicht: Masse wird vielfach mit Gewicht verwechselt. Ein Unternehmen mit großer Masse muss noch lange kein gewichtiges Unternehmen am Markt sein. Denken Sie nur an die Bundesagentur für Arbeit (BA), in Deutschland größter Dienstleister am Arbeitsmarkt. Die Zentrale in Nürnberg, zehn Regionaldirektionen, 180 Agenturen und rund 660 Geschäftsstellen mit etwa 90 000 Mitarbeitern – ist Größe gleich Stärke?
Das Gesetz starker Marken hat mehr mit Dichte zu tun. In der Physik versteht man darunter das Verhältnis von Masse und Volumen (d = m/V). Je höher die Dichte, desto stärker die Massenanziehung. In der Markenphysik bedeutet das: Attraktivität entsteht durch eine hohe Dichte im Markensystem. Überflüssige Informationen müssen ausgefiltert und der Rest mit einem Kompressor verdichtet werden.
Wie in der Philosophie und Psychologie stehen auch in der Physik Objekte miteinander in Wechselbeziehung. Sie beeinflussen sich gegenseitig durch zwischen ihnen wirkende Kräfte. Diese Tatsache wird von den meisten Markenstrategen übersehen.
In der Natur sind fundamentale Arten von Wechselbeziehungen bekannt – wie die Anziehung durch Gravitation oder Magnetismus. Sie unterscheiden sich durch ihre Reichweite, ihre Stärke und die Fähigkeit, eine bestimmte Anzahl von Teilchen zu verändern. Begriffe, die einem in der Werbung begegnen: Reichweite erhöhen, Zielgruppen beeinflussen, Images verändern ...
Читать дальше