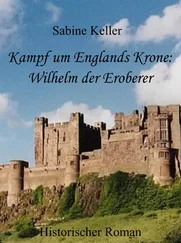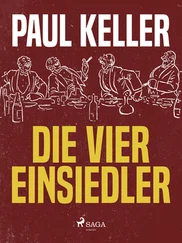Er nahm einen Schluck aus der Reiseflasche und fuhr fort:
„Und Heimat — ist Heimat gar nichts mehr? Irgendein Tand, den man leichten Herzens aufgibt? Sehen Sie, Juro, Ihre Wendenheimat ist schön! Nicht lauter Kernboden — nein, viel Sand und auch Moor dazwischen. Aber doch gutes, treues Land, auf das man sich immer noch verlassen kann. Ja, und ich — ich bin ja eigentlich ein Fremder dort zu Lande. Na, schütteln Sie nich den Kopp! Ich bin ein deutscher Rittermässiger, der sich im Wendenland sein Gut gekauft hat. Ja, ich kann mich nicht beschweren, die Wenden sind gute Leute. Saufen ja ’n bissel — das tun wir auch, — sind auch sonst nicht gerade grosse Säulenheilige — das sind wir auch nicht, — aber sind fleissige Arbeiter und ehrliche Leute. Juro, ich bin ein Deutscher, aber ich möcht’ aus dem Wendenland nicht raus; es is mir zur Heimat geworden, wenn ich mir auch jetzt noch mit jedem wendischen Wort die Zunge verrenke. Und Sie — Sie sind doch ein geborener Wende!“
Juro liess den Kopf sinken und zupfte mit den Fingern an dem kurzen Grase. Der Wind spielte leicht mit seinen schlichten blonden Haaren, und eine tiefe Röte bedeckte seine Wangen. So sprach er:
„Ach, Herr von Withold, Sie wissen nicht, woran Sie da rühren. Das sind ja die Kämpfe, die ich seit vielen Jahren führe mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit mir selbst, auch mit meinem Bruder Samo. Dass ich für die Landwirtschaft kein Talent und kein Interesse habe, ist ja von meiner Nationalität ganz unabhängig und hat damit gar nichts zu tun. Ich studiere ja auch in der Hauptsache Medizin und höre nur nebenbei einige landwirtschaftliche Vorlesungen. Was mich grämt, ist aber, dass sie mich zu Hause alle als einen Abtrünnigen ansehen, als einen, der sein Wendentum verrät und ein Deutscher wurde.“
Der junge Mann stand auf. Eine grosse Erregung überkam ihn.
„Ich will’s ja nicht leugnen, ich bin ein Deutscher in meinem Herzen. Aber ich wehre mich dagegen, dass ich das Wendentum verraten haben soll. Was sind die Wenden noch? Ein winziges Häuflein, eingesprengt ins grosse deutsche Volk. Und wie ist ihnen zu helfen? Dadurch, dass sie sich feindselig und eigensinnig absperren? Dann müssen sie verhungern, vor allen Dingen auch geistig verhungern. Wir haben keine grosse Nationalliteratur, keine nationale Kunst, keine nationale Wissenschaft, keine grosse nationale Schulen, nicht einmal nationale Geschäftsbetriebe. Auf unseren Walddörfern sitzen wir in Armut, und wenn einer hinauskommt und nichts kann als seine wendische Sprache, die niemand versteht, dann wird er ein Helot, und das ganze Volk wird ein Helotenvolk werden. Das will ich nicht, dagegen wehr’ ich mich, eben weil ich die Meinigen liebe, und darum müssen wir, die selbst zu schwach sind, uns an ein stärkeres und reicheres Volk anschliessen, müssen wir eine Sprache haben, die ins weite Land klingt und auf vielen Märkten und in vielen Hörsälen verstanden wird.“
Er hielt inne und blickte hinunter ins tiefe Elbtal, das den preussischen und den böhmischen Kamm des Riesengebirges trennt. Steil fallen die Felsenwände des böhmischen Korkonosch hinab zum Fluss. Juros Blicke schweiften hinüber zum böhmischen Land. Und er sprach das, was in seinem jungen Grüblerherzen sich in vielen einsamen Stunden gebildet und immer wiederholt hatte, was er wie sein eigenes Evangelium auswendig konnte:
„Anschluss an ein glücklicheres Volk, als wir sind, denen das Schicksal durch alle Jahrhunderte die Grösse und Selbstherrlichkeit versagt hat! Kapitulation in Ehren! Aussöhnung mit gegebenen Notwendigkeiten, Aussöhnung, die uns nicht schändet, die uns vorwärts führt. Heimatsuchen in weitem Gefild, Heimatsuchen, das meinen stillen, gutmütigen Brüdern und Schwestern nicht schwer fallen wird. Aber nicht dort drüben, nicht bei den Tschechen, die unsere Vettern heissen, die viel glücklicher waren als wir, in viel reicherem Lande wohnen und die doch trotz aller Grossmannssucht den Weg zu einer hohen Staffel der Menschheit nicht fanden. Wir wollen Deutsche sein, im Deutschtum vorwärts kommen und ehrlich mithelfen, das, was uns am Deutschtum nicht gefallen kann, zu ändern und zu bessern.“
Der alte Withold reichte Juro gerührt die Hand, und der Mund des jungen, leidenschaftlich erregten Wenden zuckte.
Im Silberlicht des Mondes spielte die junge Elbe auf der Bergwiese. Und sie plauderte harmlos wie alle Bächlein, die mit Gräsern spielen und mit lachendem Glick-Glack und Hopp-Schlock über wichtigtuende Hölzchen wegsetzen, die sich ihnen neckend in den Weg legen. Das spielende Königskind, das zu Grossem berufen ist, zur Beherrscherin weiter Lande und mächtiger Städte, tändelt hier in seiner Jugendheimat, lacht, tanzt und plaudert wie ein armes Wiesenwässerchen, das im nächsten Dorfteich mündet.
Aber eine ungestörte Jugend haben Königskinder nicht. Alte Leute, die von ihrer grossen Mission wissen, nehmen sie von Zeit zu Zeit vom Spielplatz weg, bekleiden sie mit Grösse und Würde, mit Brokatgewändern und goldenen Kronen, trichtern ihnen ein trutzig und altklug Sprüchlein ein und stellen sie so dem Volk zur Schau.
„Seht da, das Königskind! Seht die Würde und Grösse, die in ihm ruht!“
Also geschieht es auch mit der jungen Elbe. Ihre Wässerchen werden in einem grossen Wasserbehälter aufgefangen, der dicht an einem felsigen Abgrund liegt, und wenn der ganze Behälter voll ist und wenn genug Volk da ist, das geneigt ist, feinen Tribut zu entrichten, dann zieht der Wärter, der Gouverneur des jungen Königskindes, eine Schleuse, und das Kind, das eben noch silbern lachte, spricht plötzlich mit donnernden Herrscherworten, entrollt seinen tausendfältigen Demantmantel, steigt mit Riesenschritten hinab ins Tal.
Freilich, es ist nur ein höfisches Theater, es ist nur, um dem Volk ein Schaustück zu stellen. Kaum ist das Königskind im Tal angelangt, so zieht es den wallenden Demantmantel wieder aus, hört auf, seinen eingelernten Donnerspruch zu sagen, und spielt und tändelt wieder wie andere Kinder. — —
Einsam lag die Gebirgsbaude an der Felsschlucht, wo der alte Wärter am Wasserbassin lehnte und wartete, ob er um ein Stücklein Trinkgeld den „Elbfall“ noch einmal „ziehen“ können würde. In der Baude sassen Gäste, lachten bei böhmischem Wein. Ein Fiedler spielte, sein Weib schlug die Guitarre. Sie sangen „Gott erhalte Franz den Kaiser“ und „Heil dir im Siegerkranz“.
Die drei Künstlermenschen, das Geschwisterpaar Withold und der junge Wende Juro, wanderten draussen durch den lichten Abend, sahen den Himmelskuss des Sternenlichts auf den Stirnen der Berge, sahen das tiefe dunkle Elbtal hinab einen weissen Nebelschwaden fahren, der war wie ein silberner Kahn auf dunklem Strom. Als die drei zu einem schmalen, steinigen Fusssteig kamen, der in die Elbschlucht führt, sagte Heinrich zu Juro und Elisabeth:
„Steigt ein Stücklein da hinab. Ich gehe hinüber zum Wärter, er muss den Fall noch einmal ablassen. Das wird schön aussehen jetzt im Mondschein.“
Da standen Juro und Elisabeth erst zögernd still, dann gingen sie beklommen den dunklen, schmalen Felsenweg hinab. Sie waren jung. Sie waren Träumer. Sie liebten sich, und ihre Seelen waren unverdorben. Da war die herzschlagende Scheu in ihnen, die bange Furcht und doch auch die schmerzliche Sehnsucht: jetzt in dieser lichten Abendstunde möge die Zeit gekommen sein, wo das goldene Tor zum Allerheiligsten ihrer Seele aufspringen und sich das Wunder offenbaren würde, das wohlgehütet da wohnte — ihre Liebe.
Langsam stiegen sie den holprigen Pfad hinab, und wenn der Mann dem Mädchen die Hand reichte, dann glühten die Hände ineinander wie im Fieberfeuer oder sie trafen sich kalt wie in Schreck und Angst.
Als sie endlich stehenblieben, war ein Baumstamm zwischen ihnen, aber sie fühlten ihre Nähe, und es war, als ob tausend weiche Wunderfäden sich um sie und den Stamm rankten und sie in weltferne Wonnen einspännen. Ein Nachtvogel huschte vor ihnen auf; sonst war alles in tiefer, feierlicher Ruhe.
Читать дальше