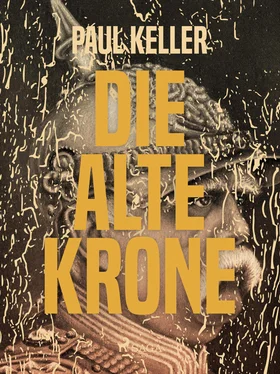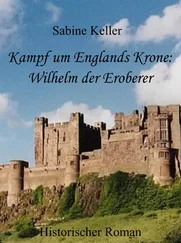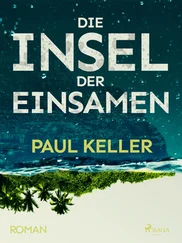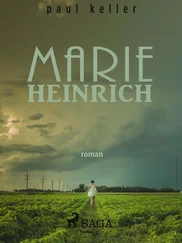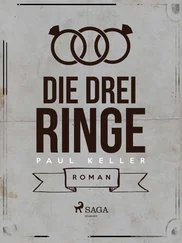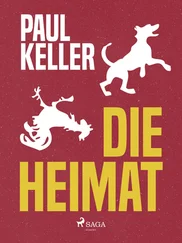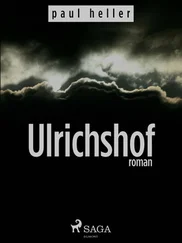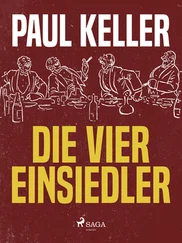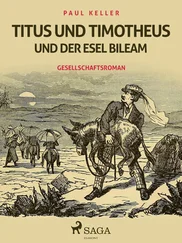„Geh nicht! Die Smjertniza geht um! Geh nicht! Es ist nicht nötig! Ich gehe mit Kito zum Friedhof. Wir holen heiliges Gras von einem Kindergrab. Da räuchern wir die Frau an, und sie wird gesund werden.“
Sie streckte ihm, alle Scheu vergessend, beide Hände hin, er aber wehrte sie unwirsch ab und sagte:
„Du bist auch so eine Gans!“
Ging über den Hof und schwang sich über die Mauer.
Die weiten Matten des Riesengebirges sind dort am breitesten und schönsten, wo der grosse deutsche Elbestrom seine Quellen hat. Runde dichte Knieholzgebüsche sind über den kurzen Rasen verstreut wie dunkelgrüne Kränze.
Ein leichter milder Abendwind ging über die sich weit hindehnende Elbwiese und erquickte einige Wandersleute, die vom Gipfel des Hohen Rades herkommend, sich am Boden lagerten.
„Kolossale Fläche,“ sagte ein stattlicher Fünfziger und liess die fröhlichen, stahlgrauen Augen rundum schweifen. „Grandiose Fläche! Und das liegt nun alles hier oben 4000 Fuss hoch und hat keenen Zweck.“
„Aber, Papa, das ist doch so schön!“ entgegnete ihm seine schlanke Tochter; „sieh mal, wie sich diese weiten Wiesen hindehnen und eine so friedliche schöne Brücke sind zwischen den zwei grossen Gebirgskämmen —“
„Jawohl,“ unterbrach sie der Alte sarkastisch und mit imitiert flötender Stimme. „Diese epische, ruhige Breite, nur hin und wieder unterbrochen durch die Lyrismen winziger märchenhafter Knieholzwälder, deren Baumstämmchen nur so gross sind wie die Kinder und so verträumt sind wie die Kinder.“
„Papa!“
„Tja! Herrschaften, denken Sie nu ja nicht etwa, die Stelle von der epischen Wiese und von den lyrischen Kniehölzern is von mir. Keene Spur! Hier steht sie, die diese Stelle gedichtet hat — meine Tochter Elisabeth von Withold. Es hört sich grossartig an, sowas. Man kann sich zwar nischt dabei denken, aber es klingt nach was!“
„Papa, du hast —“
„Ich habe jar nischt. Dein Papa „hat“ nie! Nämlich spioniert! Er hat sich lediglich erlaubt, direkt auf dem Wege ein Notizblatt zu finden, das seine poetische Tochter verloren hatte und das er hiermit submissest zurückerstattet, weil er keine Verwendung dafür hat.“
„Gnädiges Fräulein, die Stelle von der epischen Ruhe dieser grossen hohen Wiesenflächen und ihrer lyrischen Unterbrechung durch die kleinen Büsche mit ihren bizarren Zwergstämmchen und wunderlichen Kronen ist herrlich. Bitte, schenken Sie mir das Blatt!“
Der das sprach, war ein junger, schlanker Mann. Der Alte lachte fröhlich.
„Bravo, Herr Juro, bravo! Man hört ihnen gleich an, dass Sie Ackerbau studieren und künftiger Scholta und Grossbauer im Wendenland sind. Jawohl, das ist unsere moderne Landwirtschaft! Der Landwirt stellt sich an die Wiese und phantasiert von epischer Ruhe und lyrischer Unterbrechung, und die Ochsen zu Hause verhungern und die Wirtschaft geht sachte zum Deibel.“
„Lieber Vater —“
„Lieber Sohn?! Sei du man stille! Denn du bist erst der rechte!“
Heinrich von Withold, ein zweiter junger Mann, nickte seinem Vater gemütlich zu und pfiff eine kurze musikalische Sentenz.
„Pfeif nur, Bürschel, pfeif nur! War wohl wieder von dem verrückten Kerl, von dem Wagner? Ich sage — einmal und nicht wieder!“
Niemand fragte, was er meine. Alle wussten, er meine, einmal habe er eine der neuen Wagnerschen Opern angehört und tue das nie wieder.
„Auf keinen Fall!“ fuhr Herr Withold zornig beteuernd fort. „Jetzt, — was soll ich machen, dass der Junge, der Heinrich da, sich viel mehr mit musikalischen Faxen abgibt, als dass er Volkswirtschaft und Agrikultur studiert, wofür ich ihn, Himmeldonnerwetter, nach Breslau zur Universität geschickt habe?! Was soll ich machen?“
„Ach, wir können die Kinder nach unserm Sinne nicht formen,
So wie Gott sie uns gab, muss man sie halten und lieben,“
entgegnete Heinrich, der Jüngling. „Siehst du, Papa, diese Verse sind auch dichterisch, zwar nicht von meiner Schwester Elisabeth, aber von Goethe, von Johann Wolfgang von Goethe.“
„Affe!“ sagte der Alte. (Er meinte seinen Sohn Heinrich, nicht Goethe). „Affe!“ wiederholte er, „ihr habt Glück, dass ihr so einen schafsgutmütigen Vater habt, sonst Donnerschlag ja —! Ich amüsier’ mich schon immer, wenn ich so’ne Visitenkarte von einem Studenten sehe: „stud. med.“, „stud. iur.“, „stud. phil.“, „stud. agric.“ und was da alles draufsteht. — Da sag’ ich mir immer, das erste „stud.“, das is das, was der Kerl im allgemeinen nicht macht, und das, was dahinter kommt, das is das, wovon er sich ganz besonders drückt. Herr Gott, dahier stehen zwei Studenten, cives academiae, wie es so stolz heisst — Herr Juro und Herr Heinrich, mein vielbegabter Herr Sohn; beide sollen in Breslau Agrikultur studieren, beide sollen ja einmal grosse Güter übernehmen. Gut! Kommen wir also hier an diese kolossalen Bergwiesen. Müsste man denken, — halt, — Studenten des Ackerbaues — halt! — was werden die machen? Werden sich gewiss hinstellen und sagen: Bis zu dem Gebüsch da soundsoviel Huben, bis zur Baude soundsoviel Huben und so weiter. Und dann: Verflixt ja, wenn ich diese Prachtwiesen unten im Gelände hätte — das Kroppzeug von Knieholz rodete ich aus — Klee? — Ruchgras? — Luzerne? — Zum mindesten Buchweizen? — Wollen mal sehen! — Aber die Wiesen liegen nu mal hier oben. 4000 Fuss hoch. Nichts zu machen mit Talbepflanzung. Aber mit Almenwirtschaft, zum Donnerwetter, mit rationeller Almenwirtschaft! Schande und schade um so herrliche Flur! Jawohl, so müsste man denken, würden zwei Studenten sagen, die Ackerbau studieren. Ach, du oller Döskopp! Einer spricht von epischer Breite und lyrischer Unterbrechung und einer pfeift ’ne Melodie, nach der nicht mal sein letzter Pferdeknecht tanzen mag.“
„Herr von Withold, Sie haben ganz recht. Was mich angeht, so befinde ich mich sicher an ganz falschem Platze. Ich habe eben für die Landwirtschaft nicht das mindeste Talent.“
„Na, Juro, so schlimm wird ja das nun nicht sein. Hauptsache, Sie geben sich Mühe. Seh’n Sie mal, das schöne Gut wartet doch auf Sie! Ein Rittergut können Sie aus der alten wendischen Scholtisei machen, wenn Sie’s vernünftig anstellen. Ihr Grossvater und ihr Vater haben ja kolossal zugekauft. Wie gross ist denn ihr Väterliches jetzt?“
„Ich weiss es nicht,“ sagte Juro achselzuckend.
„Sie — Sie wissen das nicht? Ja, erlauben Sie mal, das — das ist arg! Studiert Ackerbau und weiss nicht mal, wie gross das väterliche Gut ist. — Das ist ja unglaublich! Als ich so alt war wie Sie, kannte ich auf unserem Gute sozusagen jedes Rind, jedes Schaf, jeden Hahn persönlich mit seiner ganzen Lebens- und Familiengeschichte. Und Sie wissen nicht mal — ja, dann ist’s allerdings am besten, Sie hängen die Geschichte an den Nagel.“
„Ich möchte wohl, wenn ich es könnte.“
„Aber Mensch, Christ, Bürger, Sie haben doch Traditionen zu erfüllen! Sie können doch nicht mir nichts dir nichts eine so wunderbare Sache fahren lassen. Donnerwetter, bei Ihnen ist ja von Bauernwirtschaft gar keine Rede mehr, das ist doch ein grosses Gut! Ja, Mensch, wollten Sie denn lieber ein ärmlicher Stubenhocker sein als über eigenen Grund und Boden schreiten als freier Mann, dem niemand auch nur ein Wörtlein zu sagen hat, der lebt wie ein König?“
„Wie ein König der Wenden!“
„Red’ mir nicht hinein, Heinrich! König der Wenden, das gibt’s nich! Das is eine von den vielen alten Sagen, die die Wenden haben. Unsere Wenden sind gute Preussen, haben ihren König in Berlin, wie andere Preussen, ihren Bramborski Kral. Aber ein König in seiner Art ist jeder freie Landwirt und nur er, alle anderen bis zum Minister und General hinauf sind abhängige Diener.“
Читать дальше