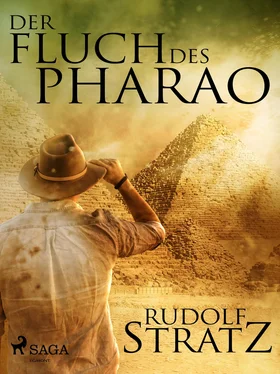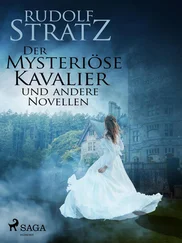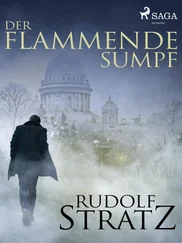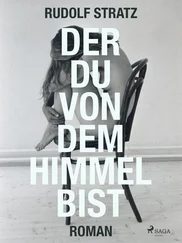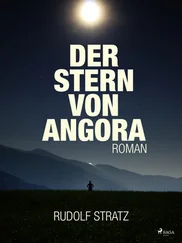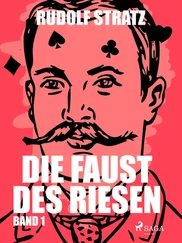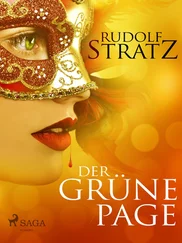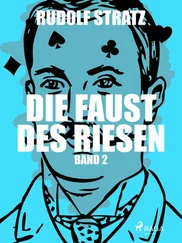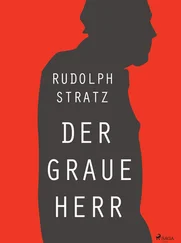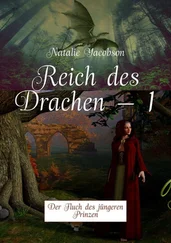Die Unterwelt. Die eigentliche Welt.
Denn nach der düsteren altägyptischen Glaubenslehre ist das Menschenleben nur ein flüssiges Flackerpünktchen zwischen zwei schwarzen Unendlichkeiten. Das Erdendasein ist nur ein kurzer Traum. Man erwacht aus ihm im Sterben. Der Tod ist die Wirklichkeit. Darum heissen in den Rätselstellen der Hieroglyphen die Verstorbenen „die Lebenden“, die Häuser „Herbergen auf der Wanderschaft“, die Gräber „Ewige Wohnungen“, die Särge „Schreine des ewigen Lebens“.
Jenseits des breiten fruchtbaren Überschwemmungsgeländes des linken Flussufers lag damals und liegt heute noch in furchtbarer Einsamkeit einer wildzerklüfteten, baum- und strauchlosen, viele Hunderte von Fuss hohen Berg- und Steinwildnis die Totenstadt Theben. Nicht nur die Pharaonen fanden da ihr neues Heim. Sie hatten nur ihr eigenes „Tal der Könige“ oder eigentlich zwei in den Felsschlünden sich gabelnde, schauerlich öde Wüstenschluchten. Ziemlich entfernt davon besitzen die Königinnen ihr eigenes Schattenreich. Überall im Umkreis gähnen aus gelbem Gestein die schwarzen Pforten zu den in den Felsen gehauenen Gräbern: Massengrüfte thebanischer Priesterfamilien, Friedhöfe der hohen ägyptischen Bürokratie, Grabkammern ehrbarer Bürger, von Bestattungsgesellschaften angelegte Massenkatakomben, mit Reihenstätten rechts und links des Bergtunnels für die weniger bemittelten Mumien. Dazwischen Kapellen, zerfallene Mauern, in den Tälern und in die Ebene hinausgebaute riesige Tempel — das war Theben. Das ist heute noch Theben. Denn seine Totenkammern haben viele Jahrtausende der Lebenden, der Völker Kommen und Gehen, die Schicksale der Weltteile, Kriege, Thronkämpfe, Entdeckungen — alle die Nichtigkeiten des Erdendaseins überdauert.
Die Toten von Theben und ihre Könige.
Konnte man die Königskatakomben, die unermessliche Schätze bargen, in weltverlorener Einsamkeit vor den Hyänen der Grüfte bewahren? Man vermochte es, solange der Staat stark genug war, sie mit seinen Polizeimitteln zu schützen. In der Blüte des Pharaonenreichs war die Totenstadt links des Nils auch von vielen Tausenden von Lebenden bewohnt — von Priestern, Wandmalern, Friedhofbeamten, Aufsehern, Einbalsamierern, Steinmetzen — allem, was zum Betrieb des ungeheuren Bergfriedhofs gehörte.
Aber dann verödete im Verfall des Reiches das lebende Theben, die Hauptstadt am anderen Ufer des Nils, an deren Stelle heute nur noch, mit Ausnahme der Tempel, armselige Dörfer und Weiler stehen. Nur noch die Schatzale winselten nächtens drüben im Tal der Könige! Unbehütet standen die viereckigen, schmalen, vermauerten Pforten, von denen aus Treppenstufen und Gänge mit Seitenkammern und Zwischentoren tief in das Innere des Berges bis zur Mumiengruft führten. Wohl waren diese Tore mit Baststricken versiegelt. Aber was half das gegen Gottlose und Gierige in stundenweiter Wildnis?
So sind diese sechzig und mehr Grüfte im Tal der Könige, in denen an die dreissig Pharaonen ihre ewige Ruhe zu finden wähnten, grösstenteils schon zur Zeit der alten Ägypter selbst erbrochen und ausgeraubt worden. In Theben bestand bereits um das Jahr 1000 vor Christus eine organisierte Gangstergesellschaft, deren sich Chicago nicht zu schämen brauchte, zur Ausplünderung der Königsgrüfte unter Führung des Oberpriesters, zweier Stadtmeister und dreier königlicher Räte. Ganze Bündel von Königsmumien wurden, da man keinen andern Rat mehr wusste, von Getreuen in Felsspalten vor den Grabräubern versteckt und schliesslich doch nach vielen Jahrhunderten 1875 von Fellachen aufgestöbert, denen man sechs Jahre später ihren Raub abnahm. So liegt jetzt der einstige Herr der Welt, Ramses der Grosse, der siebenundsechzig Jahre über Ägypten geherrscht hat, als schwärzliches Bündel im Schaukasten des Salon Septentrional, des grossen Nordsaals, als Nr. 3874 unter Glas und Rahmen im Ägyptischen Museum zu Kairo. Neben ihm drei weitere numerierte Pharaonen, viele einstige Prinzessinnen und Grosse. Man verarge mir meinen Freimut nicht — aber ich habe manchmal den Eindruck, als ob es unserer Zeit ein ganz klein wenig an Feingefühl mangelt.
Was im Tal der Könige zu stehlen war, das wurde fast restlos im Lauf der Zeiten gestohlen. Der Grieche Strabo kannte schon vierzig geöffnete Königsgräber. Die Schlussarbeit besorgte dann der Islam bis gegen das Ende der Kreuzzüge hin. Es schienen von da ab alle die Totenkammern der Herrscher von Räuberfüssen entweiht, von Räuberfäusten kahl ausgebeutelt zu sein.
Von da ab schwieg das Tal der Toten und gab seine Geheimnisse nicht mehr preis. Seit Menschengedenken hatte man keine neue Königsgruft mehr aufgefunden, geschweige denn betreten.
Bis um die Jahrhundertwende Lord Carnavon kam, erst seiner Gesundheit wegen, dann unter dem Zauber des ewigen Nils. Isis und Osiris nahmen den steinreichen Peer von Grossbritannien an der Hand und geleiteten ihn in ihre geheimnisvolle Welt.
Lord Carnavon begann zu graben. Durch Jahrzehnte haben er und Mr. Howard Carter, ein britischer Ägyptologe, samt einem Stab von Mitarbeitern und Scharen von Fellachen das Totental der Pharaonen mit der Geschäftigkeit des zwanzigsten Jahrhunderts erfüllt.
Wenn man in diesem Gespenstertal zwischen niederen, senkrechten Felsmauern wie in einem Kanalschacht durch die trostlose, gelb glühende Bergwildnis reitet und sich nach links wendet, so gab es da eine Stelle, wo hohes Steingeröll aus einem dereinst in halber Berghöhe ausgeschachteten Grab die Talsohle füllte. Die braunen Werkleute der Pharaonenzeit hatten die Massen der Felsbrocken einfach da hinuntergeworfen, ohne sich viel darum zu kümmern, ob sie mit ihnen nicht vielleicht einen schon vorhandenen, tiefer gelegenen Grufteingang für immer verschütteten.
An dieser Stelle, im Tal der Toten, scharrte und schürfte der Gelehrte. Carter unermüdlich sechs Winter hindurch mit seinen Fellachen und war schliesslich doch schon nahe daran, das Rennen aufzugeben. Da stiess am 4. November 1922 der Spaten eines Arbeiters auf eine in den Fels gemeisselte Steinstufe: das Grab des Pharao Tutanchamen war entdeckt. Die Welt hallte davon wider.
Tutanchamen war dabei durchaus keiner der grossen Pharaonen. Er sass nur etwa sechs Jahre auf dem Thron. Er starb, kaum achtzehnjährig, wahrscheinlich eines gewaltsamen Endes. Die allmächtigen Hohenpriester hatten etwas gegen ihn — den Nachfolger des grossen Ketzerkönigs Amenophis.
Und doch: was hat man alles mit seiner Mumie dreifach im Tal der Könige eingemauert! Sein Sarg aus massivem Gold hat allein einen Wert von 300 000 Dollar. Eine goldene Maske deckt sein Angesicht. Die Augen sind aus Lapislazuli. Über und über vergoldete Thronsessel aus Ebenholz. Goldene Diademe und Halskragen, goldene Fingerringe, Sandalen, Fächer und Zepter. Elfenbeinkästen, Alabasterlampen, vergoldete Streitwagen und Pferdegeschirre, Stöcke aus Elfenbein, Truhen aus Zedernholz, Dolchknaufe aus Bergkristall, Skarabäen, Kinderstühle, Amulette, Leuchter, Vasen, Salbenbüchsen, Bogen, Götterfiguren. Die Sammlung umfasst jetzt im Museum von Bulak bei Kairo allein mehr als fünfzig Glasschränke.
Und nun tritt unheimlich das Schicksal in Erscheinung. Die Mumie Tutanchamens wehrt sich mit Mitteln über Menschenmacht gegen ihre Bezwinger des zwanzigsten Jahrhunderts.
Es heisst, dass schon 1914 der Forscher Theodor Davis an derselben Stelle ganz nahe dem grossen Fund gewesen, aber am selben Tag plötzlich gestorben sei. Jedenfalls waren Lord Carnavon und Carter die ersten, die am 26. November 1922 die Gruft öffneten. Nur langsam drang man im Lauf der Wochen durch die mit unermesslichen, nie geahnten Schätzen an Königsgerät gefüllten Räume vor. Dabei steckte der Earl von Carnavon, wie als Augenzeuge der amerikanische Altertumsforscher Tom Terris schildert, seine Hand in eine Alabastervase und zog sie mit einem kleinen blutigen Stich wieder heraus. Aus dem Krug summte, wie der Geist des toten Pharao, eine kleine grüngoldene Fliege. Lord Carnavon starb nach kurzem an Blutvergiftung.
Читать дальше