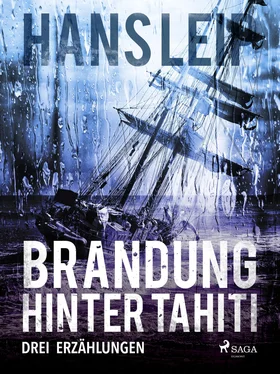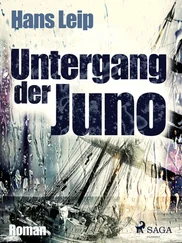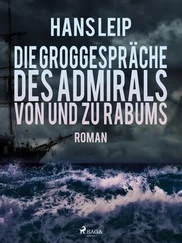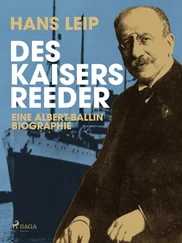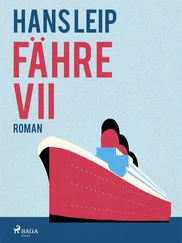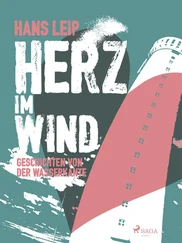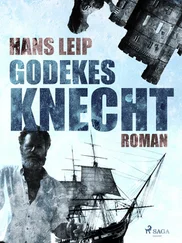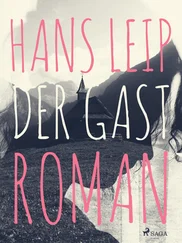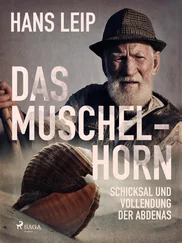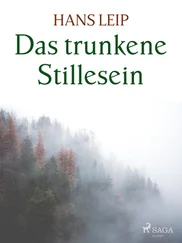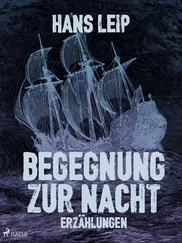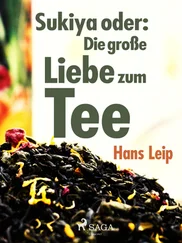Das anberaumte Liebesmahl für die scheidenden Offiziere hatte Herr Popham unterbunden: Die unruhige Truppe dürfe nicht ohne Aufsicht bleiben. Alas, und die Damen hatten sich schon auf Abschiedstanz, Zartheiten und Heldenverehrung gefreut. Manche vorgekühlte oder vorgewärmte Flasche würde ungetrunken in den Keller zurückwandern und manche Delikatesse den Eigenbedarf überfordern. Man mußte wie eh und je für alle Unvorhersehbarkeiten gewappnet bleiben.
Eine Locke und ein Plakat
Und schneidet es, warum du weinst,
dein armes Herz entzwei,
ade, leb wohl, es geht vorbei,
und einmal ist es wieder Mai
und fast so schön wie einst.
Parks, Strand und Straße wurden leer, die Neugierigen verschwanden, da es nichts mehr zu sehen gab. Das französische Orchester war in langen Stuhlwagen zur Stadt zurückbefördert worden; dort begann die Oper um sechs Uhr.
Im Saale des Hauses Parish fanden sich privat ein Kniebaß und eine Flöte zum Cembalo. Sie spielten unermüdlich die neuesten Anglaisen, Quadrillen und Walzer, auch mal ein Menuett für die älteren Herrschaften. Man hoffte immer noch auf die Offiziere, denen zu Ehren Bänder in hannöverschen und englischen Farben von den Wandleuchtern hingen. Auch wiesen zwei Transparente darauf hin, eins mit dem springenden Welfenroß, das andere mit einer phantastischen Inselgruppe in einem türkisblauen Meer, darauf »Antillen« geschrieben stand. Die Damen, in großer Überzahl gebeten, langweilten sich. Die paar Tänzer in Zivil mühten sich schwitzend, voran die beiden älteren Söhne des Hauses, John und Richard; aber die enttäuschte Sehnsucht nach den Uniformen, nach der Männlichkeit des Soldatischen, nach Adel und der Gewißheit, wie ein Stern lange Zeit aus der Nacht des Abschieds in eine tapfere, im Namen des Königs der unbekannten Fremde zueilenden Seele zu leuchten, machte die Gnädigen ungnädig. Als beim späten Essen die Gedecke endgültig zusammengerückt wurden, war die Stimmung lange vor dem Eisdessert auf den Gefrierpunkt gelangt. Die Unterhaltung erstarrte. Man hörte vom Strom die Soldaten »Ach, wie ist’s möglich dann –« singen.
Parish raffte sich auf; seine würdevolle Frau hatte ihm zugenickt. Dann war es immer Zeit, etwas zu reden und für die Stimmung zu tun. Er tat es auf deutsch, das er leidlich zu beherrschen meinte. »Gastfreiheit, lieben Gäste«, äußerte er, »ist ein zwiespältliches Unterfangen, dessen zu rühmen sich auch mein Freund, nennen wir ihn Lang-lebe-Er, den Ehrgeiz brennen ließ. Der Leumund seines gebildeten Geistes und guten Essens und Trinkens lief über in ganz Deutschland, England und so weiter, bei denen Gelehrten und schönen Künsten, wie wir es oft lobten. Im geheimen würden aber alle, die mit Erröten ihren Freitisch bezahlen, sollten sie, ohne daß ich dazu beitragen will, in Erfahrung bringen, wie sehr er betrieb unter seine Freunde, wozu auch ich die Ehre hatte, mich zu rechnen, die Einrichtung eines gesonderten eigenen Hauses für diese, die er Schulfüchse, Federfüchse, Bilderschmierer, Versefritzen und Singefinken zu bezeichnen vorging, sie darin abzufüttern, ohne daß sie einem ins Haus liefen. Nun, wenn ich mich dessen zu erinnern getraue, so sang dieses Lied, das uns durch die Fenster vom Transporte schallte, sehr hübsch die Schwiegertochter eines gewissen Herrn Forster, der nach England und zu dem alten ehrlichen Käptn Cook als Naturforscher mit ihm ging, was mich auf die Gastfreiheit meines verstorbenen Freundes L. brachte. Als Herr Forster aus England zurückkam, mußte er ein Souper erster Klasse bei ihm einnehmen und ging in Bezauberung von der ganzen Humanität nach Hause, denkend unter seiner Hand, dieser edle Gönner, geschätzt mit Wahrscheinlichkeit auf über eine Million, werde es genießen, ihn aus einer Verlegenheit zu ziehen. Ging also hin, morgens ins Kontor, und entwickelte sein Anliegen der Reise, sie fortzusetzen zur Heimat. Mein L. lachte ihm ins Gesicht. Er hatte nicht die Manieren eines Gentleman. Herr Forster antwortete: ›Mein Gott, Ihr Essen gestern muß das Doppelte gekostet sein, als womit Sie dringlichste Not im Augenblick von einer ehrlichen Familie wenden könnten.‹ Ein Argument, das mein L. sehr unverschämt erachtete und ihm die Hälfte schließlich anbot, welche Forster aber als Ehrenmann kaum genommen haben wird. Mein L. wollte mit berühmten Namen segeln und Prunk machen. Aber darüber weg gab es nichts als zue Knöpfe. Darum Prost, Prost, Prost die verehrlichen Gäste!«
»Ach der!« schmunzelte jemand nach dem Tusch und setzte das nicht sehr glücklich gewählte Thema fort: »Und um auf unser Militär zu kommen, der berühmte Baron Trenck war kaum in Hamburg angelangt, so erhielt er eine dringende Einladung, sich zu einem Prunkdiner einzufinden. Er nahm die Aufforderung an, schrieb aber dem Kaufmann zugleich, seine zuvorkommende Gefälligkeit gegen einen Unbekannten lasse ihn nicht daran zweifeln, daß jener ihm gegen Wechsel eine gewisse Summe vorstrekken werde. Der Kaufmann antwortete: Da er ihn nicht näher kenne, so fände er das Ansinnen sehr sonderbar. Und da ich Sie nicht, antwortete der rauhe Ungar, so hab’ ich den Teufel von Ihrer Fresserei!«
Diese drastische Wendung erntete ein sonderbar bitteres Beifallsgelächter. Die sonst so vornehme Madame Poel sagte zu ihrer Nachbarin (und sie hatte auf einen schneidigen Nachbarn gehofft): »Man braucht die schnodderige Antwort nur im ersten Teil zu ändern in: und da die Offiziere nicht kommen! – Das ist dann meine Ansicht.«
Früher, als man sich vorgenommen, ertönten die Rufe nach Johann, Friedrich oder wie die Kutscher hießen; die Türen der Kaleschen wurden heftig von innen zugezogen, und das Trinkgeld an die Dienstboten wurde vergessen. Was übrigblieb, setzte sich zum Kartenspiel.
Die Küchenmädchen, die sich auf die Leutnantsburschen gespitzt hatten, sangen schwermütig »Die Reise nach Jütland«. Man hörte es bis in den Salon.
Unten im Strom lagen still die fünf Schiffe. Die Ankerlaternen spiegelten sich wie lange goldene Taue, die am Ufer festgemacht schienen. Alle halbe Stunde klangen die Glasen der Schiffsglocke.
Emma Sanders hörte es erschauernd. Das schöne Seidentuch wärmte nicht viel. Sie saß noch da in dem von der Tagessonne durchwärmten Sand und starrte auf die erleuchteten Heckfenster der Juno , hinter deren einem sie eine endlose Reise lang gewohnt hatte, zumeist seekrank und verzweifelt, aber doch Wand an Wand mit Steuermann Mackay, von Indien her, um Afrika herum, die schreckliche Biskaya durch, den Ärmelkanal mit den Lichtern der Küsten, die Elbe herauf, nach Hause. Sie war eine Waise, von ihrem reichen Onkel, einem angesehenen hanseatischen Juwelier, erzogen, war früh, als der Gute zu zärtlich wurde, mit einer bekannten englischen Familie nach London gegangen, hatte sich eines Tages mit der Hausherrin überworfen und war voll Trotz und Abenteuerlust einer vagen Zeitungsanzeige nach gen Indien gefahren. Der dicke Nabob, der sich dort als ihr zukünftiger Gatte vorstellte, hatte ihr unfaßbares Entsetzen eingeflößt. Aber nachträglich war manches sonderbar gewesen. Sie war nach Rangun zurückgeirrt, hatte sich, aller Mittel bar, einer Kapitänsfrau als Zofe aufgedrängt. Das Schiff, Juno mit Namen, urspünglich nach Europa bestimmt, war nach Madras beordert worden. Dann waren die schrecklichen dreiundzwanzig Tage gefolgt, da jene Juno als Wrack in der grausigen See trieb.
Nun war eigentlich alles wieder gut, sie war herzlich im Hause ihres Onkels empfangen worden, hatte alles wie ein lieb Kind vorgefunden, alles tat man ihr zur Freude. Ihr Onkel war selber mit hinauskutschiert, damit sie der neuen Juno noch einmal Abschied zuwinken könne, und wegen der Soldaten. Er hätte sie auch trotz seiner beträchtlichen, nabobähnlichen Körperfülle sogar zum Strande hinunterbegleitet, aber das hatte sie abgelehnt. Weshalb sollte er mit ansehen, daß ihre Rührung nicht nur dem Schiffe galt? Er war Witwer. Das junge, heimgekehrte Blut, so weit gewandert, berührte und läuterte sein von Gold- und Perlenpreisen bestäubtes Gemüt.
Читать дальше