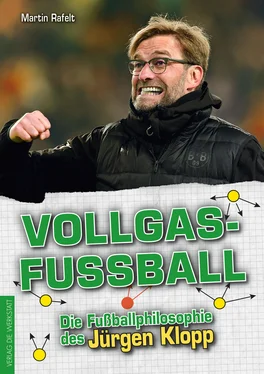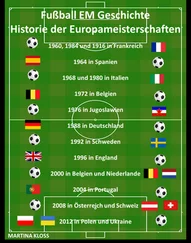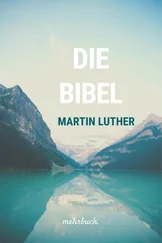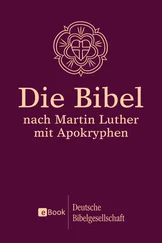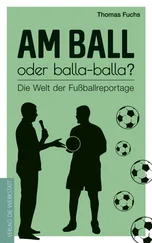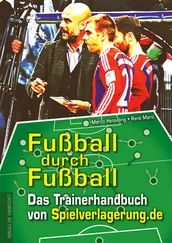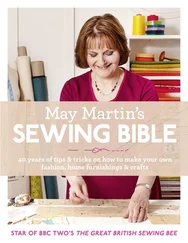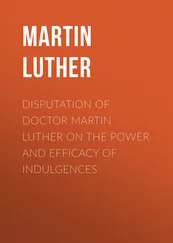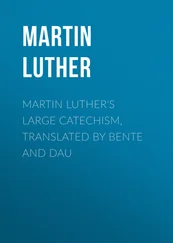Die Sprache formt das Denken. Um also Spieler mit besserem Denken auszustatten, muss man eine bessere Sprache anwenden. Die weniger intuitive, aber konkretere Sprache von Klopp und Co. führt dazu, dass auch die Spieler expliziter und definierter über die Geschehnisse auf dem Feld nachdenken. So bekommen sie ein stärkeres Bewusstsein dafür, ob man sich im Spielaufbau oder im Umschaltspiel befindet, und passen ihren Rhythmus dementsprechend besser an, sprich: Wenn ich genau weiß, „jetzt ist ein Umschaltmoment“, dann werde ich auch entschlossener umschalten. Wenn ich weiß, wir spielen als Team ein „Mittelfeldpressing“, werde ich mich an diesem Pressing auch beteiligen, wenn ich nicht in direkter Ballnähe bin, denn ich weiß um meine Aufgaben innerhalb dieser Strategie; das Gleiche wird mir vielleicht nicht notwendig erscheinen, wenn nur gesagt wird, dass wir im Mittelfeld die Zweikämpfe gewinnen wollen. Wenn ich weiß, ich soll das Spiel „vertikal eröffnen“, werde ich häufiger den Blick nach vorne richten und mehr über meine Passentscheidungen reflektieren.
Vorgaben zur Spielweise sorgen auch dafür, dass man das eigene Verhalten besser vergleichen und einordnen kann. Da damit gleichzeitig Spielziele formuliert werden, kann ich am Ende eine bessere Problemanalyse durchführen. Ich kann überprüfen, ob die taktischen Ziele erreicht wurden – und wenn nicht, habe ich klare Gründe für eine Niederlage und eine klare Vorgabe, woran ich arbeiten muss. Diffuse, intuitive Vorgaben lassen sich schwer überprüfen und schwer erarbeiten. Wann ist „schneller spielen“ schnell genug, und was muss ich konkret dafür tun? Schwer zu sagen.
Das beste Beispiel für die Wirkung dieser verbesserten Konzeptionalisierung ist das überaus starke Gegenpressing der Dortmunder Borussia. Gegenpressing ist mittlerweile im deutschsprachigen Raum wie ein Schlagwort für guten Fußball, doch das war nicht immer so. Holzschnittartig ausgedrückt: Vor zwei, drei Jahren musste man noch regelmäßig erklären, dass es sich dabei um die Ballrückeroberung handelt; mit Betonung auf „rück“, also direkt nach Ballverlust, anders als das „normale“ Pressing gegen den gegnerischen Spielaufbau. Vor fünf Jahren musste man nicht nur diesen Unterschied erklären, sondern die Idee an sich. Und vor zehn Jahren hat kein Mensch von Gegenpressing geredet.
Spannend daran ist, dass Gegenpressing an sich nicht neu ist. Man kann sich ein beliebiges Fußballspiel aus einer beliebigen Ära anschauen und wird mit großer Wahrscheinlichkeit einzelne Spielszenen finden, in denen eine Mannschaft den Ball verliert und ihn sofort zurückholen kann. Wenn man direkt Zugriff auf den Ball hat, geht man intuitiv gleich wieder drauf. Jupp Heynckes legte schon in den 1980er Jahren großen Wert auf diesen Aspekt bei seinen Mannschaften. Speziell im deutschen Fußball ist das „Nachsetzen!“ bis in die tiefsten Niederungen eine der am meisten eingeforderten Tugenden. Nachsetzen bezeichnet im Grunde Gegenpressing, nichts anderes. Aber nie in der Fußballgeschichte hat eine Mannschaft so gut „nachgesetzt“, wie Klopps BVB „gegengepresst“ hat.
Schnippisch könnte man sagen, das habe einfach daran gelegen, dass die Väter der Kinder an den Ascheplätzen der Republik immer nur einzelne Spieler zum Nachsetzen auffordern und nicht die ganze Mannschaft. Der Unterschied ist nämlich vor allem dieser: Bei Klopp ist Gegenpressing eine Mannschaftsstrategie, kein spontanes, individuelles Verhalten. Wenn man einer Gruppe unterschiedlich ausgebildeter Menschen eine neue Strategie vermitteln will, hilft es gleichzeitig ganz enorm, wenn diese einen Namen hat. „Nachsetzen“ ist die Bezeichnung eines Verhaltens, nicht die Bezeichnung einer Strategie. „Gegenpressing“ hingegen klingt nach einer Idee, nach etwas Neuem, Durchdachten. Das ist fancy. Damit kann man Autos verkaufen.
Klopp, der emotionale Taktik-Rhetoriker
Im Grunde ist es Ideen-Marketing, das Klopp betreibt. Das mag vielleicht despektierlich klingen, dies wäre es aber nur, wenn man nicht die Notwendigkeit dahinter sieht. Als Fußballtrainer muss man einer heterogenen Gruppe von Personen, die häufig eher egoistisch motiviert sind, einen taktischen Plan vermitteln und bestenfalls noch eine gemeinsame Identität geben. Das funktioniert jedoch nur dann mit vollem Erfolg, wenn jeder versteht, was man sagt – und auch davon überzeugt ist, dass das funktionieren kann. Als Fußballtrainer eines Vereins mit Tausenden oder Millionen von Anhängern muss man noch viel mehr Menschen davon überzeugen, dass man einen guten Plan hat. Und spätestens hier wird es unmöglich, den Plan in allen Einzelheiten zu erklären. Stattdessen muss die Idee so verpackt werden, dass sie intuitiv und emotional zugänglich ist und selbst oberflächlich betrachtet schlüssig erscheint.
Diese Disziplin beherrscht Klopp wie kaum ein anderer im Fußballgeschäft. Pep Guardiola beispielsweise hat trotz größerer Erfolge permanent mit Skepsis bezüglich seiner fußballerischen Idee zu kämpfen. Auch bei Klopp trat diese Skepsis bei Misserfolgen hier und da mal auf. Unter dem Strich weiß er aber nicht nur, sich zu erklären, sondern ihm gelang es sogar, breitflächig zu euphorisieren. Das gelang zu seinem Amtseinstieg in Dortmund wie auch in Liverpool; noch bevor er Erfolge vorzuweisen hatte also. Menschen vertrauen Klopp. Die Basis für diese Fähigkeit: Klopp ist emphatisch. Nicht nur im Fühlen, sondern auch im Denken. Er versteht, wie andere Leute Dinge aufnehmen und verarbeiten. Er fühlt, ob er etwas so erklärt, dass andere es verstehen, dass es andere überzeugt und sogar mitreißt. Das hilft ihm in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit wie auch in der Vermittlung seiner taktischen Inhalte.
So bleiben immer wieder bestimmte Aussagen von Klopp hängen, die die strategische oder taktische Herangehensweise an das Spiel griffig beschreiben und gleichzeitig neuartige Denkanstöße liefern. Zum Beispiel sagte Klopp vor Spielen gegen Bayern, dass man versuche, den Gegner „auf das eigene Niveau herunterzuholen“ – und beschrieb damit, wie man taktisch die gegnerische Spielstärke zerstören wollte. Seine These, das Gegenpressing sei der beste Spielmacher der Welt, wurde etliche Male zitiert. Klopp wirft also alte Denkmuster um, richtet den Fokus auf den taktischen Aspekt, aber er nutzt gleichzeitig auch ein bekanntes Konzept zur Verpackung und emotionalisiert durch die inbegriffene Wertung. Eine eierlegende Wollmilchsau der Didaktik und Rhetorik.
Mit dieser vielseitigen Rhetorik bringt Klopp die Leute hinter sich. Er schafft es, sich als intellektuell und kompetent zu profilieren, ohne dabei abgehoben zu wirken. Dass er scheinbare Gegensätze vereint, ist auch die Grundlage dafür, dass er als Charakter so mitreißend wirkt. Auf der einen Seite ist er freundlich, emphatisch, humorvoll und intellektuell, auf der anderen Seite kämpferisch, impulsiv, aggressiv und überzeugend, sprich: eine Führungsfigur. Dadurch kann er mögliche negative Aspekte einzelner Charakterzüge auffangen und sich flexibel Situationen anpassen.
Die Leute mögen Klopp und vertrauen ihm gewissermaßen. Weil er viel, viel grinst und lacht, und weil er entschlossen wirkt, wenn er es einmal nicht tut; weil er hemdsärmlig daherredet, weil er gute Pointen setzt, weil er energiegeladen und trotzdem locker ist, weil er durchdachte Dinge sagt, die man versteht. Wie viel von seiner Herzlichkeit dabei bewusste und vielleicht sogar aufgesetzte Show ist, können nur diejenigen seriös einschätzen, die ihn persönlich sehr gut kennen. Fakt ist: Die Menschen kaufen es ihm ab. Der Wert dieser Fähigkeit ist im Profifußball nicht zu unterschätzen. Gerade in Phasen, in denen es schlecht läuft, sorgt sie dafür, dass das Maß an Kritik im Rahmen bleibt. Sie schützt einen Trainer vor dem Einfluss der Öffentlichkeit. Dadurch kann dieser stringenter an seinen taktischen Ideen arbeiten, kann überzeugender auf die Mannschaft eingehen und muss keine Kompromisse eingehen.
Читать дальше