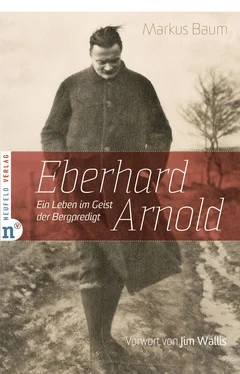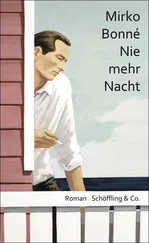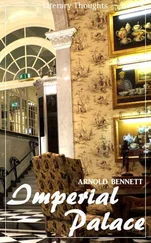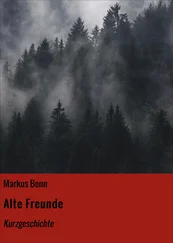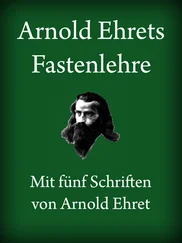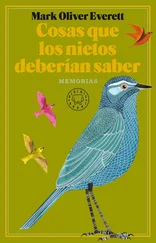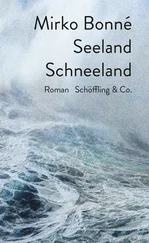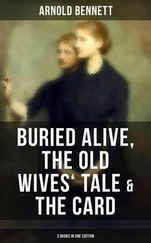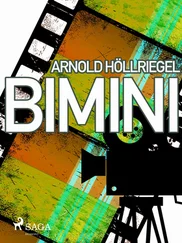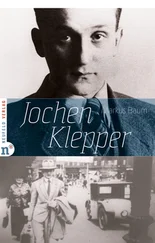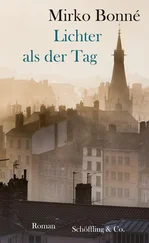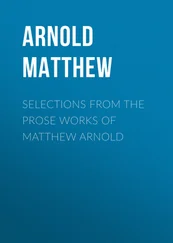Eberhard Arnold als 19jähriger im Familienkreis (stehend von links: Clara, Carl Franklin Arnold, Betty, sitzend von links: Hermann, Elisabeth Arnold, Hannah, Eberhard)
Just im Sommer 1899 hatte sich Ernst-Ferdinand Klein mit seiner kompromisslosen Wahrheitshebe auch an der neuen Wirkungsstätte Feinde geschaffen. Er hatte durchgesetzt, dass der Kantor wegen unsittlicher Handlungen an einigen Mädchen der Dorfschule entlassen wurde. Der Kantor war nun zwar weg, aber dafür boykottierte ein großer Teil der Dorfbevölkerung die Gottesdienste. Eberhard und Clara Arnold fanden einen festungsmäßig verrammelten Pfarrhof vor. Gelegentlich gingen Scheiben zu Bruch; Drohbotschaften flogen durchs Fenster.
Durch die Umstände stieg der Onkel noch in Eberhard Arnolds Achtung. Der hatte sich von einem Erwachsenen noch nie so gut verstanden gefühlt. Und noch etwas beeindruckte ihn. Er schreibt später, an seinem Onkel habe er zum ersten Mal ein lebensfrohes und mutiges Christentum gesehen, eine Liebe zu Jesus und zu den Armen, wie sie ihm vorher noch nicht begegnet sei.
Eine Episode verfolgte der Gymnasiast nur als stummer und staunender Zeuge: Ein Heilsarmeesoldat war zum Essen eingeladen. Ernst-Ferdinand Klein begrüßte ihn herzlich, nannte ihn „Bruder“ und hörte sich sehr aufmerksam und bewusst den Bericht über die „Seelenrettungsarbeit“ in den dunklen Winkeln Berlins an. Eberhard Arnold war nach eigener Aussage tiefbeeindruckt – einerseits vom Respekt des Onkels vor dem einfachen Salutisten, noch mehr aber von der Hingabe und Selbstverleugnung, die er diesem Mann abspürte.
Ebenfalls im Lauf dieser vier Wochen entdeckte er das Neue Testament. Die Evangelien vor allem. Es war ihm peinlich, wenn hereinplatzende Verwandte ihn beim Bibellesen überraschten. Noch nicht einmal mit dem Onkel wollte und konnte er über die aufgebrochenen Fragen reden. Erst beim Abschied rückte er heraus mit seiner Befürchtung, zuhause gebe es niemanden, der ihm Jesus besser erklären könnte. Ernst-Ferdinand Klein versuchte diese Sorge zu zerstreuen.
Anfang August zurück in Breslau, wurden die Geschwister getrennt bei befreundeten Familien einquartiert. Die Eltern waren mit den jüngsten Töchtern, Betty und Hannah, an die Nordsee gereist. Eberhard kam in der Familie eines älteren Professors unter. Auch dieser war bekennender Christ, allerdings sehr nüchtern, musterhaft und unbeweglich und damit nicht der ersehnte Gesprächspartner. Dafür entdeckte der Gymnasiast im Schreibtisch seines Stübchens das Buch „Nachfolge Christi“ von Thomas von Kempen. Das Werk war damals schon rund 500 Jahre alt. Eberhard Arnold erkannte darin einen Schlüssel zu den Evangelien und einen Leitfaden für ein Leben in den Spuren Jesu: „ ‚Wer mir nachfolgt, wandelt nicht in Finsternis‘, spricht der Herr. Mit diesen Worten ermahnt uns Christus, seinem Leben und seinen Sitten zu folgen, wenn wir wahrhaft erleuchtet und von aller Blindheit des Herzens befreit werden wollen. Darum muss dies unsre höchste Sorge sein, uns in das Leben Jesu Christi zu versenken …“ 1
Eberhard Arnold hat in den folgenden Wochen fast jede freie Minute zum Lesen und Nachdenken genutzt. Er berichtet später, Jesu Bild sei ihm in blendender Reinheit erschienen. Ihm nachzufolgen sei dringendste Forderung geworden – ein innerer Ruf, der alles andere übertönt habe. Die Eltern, Anfang September zurückgekehrt, bekamen zunächst kaum etwas mit von dem Drama, das sich da im Innern ihres Sohnes abspielte. Er war in sich gekehrt, auffällig war allenfalls, dass er die Jugendstunden eines jungen Pastors besuchte.
Äußerlich änderte sich an seiner Haltung kaum etwas – bis zum 2. Oktober 1899. Da fasste er beim Spazierengehen auf der Hauptstraße unvermittelt einen Entschluss, bog auf die Promenade ab und steuerte die Dienstwohnung des Pastors an. Der war anscheinend nicht überrascht und hörte sich einen Schwall von Fragen und Einwänden an. Unter anderem diese: „Warum höre ich bei Ihnen so wenig vom Heiligen Geist? Ich verlange nach der Wirkung des Geistes Christi.“ – Worauf der Pastor gelassen erwiderte, das sei ja einzig und allein die Wirkung des Heiligen Geistes, dass der „junge Freund“ auf einmal zu ihm gekommen sei. Das leuchtete ein. Mit ein paar behutsamen Ratschlägen wurde Eberhard Arnold entlassen. Er ging rasch nach Hause, schloss sich in den Salon ein, schlug in seiner Taschenbibel das dritte Kapitel des Johannesevangeliums auf und las es laut. Das heißt: Er buchstabierte für sich persönlich die Bedeutung des Begriffs „wiedergeboren“ (Joh 3,3ff), bekannte seinen Glauben an Jesus, den Sohn Gottes (Joh 3,16), und er fasste mit den Worten von Joh 3,21 den Entschluss, mit allen bösen Werken zu brechen und künftig „die Wahrheit zu tun“. Außerdem erwog er bis in die Einzelheiten seiner Lebensführung hinein den Preis und die Veränderungen, die sein Schritt von ihm fordern würde.
Eine weitreichende Entscheidung, zumal für einen 16-Jährigen. Sie wurde belohnt: Als unsagbare Freude habe der Strom der Liebe Gottes sein Herz überflutet, schreibt er mehr als 30 Jahre später. – Als er schließlich den Salon verließ, bis ins Innerste erschüttert von seiner Erfahrung, fand er die Familie zum Abendbrot im Esszimmer versammelt. Mit belegter Stimme wandte er sich an seine Eltern und erzählte ihnen, was geschehen war und was das für ihn bedeute. Der Vater sagte gar nichts, verhielt sich zweifelnd-abwartend. Die Mutter fand einen begütigenden Satz, konnte die Erklärung ihres Sohnes aber nicht so recht einordnen. Die Geschwister schwiegen. Nach einer Pause – peinlich nur für die anderen, nicht für ihn – ging man zur Tagesordnung über.
Zunächst einmal gab Eberhard Arnold die letzten Reste von herrschaftlich-großbürgerlichem Gehabe auf. Pferderennen und zielloses Herumschlendern waren passé. Sein schickes Elfenbeinstöckchen kam ihm nun albern vor. Der pubertären Prahlerei seiner Kameraden entzog er sich. Er verabschiedete sich in aller Form von den wohlgeformten marmornen Venusskulpturen im Stadtmuseum, mit deren Hilfe die Schüler gelegentlich ihre Phantasie angeheizt hatten. Mit mehr Mühe verkniff er sich all die kleinen Kniffe und Winkelzüge, mit denen er sich bisher durch den Schulalltag gemogelt hatte. In den letzten Herbstwochen besuchte er reihum seine Lehrer, erzählte ihnen von seinem inneren Schritt und bat sie um Verzeihung für seinen Übermut und sein bisweilen respektloses Verhalten in der Vergangenheit. Die meisten nahmen seine Erklärung skeptisch auf. Ihre Anerkennung wuchs erst in den folgenden Monaten, als der bis dahin sehr mäßige Schüler mit unvermutetem Fleiß seine Leistungen verbesserte. – Den Klassenkameraden war Eberhard Arnolds Bekenntnis zum Teil gleichgültig, zum Teil ärgerlich, sofern sie ihn bisher eher als Anstifter zu Späßen oder Abenteuern bewundert hatten. Mit den Klassenbesten wurde er auch dann nicht warm, als er kurzzeitig zu ihnen aufschloss. Leistung um der Leistung willen war nicht seine Sache; auf Anerkennung gab er wenig.
Die üblichen Feste und Gesellschaften begann er zu meiden; Einladungen zu Geselligkeiten bei befreundeten Professorenfamilien lehnte er ab, weil sie ihm neuerdings hohl und wertlos erschienen. Darüber kam es zu ernsten Auseinandersetzungen mit seinen Eltern, insbesondere mit dem Vater („Unbescheidenheit eines unreifen Jungen!“). In seinem Eifer stellte der 16-Jährige Bedingungen: ja, er würde hingehen, wenn er die Gesellschaft in offener Rede auf den Irrtum ihres Lebens aufmerksam machen könne.
Читать дальше