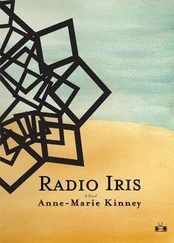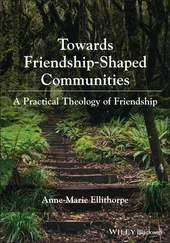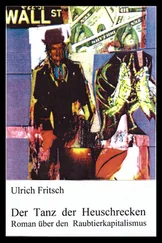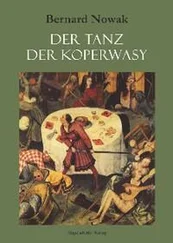1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Mit seinen weitläufigen, den englischen Landschaftsgärten des Rokoko nachempfundenen Anlagen erinnerte Willhofsgave sie nicht wenig an den Frederiksberg Park, und es amüsierte sie, wenn sie sich vorstellte, Hunderte von Kopenhagener Kindermädchen würden ihre Nähmaschinen dorthin mitbringen, um ihrer Handarbeit nachzugehen, während die Kinder herumtollten, anstatt die Wege plattzutreten und ihre Schuhe abzunutzen. Ein heimisches Gefühl vermittelten ihr auch die Schilder mit lateinischen Namen, die vor den Beeten, Büschen und Bäumen standen, genau wie im Botanischen Garten von Kopenhagen. Sie hätte sich nicht träumen lassen, dass es so etwas noch woanders gab als dort oder in den Grünanlagen von Frederiksberg.
Manchmal kam der Gärtner und legte den Kindern Obst auf den Gartentisch, und eines Tages hatte er einen Blumenstrauß für Vidde dabei. Sie hatte nie zuvor in ihrem Leben ein Bukett bekommen, stellte es in ein Marmeladenglas und nahm es mit auf ihr Zimmer. Die Verwalterin ärgerte sich: ein Blumenstrauß auf einem Dienstmädchenzimmer, so was hatte sie noch nie erlebt. Sie bat Vidde darum, das Glas zumindest so hinzustellen, dass man es von draußen nicht sehen konnte. Vidde hatte Schwierigkeiten, sie ernst zu nehmen, weil sie diesen sonderbaren jütländischen Dialekt sprach. Der Gärtner war ein schweigsamer Mann. Sie fragte sich manchmal, ob sich ihr Verhältnis zum Jütländischen ändern würde, wenn sich herausstellen sollte, dass auch er es sprach.
Später bekam Vidde noch reichlich Gelegenheit, in aller Ruhe darüber nachzudenken, ob sie in ihren geliebten Stadtteil Nyboder zurückziehen sollte, da wir im Winter immer vier Monate in Kopenhagen verbrachten. Ich nehme es als reine Schmeichelei, wenn sie sagt: «Das war unmöglich, Tyge, damals haben wir doch dich bekommen.»
Heute ist mein altes Kindermädchen über achtzig und gebrechlich. Mit derselben natürlichen Würde, mit der sie seit beinahe 50 Jahren ihren Platz als Faktotum und Betreuerin der zahlreichen Kinder unserer Familie ausfüllt, lässt sie sich auf dem Krankenlager von meiner Mutter betreuen. Sie will von niemandem sonst versorgt werden.
Das Vertrauensverhältnis der beiden Frauen wurde durch meine Geburt noch verstärkt. Die Unsicherheit und Verzweiflung meiner Mutter führte zu freimütigen Erörterungen und Handlungen wie unter Gleichgestellten. Jedenfalls schlug meine Mutter, wie Vidde mir berichtet hat, nach achtzehnjähriger gemeinschaftlicher Kindererziehung und Haushaltsführung vor, sich hinfort mit Sie und dem Vornamen anzureden.
Obwohl mein Vater als einziges Kind seiner Eltern der natürliche Hoferbe war, hatte er, nach seinen eigenen Worten, ebenso wenig Affinität zur Landwirtschaft wie meine Mutter zu einer großen ländlichen Haushaltsführung.
Er hatte völlig nach seinen eigenen Vorstellungen gelebt und sich gebildet, zunächst Staatswissenschaft studiert und danach in Frankreich und der Schweiz das Bankwesen erlernt, bevor er eine Anstellung in der Landwirtschaftsbank erhielt. Sein großes, über das Fachliche hinausgehendes Interesse galt sein Leben lang der Philosophie und den Sprachen: Latein und vor allem Griechisch. Wenn im Winter, während wir in Kopenhagen wohnten, jemand nach ihm verlangte, sagten Vidde oder meine Mutter zu einem der älteren Kinder: «Lauf mal eben runter zu ihm in die Königliche Bibliothek.» Sein Vater und Großvater beschäftigten sich ebenso mit dem Griechischen wie seine Kinder, wohingegen Helmuth und mir, genau wie meinem Großvater mütterlicherseits, das Lateinische vertrauter ist. Mein Vater hat sich nie an den Geruch von Stall und Tieren gewöhnt, fühlt sich heute jedoch allem, was mit Willhofsgave zu tun hat, tief verbunden.
Wenn ich betone, dass mein Vater hinsichtlich der Ausbildung seinen eigenen Vorstellungen folgte, ist das mehr eine Redensart. Denn wer, wenn nicht die Eltern, setzen einem die Dinge in den Kopf, die zum Ausgangspunkt des eigenen Handelns werden? Dies gilt um so mehr für Menschen, denen es ihre angeborene Andersartigkeit erschwert, ganz auf eigene Faust zu handeln. Hier denke ich natürlich (wieder) an mich, obwohl es doch die Geschichte meines Vaters ist, die ich erzählen will, weil sie auch meine eigene und die meiner Geschwister einschließt, meine jedoch nur als Fußnote.
Nach dem Abitur begann ich mein Studium an der Universität von Kopenhagen, wo ich, wie üblich, nach einem Jahr cand. phil. wurde. Verschiedene Krankheiten, deren Ursachen, wie ich heute einsehe, womöglich auf fehlende Motivation zurückzuführen sind, waren der Grund dafür, dass ich keinen Studienplatz für Musikwissenschaft erhielt – später habe ich mich recht beliebig in mal mehr, mal weniger günstigem Fahrwasser bewegt.
Durch seinen Werdegang brach mein Vater frühzeitig mit der tief verwurzelten Familientradition, sich den Naturwissenschaften zuzuwenden. Als Beleg dafür, dass sein Vater es war, der die Politische Wissenschaft für ihn auswählte, führe ich ins Feld, dass es meinen Großvater, genauso wie den gesamten Landadel, erschütterte, als die Verfassung vom Juni 1849 das Erbhofsystem als Form des Grundbesitzes nicht mehr akzeptieren wollte und die Gründung neuer Erbhöfe untersagte.
Wie all seine Standesgenossen sah auch mein Vater durch die Verfassungsänderung ein Unheil herannahen. Die Abschaffung des Lehnswesens vor drei Jahren war der Donnerschlag, der den drohenden Wolken folgte, und es kam genau so, wie Großvater es vorausgesehen hatte: Der dritte Erbgutbesitzer, also sein Sohn, musste im hohen Alter alle verwaltungstechnischen und ökonomischen Kniffe anwenden, um Willhofsgave als Erbgut zu bewahren.
Als junger Besitzer eines Erbguts wusste mein Vater natürlich, dass er, wie der Titan Atlas, einem gestürzten Göttergeschlecht angehörte. Vielleicht hatte er gehofft, das Lehnswesen würde abgeschafft, noch bevor er an der Reihe wäre, den Erbhof weiterzuführen. Jedenfalls bin ich sicher, dass er mit seinen lebenslangen philosophischen und sprachlichen Studien gleichsam versuchte, sich mit einer Schutzhülle zu umgeben, die den Schmerz des Schlages lindern sollte, der ihn eines Tages treffen würde. Derart vorbereitet, erschütterte es ihn dennoch, als das Gesetz ihn vor die Wahl stellte, eine einmalige Summe zu entrichten, die er nicht besaß, oder das Erbgut unter Zahlung aller Steuern und Abgaben weiterzuführen, deren Umfang in keinem Verhältnis zu den Erträgen stand, die der magere Boden abwarf.
Die meisten Erbhofbesitzer gaben die unveräußerliche Form des Grundbesitzes auf, sobald das Gesetz 1919 in Kraft getreten war, bezahlten für die Privilegien, die andere über Jahrhunderte genossen hatten, die vorgeschriebene Summe in die Staatskasse und ließen das Gut in freien Familienbesitz übergehen. Mein Vater hielt als einer der letzten stand. Es hätte uns die Kleinigkeit von 200 000 Kronen gekostet, den Erbhofstatus für das junge Gut Wilhofsgave aufheben zu lassen.
«So viel Geld habe ich nicht, und mir fehlt der Wille, es zu beschaffen», pflegt er zu sagen.
Jedesmal, wenn meine Eltern und Schwestern in der Zeitung lesen, dieser oder jener Erbhof sei in fremde Hände übergegangen, trifft es sie, als handele es sich um einen Todesfall. Wenn ein entrechteter Erbgutbesitzer sich rasch dazu entschließt, das Gut oder zumindest Ländereien an die umliegenden Höfe zu verkaufen, fühlt sich mein Vater wie der ohnmächtige Zuschauer einer Entweihung.
Meine «Grave»-Schwester Andrea, die sonst ihren Mund nicht aufkriegt, war – obwohl darauf gefasst – so schockiert von der Abschaffung des Lehnswesens, dass sie beinahe ihr Stottern, unter dem sie phasenweise sehr gelitten hatte, überwand und zu flüssiger Rede überging:
«Es ist eine Tragödie, dass man Grund und Boden auf diese Weise zu einer simplen Handelsware macht – wie einen Ballen Stoff oder ein Pfund Butter», sagte sie erregt und presste ihr Taschentuch, das wie eine Kugel in ihrer Hand lag, zusammen. Dort hat es gelegen, solange ich denken kann, vielleicht schläft sie sogar damit. Als Kind habe ich mich gefragt, ob sie sich womöglich mit einer Hand wusch, denn ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie es zu diesem Zweck aus der Hand legte.
Читать дальше